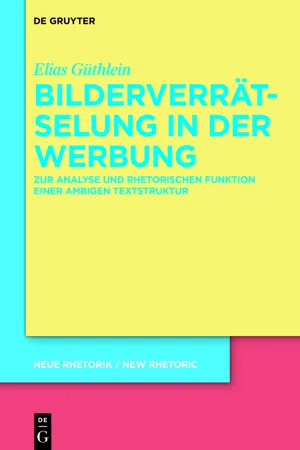a) Rätsel als hemmende Elemente (Petsch, Taylor, Georges und Dundes, Senderovich)
Die erste Strömung, die im Folgenden vorgestellt wird, nimmt hemmende Elemente als Wesensmerkmal des Rätsels in den Blick, für die vier Ansätze von fünf Autoren vorgestellt werden: Petsch, Taylor, Georges und Dundes sowie Senderovich. Die Idee des Ansatzes geht dabei auf Petsch zurück, der als Vorreiter der modernen Rätselforschung gilt.
Petsch trifft eine grundlegende Unterscheidung zwischen zwei Typen von Rätseln, die ihren Widerhall in der Rätselforschung gefunden hat, ursprünglich wohl aber auf die in Rätselsammlungen üblichen Einteilungen zurückgeht, in denen zwischen „wirklich gereimten“ und den in „Prosa abgefassten ‚Scherzfragen‘“ unterschieden wird, wie Petsch zu lesen ist.42 Petsch greift diese Unterscheidung auf und definiert darauf aufbauend das Wesensmerkmal des Rätsels wie folgt:
Jene ‚wirklichen‘ Rätsel haben den Zweck, in einer verhüllenden, das Nachdenken anreizenden, vielleicht auch verwirrenden poetischen Einkleidung einen Gegenstand zu umschreiben, der aus dieser Darlegung seines Aussehens, seiner Herkunft seiner Tätigkeit usw. durch den Verstand erkannt, d. h. erraten werden kann und soll.43
Die von Petsch herausgearbeiteten Charakteristika weisen eine gewisse Nähe zur aristotelischen Definition auf (Kap. I.4), gleich wenn es sich hier nicht um die strukturellen Bedingungen, sondern eine erste Annäherung an den Begriff des Rätsels handelt. Deutlich wird aber bereits hier, dass neben verhüllenden Elementen auch hinweisgebende Elemente als grundlegende Merkmale des Rätsels in die Überlegungen einbezogen werden, die somit eine Auflösbarkeit der Texte gewähren. Dieser Aspekt wird durch die Abgrenzung zur Scherzfrage untermauert: Diese unterscheide sich in der Entlegenheit der Lösung und Petsch deswegen unter den „unwirklichen Rätseln“ subsumiert.44 Petsch trifft darüber hinaus auch Abgrenzungen zu Weisheitsproben oder den sogenannten „Halslösungsrätseln“,45 die er ebenso zu den unwirklichen Rätseln zählt. Aufbauend auf dieser Differenzierung konkretisiert Petsch schließlich die strukturellen Bedingungen, des „Normalrätsels“.46
In der Differenzierung von unwirklichen und wirklichen sowie Normalrätseln hat Petsch offenbar ein vortheoretisches Begriffsverständnis von Prototypikalität im Sinn. So scheint er davon auszugehen, dass die jeweiligen Rätsel jeweils bessere oder schlechtere Kandidaten einer Gattung bilden. Für diese Rätsel setzt er dabei fünf Bedingungen an: „1. Einführendes Rahmenelement, 2. benennendes Kernelement, 3. beschreibendes Kernelement, 4. hemmendes Element und 5. abschließendes Rahmenelement.47 An dem folgenden Beispiel weist er diese Bedingungen nach:
1) In meines Vaters Garten
2) Seh ich sieben Kameraden,
3) Kein ein, kein Bein
4) Kann niemand erreichen
5) Wer dieses kann raten,
dem will ich geben einen Dukaten,
Wer dieses kann denken,
dem will ich einen Louisdor schenken.48
Für Petsch ist das Rahmenelement als eine „Aufforderung“ zum Rätselraten definiert, das ebenso wie das abschließende Rahmenelement auch implizit erfolgen kann. Diese Überlegung scheint dahingehend plausibel, als dass Rätseltexte durch einen kommunikativen Frame ausgewiesen werden, womit häufig Implikationen des Verstehens einhergehen, die im Rätsel selbst nicht zwingend thematisiert werden müssen. Entscheidend sind für Petsch demgegenüber die sogenannten Kernelemente, bei denen er zwischen „benennenden“ und „beschreibenden Elementen“ unterscheidet, die in einer unterstützenden Relation zu einander stehen und die von ihm betonte Erratbarkeit gewährleisten, indem sie Hinweise auf die Lösung streuen. Die Erschwernis von Rätseln entstehe demgegenüber durch ein hemmendes Element, das oftmals im Widerspruch zu diesen Angaben des Textes stünde.49
Das innovative Moment dieses Ansatzes ist darin zu sehen, dass die Lösbarkeit eines Rätsels als strukturelle und somit nachweisbare Bedingung perspektiviert wird. Problematisch ist dagegen, dass Petsch noch nicht in Strukturen, sondern Einzelelementen denkt. Dies ist angesichts der erst später einsetzenden Denkbewegung des Strukturalismus zwar nicht weiter verwunderlich, dennoch ist in diesem Aspekt ein Defizit zu verorten: Petsch suggeriert durch seine Zuordnung nämlich, dass die Elemente eines Textes jeweils nur zur Erschwernis oder zur Lösbarkeit beitragen können. Unter strukturellen Vorzeichen eröffnet sich dagegen eine differenzierte Sichtweise: Die Elemente eines Textes können prinzipiell vielschichtige Verbindungen eingehen und zugleich hemmende und unterstützende Elemente des Textes bilden (vgl. Kap. II.3.3c). Zudem stellt sich die Frage, ob die festgelegte Lösung eines Rätsels tatsächlich so alternativlos ist, wie es Petschs Abgrenzung zur Scherzfrage suggeriert und ob sich in diesem Aspekt nicht ein Qualitätsmerkmal der Vertextung eröffnet: je zwingender die Lösung eines Rätsels ist, desto prototypischer ist seine strukturelle Disposition (Kap. II.3.6b).
Diese Kritikpunkte richten sich allerdings nicht nur an den Ansatz von Petsch – in Anbetracht der weiteren Forschungsansätze bilden sie wiederkehrende Problematiken.
Mit Taylor, der mit wissenschaftlich erörternden Publikationen, einer Bibliografie sowie einer Rätselsammlung die wissenschaftliche Erfassung der Gattung vorantrieb, beginnt die „Amerikanische Schule“ des Rätsels, wie Schittek wohl zurecht feststellt.50 Seine Angebote zur Definition und Struktur des Rätsels können der Arbeit von Petsch jedoch kaum Nennenswertes hinzufügen, was auch daran liegt, dass Taylor einen einseitigen Fokus auf Metaphern legt:
The true riddle or the riddle in the strict sense compares an object to another entirely different object. In other words, a true riddle consists of two descriptions of an object, one figurative and one literal and confuses the hearer who endeavors to identify an object in conflicting ways.51
Neben der Metaphern-Problematik zeigt sich in Taylors Rätseldefinition noch eine weitere Schwierigkeit in der Begrenzung der Lösung auf Einzelwörter („objects“), was im Forschungsdiskurs immer wieder beobachtet werden kann und insbesondere von Tomasek (s. u.) als Charakteristikum des Rätsels postuliert wird. Dabei weisen die betreffenden Autor*innen selbst immer wieder darauf hin, dass auch mehrere Begriffe in einem Rätsel gesucht werden können, was in den bisherigen Forschungsarbeiten mit strukturellem Schwerpunkt jedoch ohne Konsequenz blieb. Ein weiteres Defizit in der Definition Taylors ist außerdem darin zu sehen, dass die Lösbarkeit als Kriterium nicht einbezogen oder zumindest nicht prominent erwähnt wird.
Taylor selbst räumt später ein, dass seine Definition nicht alle Fälle des Rätsels abdecken kann. Im Unterschied zu Petsch berücksichtigt er dagegen, dass die Elemente von Rätseltexten zugleich in unterschiedliche Strukturen eingebettet sein können, wenn er hier auch einseitig von Metaphern ausgeht: So könne das hemmende Element („negative element“) in der übertragenen Lesart der Metapher gesehen werden, deren Literalsinn gleichermaßen als unterstützendes Element („positive element“) fungieren könne.52 Strukturell gesehen bleibt aber unklar, wie viele solcher Elemente kombiniert werden können und inwiefern die Lösbarkeit eines Rätsels damit objektiv möglich ist.
Taylor unternahm schließlich noch einen letzten Anlauf zu einer Definition, bei der er offenbar darauf bestrebt war, eine höhere Generalisierbarkeit zu gewährleisten. Dort schreibt er: „[The true riddle] consists of a vague general description and a specific detail that seems to conflict with what had gone before.”53 Nicht nur hält Taylor in dieser Reformul...