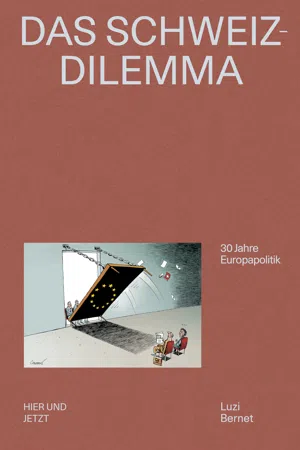![]() DAS RAHMENABKOMMEN
DAS RAHMENABKOMMEN![]() Eine Schweizer Idee
Eine Schweizer Idee![]()
Am Mittwoch, 5. Juli 2006, traf ich, von Zürich kommend, in Strassburg ein. Nach etlichen Anläufen war es Stephan Israel, dem damaligen Brüsseler Korrespondenten der NZZ am Sonntag, endlich gelungen, einen gemeinsamen Interviewtermin mit José Manuel Barroso, EU-Kommissionspräsident (2004 – 2014), zu vereinbaren. Unser Gespräch fand am Rande einer Sitzung des EU-Parlaments in der elsässischen Hauptstadt statt, in einem eher unwirtlichen Bürogebäude aus Stahl und Glas. Wir wussten, dass wir es mit dem Interview, dessen Publikation für den darauffolgenden Sonntag geplant war, kaum unter die wichtigsten Schlagzeilen des Tages schaffen würden. Das Interesse war ganz auf das Endspiel zwischen Italien und Frankreich an der Fussball-Weltmeisterschaft in Deutschland gerichtet. Es war ein dramatisches Finale: rote Karte für Frankreichs Superstar Zinédine Zidane, Penaltyschiessen, Sieg für die «Azzurri». Dagegen konnten wir mit Barroso, einem ausgesprochen kühlen und distanzierten Funktionär, nichts ausrichten.
Aber immerhin: Ein Interview mit dem Kommissionspräsidenten bekommt man nicht alle Tage, und einige Aussagen über den seit Längerem schwelenden Streit zwischen Bern und Brüssel über die Steuerpolitik gewisser Kantone und die im November 2006 anstehende Abstimmung über die sogenannte Kohäsionsmilliarde fanden trotz des Fussballspiels Eingang in die Nachrichtenportale.80
Im Rückblick aufschlussreicher ist indessen eine andere, unspektakuläre Aussage Barrosos, die damals völlig unbeachtet blieb. Auf die Frage, was er denn von der Idee eines Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU halte, antwortete der Portugiese: «Das ist etwas, wozu ich zuerst die Meinung Ihres Bundespräsidenten anhören will.»81
Die Zurückhaltung des Kommissionspräsidenten in unserem Interview fand ihre Fortsetzung am darauffolgenden Montag, als Moritz Leuenberger, der damalige Schweizer Bundespräsident, der EU-Kommission in Brüssel einen Arbeitsbesuch abstattete. Beim Thema Rahmenabkommen kamen, um es zurückhaltend zu formulieren, keine Emotionen hoch: «Eine recht kühle Reaktion rief die schweizerische Initiative hervor, die unzähligen bilateralen Abkommen in ein Rahmenabkommen zusammenzufassen», notierte die NZZ. Was für ein Unterschied zum späteren Gezänk um diese Frage! Und was für ein Kontrast zu den Umarmungen und leidenschaftlichen Küssen Jean-Claude Junckers, Barrosos Nachfolger an der Spitze der Kommission, auf die Wangen verdutzter Bundespräsidentinnen, die im Zuge der Verhandlungen die Temperatur der EU fühlen wollten.
2006 war die Welt noch eine andere, und der Vertrag, der von der SVP später als «Frontalangriff auf unsere Souveränität, unsere Selbstbestimmung und unsere Demokratie» gewertet wurde,82 war noch eine schweizerische Idee, von der man in Brüssel nicht recht wusste, wie man sich dazu verhalten sollte.
Die Geschichte des Rahmenabkommens ist reich an Episoden und Merkwürdigkeiten aller Art: Es geht dabei nicht nur um Küsse und Umarmungen auf dem diplomatischen Parkett, nein, es spielen auch ein «Reset»-Knopf, die mongolischen Weiten, rote Linien (und Köpfe), leere Konferenztische, Geheimtreffen und persönliche Kränkungen eine Rolle. Auch die Liste des verantwortlichen Personals ist ausserordentlich lang. Nicht weniger als drei Aussenminister und fünf Chefunterhändler verbrannten sich die Finger an dem Dossier. Das Rahmenabkommen taucht in den Annalen auch unter den Namen Marktzugangsabkommen, Institutionelles Abkommen beziehungsweise unter der Abkürzung «InstA» oder – nach einer Idee von Jean-Claude Juncker – als Freundschaftsvertrag auf. Die Verhandlungen dauerten von Mai 2014 bis Ende November 2018, wobei aus Schweizer Sicht danach noch Gespräche notwendig wurden, von denen man nicht so recht wusste, ob man sie als «Verhandlungen» bezeichnen durfte. Am 26. Mai 2021 schliesslich zog der Bundesrat dem Vorhaben den Stecker und erklärte, dass für ihn die «Bedingungen für einen Abschluss nicht gegeben» seien. Im Unterschied zu den vorherigen Etappen der Schweizer Europapolitik kam es dabei weder zu einer Involvierung des Parlaments noch der Kantone oder der Stimmbevölkerung.
Der ursprüngliche Charme der Idee eines Rahmenabkommens lag wohl darin, dass man es zunächst als den «dritten»83 oder, je nach Zählweise, «vierten Weg»84 interpretieren konnte, als etwas zwischen den Beitrittsoptionen zur EU beziehungsweise zum EWR und den etwas sperrigen bilateralen Verträgen. Wiederum geisterte in den Köpfen die in der Schweizer Europadiskussion nicht zu tilgende Vorstellung herum, im Verhältnis mit der EU gebe es für die Schweiz zahlreiche, nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten der Beziehungspflege.
Insofern erinnert die Genese des Rahmenabkommens an einen Vorstoss aus den frühen 1960er-Jahren, als die Schweiz die Möglichkeit prüfte, mit Brüssel eine Assoziation auszuhandeln. Auslöser war der Umstand gewesen, dass Grossbritannien in jenen Jahren den Beitritt zur damaligen EWG anstrebte – womit die EFTA, der auch die Schweiz angehörte, markant geschwächt worden wäre. Zusammen mit den damaligen EFTA-Partnern Finnland, Österreich und Schweden wollte die Schweiz deshalb einen Assoziierungsvertrag abschliessen, um das Verhältnis zur EWG auf eine verlässlichere Basis zu stellen. Zu Verhandlungen kam es allerdings nie. Die Befürchtungen, damit wichtige Prinzipien der direkten Demokratie und des Föderalismus preiszugeben, überwogen. Vor allem aber veränderte sich die Lage 1963 dramatisch, als der französische Präsident Charles de Gaulle das britische Beitrittsgesuch zur EWG zurückwies und gleichzeitig auch die Assoziierungsträume der EFTA-Länder beendete.
Die Erinnerungen an diese Episode blieben aber lebendig. Der Gedanke einer passenden Assoziationsform tauche in Phasen der Unsicherheit und Orientierungssuche gerne wieder auf, hat der frühere Staatssekretär Jakob Kellenberger festgehalten. «Sein Zweck scheint zu sein, Isolationsängste abzuwehren, ohne über den Beitritt zu sprechen. Er scheint bei manchen für die Hoffnung zu stehen, es gebe eine Form des Dabeiseins, ohne dabei sein zu müssen.»85
Das Rahmenabkommen passte in dieses Denkmuster. Schweizer Diplomaten interpretierten den Ansatz später denn auch als «Idee sui generis», als einen eigenständigen Weg für Staaten wie die Schweiz, die der Union nicht beitreten, aber gleichwohl geordnete Beziehungen zu ihr unterhalten wollten.86
Erstmals taucht der Begriff eines «globalen Rahmenabkommens» im Integrationsbericht von 1988 auf, der unter der Verantwortung von Jakob Kellenberger verfasst worden war. Das Papier definierte als mögliche Ziele eines solches Vertrags die «Straffung und Strukturierung eines Beziehungsnetzes, das mitunter als unübersichtlich empfunden wird», die «Schaffung eines institutionellen Rahmens für generalisierte Informations- und Konsultationsverpflichtungen […]» und die «Schaffung eines eindeutigen Schwerpunktes in den Beziehungen Schweiz–EG, was das bestehende Nahverhältnis noch deutlicher zum Ausdruck brächte».87 Freilich: Im Unterschied zum später angestrebten Rahmenabkommen war damals die Rechtsharmonisierung und ihre institutionelle Sicherstellung als Voraussetzung für den gleichberechtigten Zugang zum Binnenmarkt noch kein Thema.
Die Idee von 1988 wurde jedenfalls nicht weiterverfolgt. Der Weltenlauf führte zu anderen europapolitischen Prioritäten, wie sie im EWR-Kapitel ausführlich dargestellt werden. Um das Rahmenabkommen wurde es erst einmal still.
Eine Wiederbelebung erfuhr es in den 1990er-Jahren. Eine schon länger existierende Gruppe aus Spitzenfunktionären, Politikerinnen und Diplomaten begann sich nach dem Scheitern des EWR mit zunehmender Intensität mit der Europafrage zu beschäftigen. In jenen Jahren stand die «Groupe de réflexion», so ihr Name, unter der Leitung des ehemaligen Nationalbankpräsidenten Pierre Languetin. Ihm und seinen Mitstreitern war es ein Anliegen, die Beziehungen zur EU nach dem Nein zum EWR besser zu strukturieren und dafür konkrete Vorschläge auszuarbeiten.88 Dabei knüpfte die Gruppe gedanklich an die von der Schweiz gut dreissig Jahre zuvor verfolgte Idee eines Assoziierungsabkommens an und schlug ein Modell mit drei Pfeilern vor: Der erste Pfeiler sollte den Zugang zum europäischen Markt sichern, beim zweiten ging es um die Teilhabe der Schweiz an den Aktivitäten der EU im Bereich der Aussen- und der Sicherheitspolitik, im dritten um die Zusammenarbeit in der Innenpolitik und der Justiz. Mit einer Opting-out-Klausel wollte man sicherstellen, dass sich die Schweiz aus Rücksichtnahme auf ihre Neutralität und die direkte Demokratie an gewissen Massnahmen der EU nicht beteiligen müsste. Und schliesslich forderte die Gruppe eine befriedigende Lösung für «institutionelle Fragen, Mitentscheidung, Vollzug, Kontrolle, richterliche Überprüfung». Damit war man schon nahe an den Themen, die in dem späteren Rahmenabkommen behandelt wurden.89
Die Gruppe schickte ihren Bericht im April 1997 an den Bundesrat – und erntete zunächst «donnerndes Schweigen».90 Erst ein zweiter Anlauf nach der Jahrtausendwende brachte das erwünschte Echo: Die «Groupe de réflexion» erarbeitete einen neuen Bericht und sandte ihn diesmal auch an die National- und Ständeräte, wo er auf fruchtbaren Boden stiess. Die erhöhte Aufmerksamkeit hatte damit zu tun, dass die Europadebatte in der Schweiz gerade auf Hochtouren lief: Im Mai 2000 hatten die Stimmberechtigten deutlich Ja zum ersten bilateralen Vertragswerk gesagt und wenig später der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen eine deutliche Abfuhr erteilt (März 2001). Und mit den Bilateralen II war bereits die nächste Herausforderung absehbar. Das Parlament drängte auf eine Gesamtschau. Es war die kleine Kammer beziehungsweise deren Aussenpolitische Kommission, die eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Optionen erstellen wollte. Experten wurden eingeladen, darunter auch die «Groupe de réflexion». So kam es, dass im ständerätlichen Bericht vom März 2002 die Variante «Assoziation/Rahmenabkommen» Eingang fand. «Semantisch war das Modell allerdings nicht gefestigt», schreibt Felix E. Müller.91 Der Kerngedanke bestand indessen darin, «alle bilateralen Abkommen unter dem Dach eines Rahmenabkommens zu bündeln».
Die Idee fand im Ständerat einigen Anklang. Der spätere freisinnige Bundesrat Hans-Rudolf Merz etwa bezeichnete sie in der Debatte vom 13. Juni 2002 als «mögliche Option, die wir aktiv prüfen sollten». Auch der Urner Christdemokrat Hansheiri Inderkum strich die erstmalige Erwähnung dieser Variante positiv hervor und wies darauf hin, wie wichtig es sei, dass ein solches Abkommen «auch einen institutionellen Mechanismus enthält». Die Genfer Sozialdemokratin Christiane Brunner hingegen meinte, ein solches Abkommen sei «total unrealistisch» und hielt am Ziel eines EU-Beitritts fest. Der damalige Aussenminister Joseph Deiss wiederum verlor in seinem Votum kein Wort über die neue Option.92
Danach schlief die Debatte um das Rahmenabkommen wieder ein. Der Bundesrat handelte die Bilateralen II aus, die Diskussionen drehten sich nun um «Schengen» und «Dublin» und den Schutz des Bankgeheimnisses (siehe S. 104). Eine «vertiefte Analyse der Wünschbarkeit und Machbarkeit eines solchen Ansatzes [eines Rahmenvertrags] wird der Bundesrat anlässlich des Abschlusses der Bilateralen II vornehmen», antwortete die Landesregierung auf einen entsprechenden Vorstoss aus dem Parlament.93
Und tatsächlich: Zwei Tage nach der Abstimmung über die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die zehn neuen EU-Staaten und ein Vierteljahr nach dem Ja des Volkes zu «Schengen» und «Dublin» besuchte Aussenministerin Micheline Calmy-Rey am 27. September 2005 die EU-Aussenkommissarin Benita Ferrero-Waldner in Strassburg und sprach sie auf das Rahmenabkommen an. Die EU scheine recht empfänglich zu sein für diese Idee, berichtete Calmy-Rey später im Ständerat.94 Überhaupt war Calmy-Rey in jener Phase die Anwältin des Rahmenabkommens schlechthin. Die machtbewusste Genfer Bundesrätin erblickte darin das geeignete Mittel, um in der Landesregierung die Poleposition in der Europapolitik zu erlangen. Ein Rahmenabkommen, so ihre Haltung, würde es ihr erlauben, die über die Departemente verstreuten Einzelteile der Europapolitik unter ihre Kontrolle zu bringen. Ihren europäischen Amtskollegen würde sie auf diese Weise endlich auf Augenhöhe begegnen können.
Unterdessen entwickelte der Thurgauer CVP-Ständerat Philipp Stähelin parlamentarische Aktivitäten. Er war zuvor kaum als Aussen- oder Europapolitiker in Erscheinung getreten. Doch am 5. Oktober 2005 bat er den Bundesrat mit einem Postulat um einen Bericht über den «Stellenwert eines Rahmenvertrages zwischen der Schweiz und der EU». «Mit einem Dacherlass», so schrieb Stähelin in der Begründung, «welcher in erster Linie Fragen der Prozedur beinhaltet, würde eine wichtige und nötige Ergänzung zu den heutigen einzelnen Verhandlungsrunden über einzelne Geschäfte geschaffen. Ein grosser Vorteil wäre, dass die einzelnen Vertragswerke von prozeduralen Regeln entlastet würden. Damit würden auch nicht mehr laufend neue Ansätze in die Verhandlungen aufgenommen, und die Fortsetzung und Institutionalisierung der Gespräche mit der EU wären geregelt. Inhaltliche Anliegen zwischen der Schweiz und der EU würden wie bisher diskutiert und wären in diesem Rahmenvertrag nicht enthalten.»95 Zudem habe er mit seinem Vorstoss für ein Rahmenabkommen den «wachsenden Trend zu departementalen Verhandlungen mit Brüssel» brechen wollen, sagte Stähelin später.96 Der Bundesrat empfahl das Postulat zur Annahme, der Ständerat folgte ihm am 15. Dezember 2005.
Eine interessante und im Rückblick geradezu hellseherische Äusserung kam in der Debatte vom freisinnigen Schaffhauser Ständerat Peter Briner. Die EU werde darauf pochen, sagte er, dass mit einem Rahmenabkommen auch für sie ein Mehrwert entstehe. «Ich denke, dass sie versuchen wird, von uns vermehrt die Übernahme des EU-Rechtes zu fordern, dass ein Rahmenvertrag für sie allenfalls eine allgemeine Guillotineklausel enthalten müsste.»97
Das Vorhaben kam in der Folge nicht recht vom Fleck, Ständeratsdebatte hin oder her. Die «Prüfung der Wünschbarkeit und Machbarkeit eines Rahmenabkommens» wurde zwar in die Legislaturplanung 2007 – 2011 aufgenommen, aber das war nicht mehr als eine lendenlahme Zusage des Bundesrates an die Adresse des Parlaments. Zwei Mal – im aussenpolitischen Bericht von 2009 und in zwei Antworten auf parlamentarische Vorstösse – gab die Regierung zudem Einblick in die «entsprechenden Überlegungen». Aber in keinem der Dokumente äusserte sich der Bundesrat konkret zur Frage, ob denn Verhandlungen über ein Rahmenabkommen aus seiner Sicht überhaupt zweckmässig wären.98 Etwas entschlossener waren die Kantone: Sie verlangten im Juni 2010 die Aushandlung eines Rahmenabkommens.
So blieb die Auseinandersetzung mit dem Thema bis zum Europabericht vom September 2010 lau bis mager. Von Begeisterung konnte keine Rede sein. Das hatte mit den völlig unterschiedlichen Sichtweisen zu tun, die in der Schweiz über die weitere Entwicklung der Europapolitik vorherrschten. Im Bun...