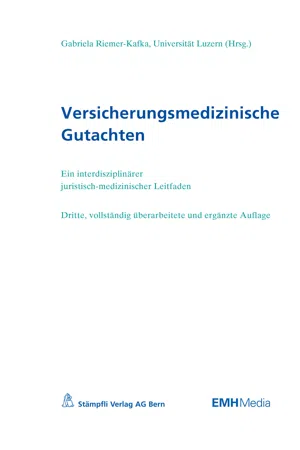C. Begriffe
I. Aggravation (inkl. Simulation)
Aggravation (lateinisch «ad-gravare», schwerer machen, verschlimmern) beschreibt die Verschlechterung eines Zustandes über die Zeit. In der Regel meint der Begriff in medizinischem Kontext, dass sich eine Erkrankung oder ein Krankheitssymptom verschlimmert hat. Im Kontext der Begutachtung wird damit demgegenüber die übertriebene, schwerere Darstellung, die dramatische Ausgestaltung einer Erkrankung oder eines Symptoms bezeichnet.
Simulation (lateinisch «simul», ähnlich, «simulatio», ähnlich machen, Nachahmung, Vortäuschung) bezeichnet die Vorgehensweise zur Analyse von Systemen, häufig in Form einer Modellbildung, die getestet werden kann. In der Begutachtung wird darunter auch das Übertreiben oder Erfinden einer Erkrankung bzw. von Symptomen und/oder Beschwerden verstanden im Gegensatz zur Dissimulation als deren Verbergen oder Bagatellisieren.
Die Begriffe Simulation und Aggravation werden im Sozialversicherungsbereich viel verwendet. Trotz einiger Definitionsversuche sind die Begriffe nicht klar definiert. Sie stammen aus der Anfangszeit der Begutachtung. In der Begutachtung geht es nicht nur darum, übertreibende Ausgestaltung von Beschwerden zu entdecken, sondern auch um die Rahmenbedingungen der Untersuchungssituation bei der Erhebung und Auswertung der Daten ins Zentrum zu stellen. Grundsätzlich sind Exploranden ebenso wie Informanten im ethnographischen Feld intelligente Teilnehmer der Situation. Sie gehen nicht interesselos oder neutral in die Begutachtungssituation. Sie haben ein Anliegen. Die Klärung des Anliegens, soweit dies im Einzelfall nötig ist, und regelhaft das Inbetrachtziehen dieses Anliegens sind Teil der gutachterlichen Aufgabe. In der Regel kommen Exploranden mit dem Anliegen, ihre gesundheitlichen Defizite nachzuweisen, beispielsweise in einem Rentenverfahren. Andere rechtliche Rahmenbedingungen führen dazu, dass ein Explorand seine Unversehrtheit, seine Leistungsfähigkeit bestätigt haben möchte, z.B. wenn es um die Tauglichkeit für eine bestimmte berufliche Tätigkeit geht (z.B. Piloten, Polizistinnen, Physiotherapeutinnen), um den Erhalt der Fahrtauglichkeit etc. Unter solchen Voraussetzungen wird eher die Gefahr bestehen, dass eine Erkrankung oder ein Symptom dissimuliert wird.
Weil Beschwerden und Symptome nicht rein, wahr, authentisch, unmittelbar geschildert und/oder gezeigt werden im Gegensatz zu falsch, unwahr oder erfunden, sondern von mitdenkenden Exploranden vorgetragen und/oder präsentiert werden, genügt es nicht, zum üblichen diagnostischen Vorgehen zusätzliche Tests einzuführen, wie die sogenannte Symptom- und Beschwerdevalidierungsverfahren. Vielmehr geht es in der Begutachtung um grundsätzliche Fragen zu Aussagemöglichkeiten aufgrund medizinischer und psychologischer Diagnostik: Welche Methoden stehen zur Verfügung? Wie werden sie korrekterweise eingesetzt und mit welchem Ziel? Was lässt sich mit ihrer Hilfe aussagen? Dazu gehört auch das Wissen darum, dass diese Methoden immer einen theoretischen Bezug haben und nicht von Natur aus gegeben sind.
Bestandteil vieler Testverfahren und vor allem von Testbatterien, wie sie im Rahmen der Begutachtung zum Einsatz kommen, sind Kontrollskalen. Hier handelt es sich also nicht um Tests bzw. Fragebögen, die ausschliesslich der Symptomvalidierung dienen, sondern um in die jeweiligen Verfahren implementierten Fragen, mit deren Hilfe Antworttendenzen geprüft werden können.
Bei Zweifeln an der Leistungsbereitschaft können mit Symptomvalidierungsverfahren allein Aggravation oder Simulation nicht objektiv nachgewiesen werden. Ergebnisse bei Alternativwahlverfahren, die unter der Ratewahrscheinlichkeit liegen, erlauben für sich allein genommen lediglich die Schlussfolgerung, dass das Testergebnis nicht verwertbar ist. Das heisst, dass auch Ergebnisse, die mit Hilfe anderer Testverfahren in derselben Untersuchung gewonnen wurden, auf ihre Verwertbarkeit hin kritisch überprüft werden müssen. Im Weiteren gilt es zu prüfen, ob die Ergebnisse Ausdruck einer psychischen Störung, beispielsweise einer Persönlichkeitsstörung, sein könnten. Alle Ergebnisse von Symptomvalidierungsverfahren, die im Grenzbereich um die Erwartungswerte liegen, können durch verschiedene Faktoren verursacht sein: Neben verschiedenen Antworttendenzen bzw. Antwortverzerrungen kommen verschiedene psychische Störungen, aber auch Nebenwirkungen psychotroper Substanzen in Frage. Auch können Ergebnisse aufgrund vorgetäuschter Hirnfunktionsstörungen allein aufgrund des eingesetzten Symptom- bzw. Beschwerdevalidierungsverfahrens nicht von solchen beispielsweise bei einer Konversionsstörung unterschieden werden (also bewusste von unbewussten Prozessen). Berücksichtigt werden müssen auch situative Faktoren, vor allem die Interaktion zwischen Untersuchenden und Exploranden.
Weiter von Aggravation und Simulation zu sprechen, ist aus all diesen Gründen nicht zu empfehlen. Fassbarer sind konkrete Beschreibungen von Problemen, Beobachtungen, Befunden und Interpretationen, z.B. Betonungen, Übertreibungen in bestimmen Zusammenhängen, bestimmte Antworttendenzen oder nicht zur Übereinstimmung zu bringende Diskrepanzen.
II. Arbeitsunfähigkeit
1. Im Allgemeinen
Die Arbeitsunfähigkeit ist ein juristischer Begriff. Er hat aber insofern auch eine tatsächliche Komponente (und ist daher für das Gericht eine Tatfrage), als es um die medizinische Feststellung des Gesundheitsschadens, seiner Ursache, der Diagnose, der Prognose und der aufgrund des Leidens noch vorhandenen Ressourcen geht (BGE 132 V 393, E. 3.2, S. 398). Als Anknüpfung bzw. Voraussetzung für die Erbringung von Versicherungsleistungen ist die krankheits- oder unfallbedingte (natürliche Kausalität) Leistungseinbusse am bisherigen Arbeitsplatz oder im bisherigen Aufgabenbereich, also die Arbeitsunfähigkeit, insbesondere Bedingung für einen Anspruch auf Taggelder der Versicherung. Des Weiteren ist die Arbeitsunfähigkeit im Zusammenhang mit dem Eintritt der Invalidität von Bedeutung, da der Zeitpunkt des Eintritts von Arbeitsunfähigkeit im Sinne einer funktionellen Leistungseinbusse ausschlaggebend ist für
– den Beginn der einjährigen Wartezeit in der Invalidenversicherung (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG: durchschnittlich 40% Arbeitsunfähigkeit während eines Jahres) und
– die Anknüpfung an die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung in der beruflichen Vorsorge (Art. 23 BVG).
Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit findet sich sowohl in der Sozialversicherung als auch in der Privatversicherung. Während er für die Sozialversicherung gesetzlich festgehalten ist (Art. 6 ATSG), kann er im Bereich der Privatversicherung durch die am Versicherungsverhältnis beteiligten Vertragsparteien (konkret aber durch die AVB des Versicherers vorgegeben) aufgrund ihrer Privatautonomie abweichend vom Sozialversicherungsrechtlichen definiert werden. Dies kann zum unbefriedigenden Resultat führen, dass der nämliche Gesundheitsschaden bei der Sozialversicherung keine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat, während die Privatversicherung Taggeldleistungen aufgrund eines grosszügigeren Begriffs gewährt (oder umgekehrt).
2. Aus medizinischer Sicht
Arbeitsunfähigkeit ist durch den Arzt festzustellen, gleichwohl sind Arbeitsfähigkeit wie Arbeitsunfähigkeit keine eigentlichen medizinischen Begriffe. Der Arzt muss also in der Lage sein, die als Folge eines bestimmten krankhaften Befundes verbliebenen Leistungsmöglichkeiten und deren Einschränkungen abzuschätzen. Es geht dabei im Sinne einer Tatsachenfeststellung um die Beschreibung vorhandener Defizite und funktionaler Ressourcen. Jeder Schätzwert hat ein mehr oder weniger breites Vertrauensintervall. Die Breite dieses Vertrauensintervalls hängt ab von der Genauigkeit der von Auftraggeber und Explorand gelieferten und vom Gutachter dazu erhobenen Daten. Damit die juristischen Folgen daran geknüpft werden können, muss eine retrospektive und prospektive Beurteilung erfolgen.
Die Einschränkung der Arbeitsfähigkeit ergibt sich keineswegs zwingend aus der Diagnose allein. Bei psychischen Beeinträchtigungen verlangt die Gerichtspraxis sogar ausdrücklich, dass unabhängig von der fachärztlich festgestellten psychischen Krankheit und der gestellten Diagnose im Einzelfall eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit ausgewiesen und in ihrem Ausmass bestimmt sein muss. Folgende Kriterien sind für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit von Relevanz:
– die subjektive Einschätzung der Arbeitsfähigkeit (unter Berücksichtigung nicht nur des Inhalts, sondern auch der Art der Darstellung)
– der aktuelle Tagesablauf mit den derzeitigen Tätigkeiten
– Fremdeinschätzungen von relevanten Personen (Arbeitgeber, Kollegen, Hausarzt, beteiligte Fachärzte, Angehörige, sonstige nahestehende Personen)
– Ergebnisse von Leistungserfassungen und Berufsabklärung
Während der Erhebung all dieser Kriterien nimmt der Gutachter, ohne weiter darüber nachzudenken, eine Globaleinschätzung vor. Diese darf er nicht unbesehen übernehmen. Vielmehr geht es darum, sich diese Einschätzung bewusstzumachen, sie zu überprüfen und für die Adressaten darzulegen:
– Auf welche Kriterien bezieht sich die Einschätzung? Was ist über die einzelnen Kriterien bekannt?
– Wie aussagekräftig sind die herangezogenen Kriterien?
– Wie verlässlich ist die Beurteilung? (Festsetzungen von Prozentzahlen ohne Darlegung ihrer Herkunft sind nicht aussagekräftig.)
Die Erwartungen an die neben der Arbeit verbleibenden Kapazitäten für Haushalt, Familie und Freizeit sind wesentlich geprägt durch kulturelle und gesellschaftliche Vorstellungen. Der Gutachter sollte deshalb das persönliche Umfeld des Exploranden, die Entwicklung und den Verlauf der Einschränkungen ebenso mitberücksichtigen wie dessen Motivation.
Die retrospektive Beurteilung erfordert einerseits eine genaue Arbeitsplatz- bzw. Aufgabenbereichsbeschreibung durch den Arbeitgeber und die versicherte Person selbst und anderseits eine gewissenhafte Einschätzung der verbleibenden Fähigkeiten durch den Arzt. Der Umfang der Einschränkung soll in Prozenten der bisher erbrachten Leistung angegeben werden. Dabei handelt es sich aber um eine Schätzung. Differenziert werden sollen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit, welche durch Faktoren wie Alter, Ausbildung, Sprache etc. oder psychosoziale bzw. soziokulturelle Einflüsse (sog. invaliditätsfremde Faktoren) bedingt sind, g...