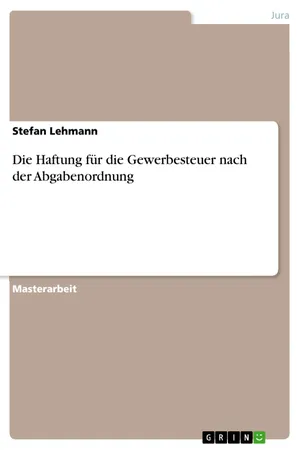
- 80 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Die Haftung für die Gewerbesteuer nach der Abgabenordnung
Über dieses Buch
Masterarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Jura - Steuerrecht, Note: 1, 3, Hamburger Fern-Hochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Abstract beschreibt eine Masterarbeit zur Haftung für die Gewerbesteuer. Es wird untersucht, wie Gemeinden nach der Abgabenordnung die Gewerbesteuer gegenüber Dritten als Haftungsschuld festsetzen können, wenn diese nicht gezahlt wird. Wenn die Gewerbesteuer der Einzelgewerbetreibenden, Personen- und Kapitalgesellschaften nicht gezahlt wird, kommt es zu Defiziten in den gemeindlichen Haushalten. Dies hat in der heutigen Zeit, da Investitionen in die Zukunft geplant werden, besondere Auswirkungen, denen mithilfe der gesetzlichen Möglichkeiten abgeholfen werden soll. Wie eingangs zitiert, ist das Steuerrecht kompliziert. Die Haftung für die Gewerbesteuer ist ein Nischenthema, welches die Literatur nur beiläufig behandelt. Im Rahmen dieser Masterthese soll daher untersucht werden, wie es den Gemeinden möglich ist, nach der Abgabenordnung die Gewerbesteuer gegenüber Dritten als Haftungsschuld festzusetzen. Die Untersuchung erfolgt anhand von Gerichtsurteilen, Kommentaren und Handbüchern. Um das Thema abzurunden, werden geeignete Aufsätze in diese Untersuchung mit einfließen.Im zweiten Kapitel wird die Entstehung der Gewerbesteuer, einschließlich Steuergegenstand, Steuerschuldner und Steuergläubiger, sowie die Haftung über verschiedene Gesellschaftsformen hinaus erläutert. Das dritte Kapitel analysiert die Regelungen der Abgabenordnung zur Inanspruchnahme Dritter. Kapitel vier bietet eine Übersicht über Rechtsbehelfe gegen Steuer- und Haftungsbescheide. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen. Der Schwerpunkt liegt auf den zahlreichen Haftungsgrundlagen und deren Entwicklung, insbesondere im Kontext der Gewerbesteuer-Richtlinien 2009. Die Untersuchung ist interdisziplinär angelegt.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsübersicht I
- Abbildungsverzeichnis IV
- 1. Einführung 1
- 1.1 Die Gewerbesteuer als gemeindliche Einnahmequelle 1
- 1.2 Vergleich von Steuerschätzung und Forderungsausfall 2
- 1.3 Forschungsfrage und Untersuchungsgang 2
- 2. Die Gewerbesteuer 4
- 2.1 Steuergegenstand und Steuerschuldner 4
- 2.1.1 Die Personengesellschaft 6
- 2.1.2 Die Kapitalgesellschaft 7
- 2.2 Steuergläubiger 8
- 2.3 Zweigeteilter Verwaltungsweg 9
- 2.3.1 Verfahren des Gewerbesteuermessbescheids 9
- 2.3.2 Verfahren des Gewerbesteuerbescheids 10
- 2.4 Bekanntgabe gegenüber dem Steuerpflichtigen 10
- 2.5 Problemfelder der Bekanntgabe 11
- 2.5.1 Insolvenz 11
- 2.5.2 Gesellschaft in Liquidation 13
- 2.5.3 Gelöschte Gesellschaften 13
- 2.6 Fälligkeit 14
- 2.7 Zwischenfazit 15
- 3. Die Haftung für Steuerschulden 16
- 3.1 Der Haftungsbescheid nach § 191 AO 16
- 3.1.1 Verfahrensablauf: Ermittlungsmöglichkeiten, Zuständigkeit und Anhörung 17
- 3.1.2 Akzessorietät der Haftung 18
- 3.1.3 Subsidiarität der Haftung 19
- 3.1.4 Bestimmtheit, Form und Inhalt 20
- 3.1.4.1 Entschließungsermessen 21
- 3.1.4.2 Auswahlermessen 21
- 3.1.5 Verjährungsfristen 21
- 3.1.5.1 Festsetzungsverjährung 22
- 3.1.5.2 Zahlungsverjährung 22
- 3.1.5.3 Verfahrensablauf 22
- 3.1.6 Insolvenz 23
- 3.2 Originäre Haftungstatbestände nach der AO 24
- 3.2.1 Haftung der Vertreter 24
- 3.2.1.1 Allgemein 24
- 3.2.1.2 Maßgeblicher Personenkreis 24
- 3.2.1.3 Pflichtverletzung 26
- 3.2.1.4 Eingetretener Haftungsschaden 26
- 3.2.1.5 Ursächlichkeit der Pflichtverletzung 26
- 3.2.1.6 Verschulden 27
- 3.2.1.7 Haftungsumfang 29
- 3.2.1.8 Verjährung 29
- 3.2.1.9 Haftungsinanspruchnahme 30
- 3.2.2 Haftung des Steuerhinterziehers 30
- 3.2.2.1 Haftungsschuldner 30
- 3.2.2.2 Haftungstatbestand 32
- 3.2.2.3 Haftungsumfang 32
- 3.2.2.4 Verjährung 33
- 3.2.2.5 Haftungsinanspruchnahme 34
- 3.2.3 Haftung bei der Organschaft 34
- 3.2.3.1 Begriff der Organschaft 34
- 3.2.3.2 Haftungsschuldner 34
- 3.2.3.3 Umfang 35
- 3.2.3.4 Verjährung 35
- 3.2.3.5 Haftungsinanspruchnahme 36
- 3.2.4 Haftung des Eigentümers von Gegenständen 36
- 3.2.4.1 Allgemein 36
- 3.2.4.2 Unternehmen 36
- 3.2.4.3 Gegenstand 37
- 3.2.4.4 Haftungskreis 37
- 3.2.4.5 Umfang der Haftung 38
- 3.2.4.6 Verjährung 39
- 3.2.4.7 Geltendmachung mit Haftungsbescheid 39
- 3.2.5 Haftung des Betriebsübernehmers 40
- 3.2.5.1 Allgemein 40
- 3.2.5.2 Voraussetzungen 40
- 3.2.5.3 Umfang 41
- 3.2.5.4 Verjährung 42
- 3.2.5.5 Haftungsinanspruchnahme 42
- 3.2.6 Zwischenfazit 43
- 3.3 Zivilrechtliche Haftungsnormen i. V. m. § 191 AO 43
- 3.3.1 § 25 HGB 44
- 3.3.1.1 Allgemein 44
- 3.3.1.2 Haftungsvoraussetzungen 44
- 3.3.1.3 Haftungsumfang 45
- 3.3.1.4 Haftungsausschluss und Alternative 45
- 3.3.1.5 Ausschlussfrist und Verjährung 45
- 3.3.2 Haftung der Gesellschafter der Personengesellschaft 46
- 3.3.2.1 Haftung der Gesellschafter der OHG 47
- 3.3.2.2 Haftung der Gesellschafter der KG 48
- 3.3.2.3 Haftung der Gesellschafter der GbR 49
- 3.3.2.4 Verjährung für die Haftung nach Zivilrecht 51
- 4. Rechtsbehelfsmöglichkeiten 53
- 5. Fazit 55
- Abkürzungsverzeichnis 60
- Entscheidungsverzeichnis 62
- Literaturverzeichnis 66
- Abbildungsverzeichnis
- Abb. 1: Steuerspirale: Schätzung für 2018 1
- Abb. 2: Schema Haftung nach § 191 AO 23
- 1. Einführung
- Der Ausspruch von Heinrich List, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtshofs – „Das Steuerrecht ist so kompliziert und undurchschaubar wie Nebel mit Sichtweite unter 50 [Meter].“0F – hat noch immer Bestand. Auch gibt es in der Bundesrepubl...
- [Hinweis der Redaktion: Diese Abbildung musste aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden.]
- Abb. 1: Steuerspirale: Schätzung für 20181F
- Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden belaufen sich nach Schätzungen für 2018 (Stand: Mai 2018) auf rund 772.090 Millionen Euro. Steuereinnahmen werden aufgrund des vorliegenden Steuerrechts ermöglicht. Dieses gehört als Verwaltungsrecht...
- 1.1 Die Gewerbesteuer als gemeindliche Einnahmequelle
- Das Grundgesetz regelt unter Abschnitt X. „Das Finanzwesen“. Relevant ist hier insbesondere Art. 106 GG. Den Gemeinden steht gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG das Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer zu. Bei der Gewerbesteuer handelt es sich ...
- 1.2 Vergleich von Steuerschätzung und Forderungsausfall
- Die Gewerbesteuer ist eine Belastung für die gewerblichen Unternehmer. Die steuerliche Belastung bei Kapitalgesellschaften beläuft sich auf bis zu 32,98 % und bei Personengesellschaften, aufgrund der Gesamtsteuerbelastung, also Gewerbesteuer, Einkomme...
- In Folge von unterschiedlichen Umständen kann es zur Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen kommen. Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2018 gab es insgesamt 92.421 Insolvenzverfahren. Betroffen waren 6.271 Einzelunternehmen, 1.154 Personengesellschaften,...
- 1.3 Forschungsfrage und Untersuchungsgang
- Wenn die Gewerbesteuer der Einzelgewerbetreibenden, Personen- und Kapitalgesellschaften nicht gezahlt wird, kommt es zu Defiziten in den gemeindlichen Haushalten. Dies hat in der heutigen Zeit, da Investitionen in die Zukunft geplant werden, besondere...
- Um ein Verständnis für die Forderungsart zu entwickeln, wird das zweite Kapitel von der Entstehung der Gewerbesteuer als Forderung für den Steuerpflichtigen handeln. Hierzu gehört die Untersuchung, was Steuergegenstand, wer Steuerschuldner und Steuerg...
- Die Abgabenordnung enthält Regelungen, um Dritte in die Haftung zu nehmen. Diese Regelungen und das hierzu durchgeführte Verwaltungsverfahren der Gemeinden werden im 3. Kapitel untersucht und analysiert. Kapitel 4 behandelt in einer kurzen Übersicht d...
- Aufgrund von „[...] etwa vierzig verschiedenen materiellen Haftungsgrundlagen […]“10F und darüber hinaus insbesondere durch die Rechtsentwicklung, liegt hier der Schwerpunkt in der Betrachtung der Haftungsmöglichkeiten für die Gewerbesteuer nach der ...
- Zur besseren Lesbarkeit wird bei der personenbezogenen Bezeichnung generell nur die im Deutschen übliche männliche Form angeführt, zum Beispiel der Geschäftsführer.
- 2. Die Gewerbesteuer
- Obwohl das Bundesverfassungsgericht die Gewerbesteuer als verfassungsrechtlich gerechtfertigt bestätigt hat, bleibt sie umstritten.11F Sie legitimiert sich durch das Grundgesetz und durch das Gewerbesteuergesetz. Grundsätzlich handelt es sich bei der...
- Das Verfahren obliegt gänzlich der öffentlichen Verwaltung, wobei es sich sowohl unter Anwendung der Abgabenordnung als auch des Gewerbesteuergesetzes in zwei Stufen vollzieht.14F Bevor auf das Verwaltungsverfahren näher eingegangen wird, ist zu klär...
- 2.1 Steuergegenstand und Steuerschuldner
- Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer i. S. v. § 3 Abs. 2 AO und wird als Objekt-steuer an den Steuergegenstand und nicht an eine Person geknüpft.15F Eine Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse, insbesondere Familienstand, Alter, Kinder oder ...
- Wie im allgemeinen Steuerrecht unterscheidet auch das Gewerbesteuerrecht zwischen sachlicher und persönlicher Steuerpflicht (vgl. § 184 Abs. 1 Satz 2 AO), wobei sich die sachliche Steuerpflicht auf das Objekt selbst, also das gewerbliche Unternehmen b...
- Die persönliche Steuerpflicht ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Satz 1 GewStG. Somit ist Steuerschuldner der Unternehmer. Als Unternehmer i. S. v. § 5 GewStG gilt der, für dessen Rechnung das Gewerbe betrieben wird. Soweit der Gewerbebetrieb durch eine Perso...
- Das Zivilrecht kennt sowohl die natürlichen und juristischen Personen als auch die Personengesellschaften. Das Steuerrecht dagegen kennt nur die Unterscheidung nach dem Einkommensteuergesetz und dem Körperschaftsteuergesetz.20F Daher ist für den Steu...
- Die Körperschaften haben im Steuerrecht gegenüber den Personengesellschaften eine eigene Rechtssubjektqualität. Die Besteuerung der Personengesellschaften erfolgt über die Einkünfte der Gesellschaft im Verfahren nach §§ 179, 180 AO über die einheitlic...
- Die Gesellschaftsformen und deren Gründung sowie Organisation sind daher sowohl in der Betrachtung für den Steuerschuldner als auch für den weitergehenden Untersuchungsgang von Bedeutung.
- 2.1.1 Die Personengesellschaft
- Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, auch BGB-Gesellschaft oder GbR genannt, hat eine große praktische Bedeutung und Verbreitung, weil sie gemäß § 705 BGB immer entsteht, wenn sich eine unbestimmte Anzahl an Personen, mindestens aber zwei, für einen ...
- § 105 Abs. 1 HGB definiert die OHG. Sie ist eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet und bei der bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern besch...
- Eine weitere Form ist die KG (§ 161 HGB). Sie kann verschiedene Erscheinungsformen haben, beispielsweise als „gewerblich tätige KG, Familien-KG, doppelstöckige KG“31F . Die Gründung erfolgt grundsätzlich formfrei, jedoch ist aus praktischen Erwägungen...
- Die GmbH & Co. KG ist eine sehr beliebte Rechtsform, die im „Jahr 2015 141[.]666“36F Mal in Deutschland existierte. Durch sie werden die Vorteile des Zivilrechts und die der steuerlichen Behandlung von Personengesellschaften sehr gut kombiniert.37F ...
- 2.1.2 Die Kapitalgesellschaft
- Für die GmbH als Kapitalgesellschaft ergeben sich die gesetzlichen Regelungen aus dem GmbHG. Sie ist besonders beliebt, da die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen begrenzt ist.39F Die GmbH ist eine juristische Person gemäß § 13 Abs. 1 GmbHG und kan...
- Die gesetzlichen Grundlagen für die AG ergeben sich aus dem AktG. Ihre Gründung erfolgt über die notarielle Gründungsurkunde, welche durch Satzung gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 AktG festgestellt wird, die Erbringung des Mindestnennbetrags in Höhe von 50.000 ...
- 2.2 Steuergläubiger
- Gemäß § 1 GewStG und R 1.1 GewStR erheben die Gemeinden die Gewerbesteuer als Gemeindesteuer. Eine Definition der Gemeinde enthält das Gewerbesteuergesetz nicht, jedoch besteht eine Verknüpfung aus Art. 28 Abs. 2 GG, also dem kommunalen Selbstverwaltu...
- Aus der Erhebung erfolgt die Vereinnahmung. Wenn die Steuer nicht gezahlt wird, erfolgt die Zwangsvollstreckung gegen den Steuerschuldner.
- 2.3 Zweigeteilter Verwaltungsweg
- Das Verwaltungsverfahren für die Gewerbesteuer unterscheidet sich von anderen Steuerarten, da es in zwei Stufen erfolgt.48F Diese werden nachfolgend untersucht.
- 2.3.1 Verfahren des Gewerbesteuermessbescheids
- Der Gewerbesteuermessbetrag (§ 11 Satz 1 GewStG, § 184 Abs. 1 Satz 1 AO) wird in der ersten Stufe vom Finanzamt, das sachlich (§ 16 AO) und örtlich (§ 22 Abs. 1 Satz 1 AO) zuständig ist, festgesetzt. Es kann die Besteuerungsgrundlagen gemäß § 162 AO s...
- Das Finanzamt übermittelt den Messbescheid sodann an die zuständige Gemeinde.51F Aus dem BFH-Urteil vom 19.11.2003 I R 88/02 lässt sich festhalten, dass die Mitteilung, welche Gemeinde hebeberechtigt ist, einer verwaltungsinternen Maßnahme gleichkomm...
- Im Ergebnis ist die Gemeinde gemäß §§ 184 Abs. 1 Satz 4, 182 Abs. 1 i. V. m. § 171 Abs. 10 AO an den Messbescheid des Finanzamtes gebunden und hat diesen so zu vollziehen. „Bindungswirkung bedeutet, dass die in einem wirksamen Feststellungsbescheid ge...
- 2.3.2 Verfahren des Gewerbesteuerbescheids
- Die zweite Stufe erfolgt bei der Gemeinde. Durch den Gewerbesteuermessbescheid werden die Gemeinden verpflichtet, auf dessen Grundlage einen Gewerbesteuerbescheid als Folgebescheid zu erlassen.55F Durch R 1.2 GewStR wird klargestellt, wie sich die Au...
- 2.4 Bekanntgabe gegenüber dem Steuerpflichtigen
- Die Festsetzung der Gewerbesteuer erfolgt durch den Verwaltungsakt gemäß § 155 i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 3 und 4 AO und wird dem Steuerschuldner nach § 122 Abs. 1 AO bekannt gegeben.59F
- Die Bekanntgabe erfolgt gemäß § 122 Abs. 2 AO als schriftlicher Verwaltungsakt i. S. d. § 118 AO, der durch die Post übermittelt wird und nach § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO bei einer Übermittlung im Inland am dritten Tag nach Aufgabe zur Post oder nach Nr. 2 ...
- Es gilt, den Inhaltsadressat, also die Person, an die sich der Bescheid richtet, den Bekanntgabeadressat, an den der Steuerbescheid bekannt gegeben werden soll, und den Empfänger, also an wen der Steuerbescheid zu übermitteln ist, voneinander zu unter...
- 2.5 Problemfelder der Bekanntgabe
- Die Bekanntgabe und die damit verbundene Wirksamkeit des Gewerbesteuerbescheides ist in der Praxis jedoch insbesondere bei Firmen in der Insolvenz, der Liquidation oder bei gelöschten Firmen problematisch. Dies wird im Folgenden untersucht. Die Ausfüh...
- 2.5.1 Insolvenz
- Für die Bekanntgabe im Insolvenzverfahren gelten besondere Regeln. Vorab wird kurz auf das Insolvenzverfahren eingegangen.
- Das Insolvenzverfahren beginnt mit dem Eröffnungsantrag nach § 13 InsO. Dieser kann gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 InsO sowohl vom Gläubiger als auch vom Schuldner gestellt werden. Juristische Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit können den...
- Bei der GbR und der OHG hat jeder persönlich haftende Gesellschafter, bei der KG der oder die Kommanditisten und bei der GmbH & Co. KG entweder sämtliche Geschäftsführer der Komplementär-GmbH oder einzelne – wobei diese dann den Grund für die Eröffnun...
- Die konkrete Antragspflicht bei juristischen Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit ergibt sich aus § 15a InsO. Der Antrag ist nach § 15a Abs. 1 Satz 1 InsO zu stellen, wenn Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder Überschuldung (§ 19 InsO)...
- Je nach Entscheidung über den Antrag hat dies Folgen für die Bekanntgabe von Gewerbesteuerbescheiden. Soweit dem Antrag entsprochen wird, dürfen hinsichtlich der Insolvenzforderungen grundsätzlich keine Bescheide über die Festsetzung von Ansprüchen au...
- Bei den Gesellschaften ist ferner zu beachten, dass die Insolvenz zu deren Auflösung führt. So wird die GbR durch das Insolvenzverfahren nach § 728 Abs. 1 Satz 1 BGB, die OHG nach § 131 Abs. 1 Nr. 3 HGB, mangels Masse nach § 131 Abs. 2 Nr. 1 HGB und d...
- Durch die Eröffnung der Insolvenz wird die GmbH nach § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelöst. Gleiches gilt nach § 60 Abs. 1 Nr. 5 GmbHG, wenn der Antrag mangels Masse abgewiesen wird. Die GmbH ist ferner nach § 60 Abs. 1 Nr. 7 GmbHG aufgelöst, wenn sie weg...
- Die Auflösung der Personen- sowie der Kapitalgesellschaft ist im Handelsregister bekanntzumachen (§ 143 HGB, § 65 GmbHG, § 263 AktG).
- 2.5.2 Gesellschaft in Liquidation
- Durch die Liquidation – gekennzeichnet durch die Erweiterung des Firmennamens um i. L. – wird angezeigt, dass sich die Gesellschaft in der Auflösung befindet.70F Nunmehr stellt sich die Frage, wie hier der Gewerbesteuerbescheid wirksam bekannt gegebe...
- Die GbR i. L. kann weiterhin als Inhaltsadressat verwendet werden, jedoch erfolgt die Bekanntgabe, unter Anwendung von § 34 Abs. 2 AO, an einen der früheren Gesellschafter als Bekanntgabeadressat.71F
- Die OHG und die KG sowie die GmbH & Co. KG werden nach dem HGB liquidiert. Damit findet gemäß § 145 Abs. 1 HGB nach der Auflösung die Liquidation statt. Die Zustellung des Gewerbesteuerbescheides hat somit als Inhaltsadressat die Personengesellschaft,...
- Die Bekanntgabe des Gewerbesteuerbescheides an eine juristische Person erfolgt grundsätzlich an die Geschäftsanschrift ohne Angabe des gesetzlichen Vertreters74F und bei der Liquidation unter dem Zusatz z. H. des Liquidators.75F
- 2.5.3 Gelöschte Gesellschaften
- Durch die Liquidation wird die Gesellschaft beendet und im Nachgang im Handelsregister gelöscht. Das Finanzamt kann die Eintragung der juristischen Person beim Registergericht beantragen, was eine Nachtragsliquidation zur Folge hat, § 23a Abs. 2 Nr. 3...
- Für die Gemeinden würde dies grundsätzlich einen erheblichen Ermittlungsaufwand bedeuten, der jedoch geringgehalten werden kann. Da das Besteuerungsverfahren bei der Gewerbesteuer, wie bereits dargestellt, zweigliedrig ist, ist sowohl das Finanzamt al...
- Im Vergleich zu der aufwendigen Bekanntgabe von Steuerbescheiden an juristische Personen, ist die Bekanntgabe bei gelöschten Personengesellschaften unkompliziert gehalten. Es bedarf keiner Nachtragsliquidation, da die Bekanntgabe des Bescheides auch a...
- Unabhängig hiervon enthält die AEAO eine einfachere Handlungsanweisung. Sie hält diesbezüglich die Bekanntgabe gegenüber den Gesellschaftern für nicht mehr zweckmäßig und empfiehlt die Festsetzung der Forderung durch Haftungsbescheid.80F Wie dies mög...
- 2.6 Fälligkeit
- Für die Fälligkeit der Gewerbesteuer verweist § 220 Abs. 1 AO auf die jeweiligen Einzelsteuergesetze. Nach § 19 Abs. 1 GewStG ist die Vorauszahlung zu einem festen Termin zu entrichten. Die Abschlusszahlung ergibt sich aus § 20 GewStG. Sie berechnet s...
- 2.7 Zwischenfazit
- Als Ergebnis der bisherigen Untersuchung lässt sich festhalten, dass die Gemeinde im Rahmen der Festsetzung lediglich den Gewerbesteuermessbescheid vollzieht. Insbesondere ist sie an den Grundlagenbescheid des Finanzamtes gebunden, unabhängig davon, o...
- Es wurde ersichtlich, dass bei der Bekanntgabe Besonderheiten zu beachten sind. So kann während der Insolvenz kein Bescheid bekannt gegeben, sondern die Forderung lediglich zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Hervorzuheben ist, wie bereits dargest...
- Die Bekanntgabe des Gewerbesteuerbescheides allein ist keine Garantie dafür, dass die Gewerbesteuer auch gezahlt wird. Wie in der Einleitung dargestellt, kann es zu Insolvenzen oder zur schlichten Beendigung von Personen- und Kapitalgesellschaften kom...
- Die Gründe für die Beendigung der Gesellschaft sind in Bezug auf die Steuerrückstände im Ergebnis belanglos. Für die Gemeinde zählt nur, dass die Gewerbesteuer sowie nach Möglichkeit die entstandenen Nebenkosten beglichen werden. Nachfolgend wird unte...
- 3. Die Haftung für Steuerschulden
- Die Finanzbehörden und damit auch die Gemeinden sind aufgrund von § 85 AO verpflichtet, die Steuern gleichmäßig festzusetzen und zu erheben.84F Daher hat die Gemeinde den Messbescheid entsprechend zu vollziehen und den Gewerbesteuerbescheid an den St...
- Die Haftung im Steuerrecht setzt einen materiell-rechtlichen Haftungsanspruch i. S. v. § 37 Abs. 1 AO voraus, also hier die Gewerbesteueransprüche der Gemeinden, kraft Gesetzes nach § 191 Abs. 1 AO oder kraft Vertrages nach § 48 Abs. 2 AO.88F Auf die...
- Vorliegend wird die gesetzliche Haftung näher untersucht. Die Haftung erfolgt dann grundsätzlich in Verbindung mit den in der AO genannten Normen der §§ 69-75 AO oder gemäß § 191 Abs. 4 AO nach Zivilrecht.89F Bevor der Haftungsbescheid mit Zahlungsau...
- 3.1 Der Haftungsbescheid nach § 191 AO
- Steuerbescheide sind Verwaltungsakte i. S. v. § 155 Abs. 1 Satz 1 und 2 i. V. m. § 122 AO. Der Haftungsbescheid dagegen ergibt sich aus § 191 Abs. 1 AO. Es handelt sich um einen Verwaltungsakt i. S. v. § 118 AO. Dies schließt eine Anwendung der §§ 155...
- Weiterhin muss unterschieden werden zwischen dem Haftungsbescheid als solchem, durch den die Inanspruchnahme erfolgt, und der Zahlungsaufforderung i. S. d. Leistungsgebotes nach § 219 AO.93F Im Verwaltungsakt wird festgestellt, dass ein bestimmter Sa...
- Im Weiteren wird auf den Verfahrensablauf, die sog. Akzessorietät und die Subsidiarität der Haftung eingegangen.
- 3.1.1 Verfahrensablauf: Ermittlungsmöglichkeiten, Zuständigkeit und Anhörung
- Das Haftungsverfahren beginnt grundsätzlich mit Ermittlungshandlungen der Gemeinde. Nach § 88 Abs. 1 Satz 1 AO erfolgt die Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen. Hierzu werden die Auskünfte über das Handelsregister eingeholt und der für die Haftu...
- Im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung (§ 370 i. V. m. § 71 AO) können die Gemeinden auch Informationen bei den Gerichten einholen. Diese Möglichkeit ergibt sich aus §§ 111 ff. i. V. m. § 6 AO. Hierzu zählt ebenfalls die Anforderung von erforderliche...
- Die Zuständigkeit für den Erlass des Haftungsbescheides ergibt sich aus dem Sachzusammenhang; er erfolgt also grundsätzlich durch die Behörde, die sachlich und örtlich für den Erlass des Steuerbescheides zuständig ist.97F Besonders hervorzuheben ist,...
- Soweit sich die Möglichkeit einer Haftungsinanspruchnahme manifestiert, soll dem Betroffenen nach § 91 AO vor Erlass eines Verwaltungsaktes rechtliches Gehör gewährt werden. Besonders relevant ist die Anhörung, weil sich durch diese, neben anderen Asp...
- 3.1.2 Akzessorietät der Haftung
- Die Haftungsschuld ist grundsätzlich vom Bestand einer Steuerschuld abhängig, jedoch muss die Steuerschuld vorher nicht zwingend festgesetzt worden sein.101F Der Begriff der Festsetzung bedeutet, dass an den Steuerschuldner kein Gewerbesteuerbescheid...
- Eine Wirkung der Akzessorietät betrifft ebenfalls Änderungen der Steuerfestsetzung. Nachträgliche Änderungen der Steuerschuld führen zu Änderungen bei der Haftungsschuld.102F Von dieser Verbundenheit von Steuer- und Haftungsschuld gibt es nur wenige ...
- 3.1.3 Subsidiarität der Haftung
- Die Subsidiarität der Haftung bezieht sich auf das Leistungsgebot i. S. v. § 254 Abs. 1 AO.103F Die Zahlungsaufforderung ist daher ein eigener Verwaltungsakt, der selbstständig anfechtbar ist. Der Haftungsbescheid und die Zahlungsaufforderung können ...
- Nach dem Grundsatz der Subsidiarität darf die Zahlungsaufforderung bei Haftungsbescheiden i. S. v. § 219 Satz 1 AO nur erfolgen, soweit die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen des Steuerschuldners erfolglos ist oder anzunehmen ist, dass die Volls...
- Auch wenn es sich anbietet, die Haftung schnellstmöglich durchzuführen, muss sich die Gemeinde gegebenenfalls den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nicht rechtzeitig gegen den Steuerschuldner vollstreckt hat und sie dadurch ein Mitverschulden trifft.1...
- 3.1.4 Bestimmtheit, Form und Inhalt
- Als Verwaltungsakt muss der Haftungsbescheid nach § 122 AO schriftlich bekannt gegeben werden und nach § 119 Abs. 1 AO inhaltlich hinreichend bestimmt sein.107F Hinreichend bestimmt ist der Haftungsbescheid, wenn der Haftungsschuldner erkennen kann, ...
- Wie auch bei der Anhörung, ermöglicht § 126 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 AO die Nachholung der Begründung bis zum Abschluss der Tatsacheninstanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. Die Möglichkeit der nachträglichen Begründung dient vorrangig der „Verf...
- Dieses Verwaltungshandeln wird durchaus kritisch betrachtet. Insbesondere hat es zur Folge, dass die Verfahrensvorschriften vernachlässigt werden, da die Heilung, wenn erforderlich, noch erfolgen kann, und vor allem der im Grundgesetz festgelegte Grun...
- Der Erlass eines Haftungsbescheides erfolgt nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens, § 5 AO. Dieses ist Teil der Begründung. Hierbei wird zwischen Entschließungs- und Auswahlermessen unterschieden.113F Beide Arten werden nachfolgend dargestellt.
- 3.1.4.1 Entschließungsermessen
- Im Entschließungsermessen wird die Entscheidung getroffen, ob ein Haftungsbescheid zu erlassen ist.114F Insbesondere ist hierbei zu berücksichtigen, ob die Forderung bereits gegen den Steuerschuldner vergeblich durchgesetzt wurde115F , des Weiteren d...
- 3.1.4.2 Auswahlermessen
- Soweit für die Haftung mehrere Personen zur Verfügung stehen, hat die Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen eine Auswahl zu treffen, wobei sämtliche sich aus dem Sachverhalt ergebenden Umstände in der Entscheidung abzuwägen sind.118F Die Behörde hat d...
- 3.1.5 Verjährungsfristen
- Ansprüche im Steuerrecht verjähren ebenso wie Ansprüche im Zivilrecht. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass im Zivilrecht die Einrede der Verjährung i. S. v. § 214 BGB durch den Schuldner vorgebracht werden muss. Gemäß § 47 AO erlis...
- Es ist zwischen Festsetzungsverjährung nach §§ 169 ff. AO und Zahlungsverjährung nach §§ 228 ff. AO zu unterscheiden. Die Prüfung des Eintritts der Verjährung steht am Beginn jeder Inanspruchnahme, da diese je nach Haftungsart gemäß § 191 Abs. 3-5 AO ...
- 3.1.5.1 Festsetzungsverjährung
- Nach § 169 Abs. 1 Satz 1 AO begrenzt die Verjährung die Möglichkeit von Steuerfestsetzungen. Grundsätzlich gilt auch für die Gewerbesteuer die Festsetzungsverjährung nach §§ 169 ff. AO, wobei den Gemeinden nach Erlass des Gewerbesteuermessbescheids de...
- 3.1.5.2 Zahlungsverjährung
- Gemäß § 228 AO beträgt die Verjährungsfrist hier fünf Jahre und beginnt gemäß § 229 Abs. 1 Satz 1 AO mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch erstmals fällig geworden ist. Für den Haftungsbescheid ergibt sich nach § 229 Abs. 2 AO, dass, sowe...
- Die Zahlungsverjährung tritt – unabhängig davon, ob sich der Haftungstatbestand aus dem Steuer- oder Zivilrecht ergibt – nach §§ 228 ff. AO ein.124F
- 3.1.5.3 Verfahrensablauf
- Aus § 191 AO ergibt sich folgendes Prüfungsschema:
- Abb. 2: Schema Haftung nach § 191 AO125F
- Die Behörde hat also hier zu Beginn zu prüfen, ob der Steueranspruch festgesetzt worden ist. Wenn dies nicht erfolgt ist, zum Beispiel, weil die Gesellschaft nicht mehr existiert oder das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, ist zu prüfen, ob der G...
- Im weiteren Verlauf ist zu prüfen, woraus sich der Verjährungstatbestand in Verbindung mit § 191 AO ergibt. Je nach Haftungsnorm – ob aus der AO oder nach Zivilrecht – ergibt sich eine gesonderte Verjährungsprüfung. Die Verjährung wird bei den jeweili...
- 3.1.6 Insolvenz
- Die Insolvenzeröffnung hat Folgen für die Haftungsprüfung. Zu beachten ist hierbei § 93 InsO. Durch § 93 InsO kann die Haftung für die Personengesellschaften nicht mehr durch die Gemeinde erfolgen, sondern nur noch durch den Insolvenzverwalter.126F
- Die Regelung nach § 93 InsO schließt jedoch nicht die Haftung nach zum Beispiel § 69 AO aus. Die Gemeinde kann folglich den Anspruch noch auf eine andere Rechtsgrundlage stützen.127F
- Hervorzuheben sind noch die Folgen, wenn der Haftungsschuldner selbst insolvent wird. In diesem Fall sind die Haftungsschulden nach § 38 InsO Insolvenzforderungen.128F Eine Vertiefung diesbezüglich erfolgt nicht, da es sich hierbei um ein gesondertes...
- 3.2 Originäre Haftungstatbestände nach der AO
- Es gibt eine Vielzahl an Haftungsvorschriften außerhalb der AO. Vorliegend soll jedoch der Fokus ausschließlich auf die Haftungstatbestände aus H 5.3 GewStR gelegt werden. Daher werden die §§ 69, 71, 73 – 75 AO als Tatbestände des Steuerrechts und nac...
- 3.2.1 Haftung der Vertreter
- 3.2.1.1 Allgemein
- Aus § 69 AO ergibt sich die Pflicht der in §§ 34 und 35 AO genannten Personen zur Haftung für Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis, soweit eine Pflichtverletzung vorliegt.129F Die Personen treten folglich in ein direktes Zwangsverhältnis mit der ...
- 3.2.1.2 Maßgeblicher Personenkreis
- Zum haftenden Personenkreis nach § 34 AO gehören primär die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen, insbesondere der Geschäftsführer der GmbH und der Vorstand der AG, ebenso wie Abwickler und Liquidatoren.131F
- Die Vertretung von juristischen Personen erfolgt durch Organe im Sinne einer gesetzlichen Vertretung, da die Gesellschaften selbst nicht handeln können.132F Für den Geschäftsführer einer GmbH ist daher die Haftung an die formale Stellung nach § 35 Ab...
- Wenn die GmbH mehrere Geschäftsführer hat, so trifft die Haftung grundsätzlich alle Geschäftsführer, da jeder die gleichen Pflichten zu erfüllen hat.135F Bei der Verteilung der Aufgaben auf mehrere Geschäftsführer trifft die anderen die gegenseitige ...
- Zu den Geschäftsführern nicht rechtsfähiger Personenvereinigungen des privaten Rechts gehören die Geschäftsführer der GbR, auch wenn sie nur teilrechtsfähig ist, der OHG und der KG.137F Die Mitglieder und Gesellschafter der nichtrechtsfähigen Persone...
- § 69 AO sieht die Haftung auch bei Verfügungsberechtigten gemäß § 35 AO. Sie müssen daher die gleichen Pflichten erfüllen wie die gesetzlichen Vertreter, jedoch nur, soweit sie dazu rechtlich und tatsächlich in der Lage sind.140F Die Verfügungsberech...
- 3.2.1.3 Pflichtverletzung
- Die in den §§ 34 und 35 AO bezeichneten Personen haften, soweit Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37 AO) infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder er...
- § 69 AO enthält die Tatbestandsvoraussetzung, dass eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung vorliegen muss. Dies impliziert, dass ein fahrlässiges Verhalten nicht zur Haftung führt.146F
- 3.2.1.4 Eingetretener Haftungsschaden
- Ein Haftungsschaden ist eingetreten, wenn die Festsetzung nicht oder nicht rechtzeitig erfolgt oder die Ansprüche nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden oder die Zahlung von Steuervergütungen oder -erstattungen ohne einen Rechtsgrund erfolgt ist....
- Relevant ist dies für die Gewerbesteuer für die Fälle, in denen die Steuererklärung nicht fristgerecht oder gar nicht eingereicht wird. Dies bedeutet, dass diese ohne Steuerberater bis zum Veranlagungsjahr 2017 bis zum 31.5.2018, ab 2018 bis zum 31.7....
- 3.2.1.5 Ursächlichkeit der Pflichtverletzung
- Der eingangs genannte Personenkreis hat seine steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Hierzu gehören insbesondere die Abgabe der Steuererklärung, also die Gewerbesteuererklärung an das Finanzamt sowie die Zahlung der Gewerbesteuer an die Gemeinde. Entsche...
- Ein Beispiel aus der Praxis wäre, dass die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Steuerfestsetzung nicht mehr existiert und daher auch keine Vollstreckungsmöglichkeiten gegeben sind. Durch die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister sowie die Schließung...
- Als Gegenbeispiel wäre zu nennen, dass eine Haftung entfallen könnte, wenn die Forderung, unabhängig von der Abgabe der Steuererklärung, nicht bedient werden konnte, da keine Mittel zu Verfügung standen.154F Es ist jedoch auf den Einzelfall abzustell...
- 3.2.1.6 Verschulden
- Aus § 69 AO ergibt sich bereits die Voraussetzung, dass die Pflichtverletzung schuldhaft erfolgt sein muss. Dies bedeutet, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen wurde. Grobe Fahrlässigkeit liege vor, wenn jemand die Sorgfalt, zu der er ...
- Von dem in den §§ 34 f. AO genannten Personenkreis kann erwartet werden, dass die erforderlichen Kenntnisse zur Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen vorhanden sind.157F Soweit der Geschäftsführer zu der Erkenntnis gelangt, hierfür nicht über di...
- Schließlich muss der Geschäftsführer sein Amt niederlegen, wenn er erkennt, dass es ihm, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich ist, die erforderlichen Pflichten vollständig zu erfüllen.161F
- Besondere Ausnahmen für die Zahlungsverpflichtung, hinsichtlich einer möglichen Pflichtverletzung aus nicht rechtzeitiger Erfüllung, ergeben sich in der Insolvenz. Ausnahmen für die Zahlung bestehen beispielsweise für den Insolvenzverwalter in Bezug a...
- In der Praxis begründet sich die Haftungsprüfung daraus, dass die Steuererklärung nicht abgegeben wird und das Finanzamt die Steuern, insbesondere die Gewerbesteuer, schätzt. Durch die Schätzung kommt es zu einer finanziellen Belastung. Wenn die Gesel...
- 3.2.1.7 Haftungsumfang
- Aus § 44 Abs. 1 AO ergibt sich, das Personen, die nebeneinander dieselbe Leistung aus dem Steuerschuldverhältnis schulden oder für sie haften oder die zusammen zu einer Steuer zu veranlagen sind, Gesamtschuldner sind. Soweit nichts anderes bestimmt is...
- Der Umfang der Haftung ergibt sich aus § 69 Satz 1 AO. Hiernach umfasst sie alle Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nach § 37 AO. Darunter fallen insbesondere auch Zinsen und Verspätungszuschläge. Säumniszuschläge gehören ebenfalls zum Haftungsu...
- Der Betroffene wird im Vorverfahren angehört. Nach §§ 90 ff. AO ist er zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts verpflichtet. Kommt er seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, kann die Gemeinde den Haftungsumfang schätzen oder entscheidet nach ...
- 3.2.1.8 Verjährung
- Nach § 191 Abs. 3 Satz 3 AO beginnt die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Tatbestand verwirklicht worden ist. § 69 AO nennt verschiedene Umstände, die den Tatbestand verwirklichen. Problematisch ist jedoch insbesondere die Fr...
- 3.2.1.9 Haftungsinanspruchnahme
- Die Behörde hat im Haftungsbescheid ihr Ermessen nach § 191 Abs. 1 i. V. m. § 5 AO zu begründen. Der Haftungsschuldner muss im Haftungsbescheid erkennen können, dass hier das Ermessen vollumfänglich ausgeübt worden ist.173F Insbesondere ist bei mehre...
- 3.2.2 Haftung des Steuerhinterziehers
- Der Sachverhalt der Steuerhehlerei (§§ 71, 374 AO) findet auf die Gewerbesteuer keine Anwendung und wird daher auch nicht thematisiert.176F Die Steuerhehlerei bezieht sich nur auf Verbrauchssteuern oder Einfuhr- und Ausfuhrabgaben i. S. v. § 3 Abs. 3...
- 3.2.2.1 Haftungsschuldner
- Die Haftung nach § 71 AO setzt voraus, dass eine Steuerhinterziehung nach § 370 AO begangen wurde. Die Haftung nach § 71 AO hat, wie auch die Haftung nach § 69 AO, den Charakter eines Schadensersatzes, wonach hier der Haftende für den Ersatz des entst...
- 3.2.2.2 Haftungstatbestand
- Die Voraussetzungen für die Strafbarkeit müssen vorliegen, jedoch bedarf es für die Haftung keiner strafrechtlichen Verurteilung.182F Die Heranziehungsmöglichkeit ohne eine strafrechtliche Verurteilung liegt in der Möglichkeit der strafbefreienden Se...
- Für die Haftung nach § 71 AO ist es wichtig, dass der Versuch allein nicht ausreicht (§ 370 Abs. 2 AO), da dann kein Schaden entstanden ist und es an der Kausalität zwischen der Handlung und einem zugehörenden Erfolg mangelt.185F
- 3.2.2.3 Haftungsumfang
- Der Haftungsumfang ergibt sich aus dem Wortlaut der Norm. Somit hat der Steuerhinterzieher für die verkürzten Steuern und die zu Unrecht gewährten Steuervorteile sowie für Zinsen nach § 233a und § 235 AO zu haften. Die Haftung für die verkürzten Steue...
- Aus § 370 Abs. 4 AO ergibt sich, wann Steuern verkürzt sind. Steuern sind namentlich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden; dies gilt auch dann, wenn die Steuer vorläufig oder unter Vorbehalt der...
- Der Steuerhinterzieher hat nach der Norm auch für die Zinsen gemäß § 235 AO zu haften. Schuldner für die sogenannten Hinterziehungszinsen ist derjenige, zu dessen Vorteil die Steuern hinterzogen worden sind, wobei der Täter und der Steuerschuldner nic...
- Der Schadensersatzcharakter der Norm hat für die Prüfung der Haftungsinanspruchnahme weitreichende Folgen. So entfällt die Haftung, wenn der Schaden für den Fiskus auch bei ehrlichem Verhalten entstanden wäre, ferner, wenn ohne die vorsätzliche Tat ke...
- Die Gemeinde kann die hinterzogene Gewerbesteuer durch Haftungsbescheid geltend machen, ohne dass hierfür gegenüber dem Hauptschuldner der Umstand der Steuerhinterziehung in einem Grundlagenbescheid festgestellt wurde.194F Die Inanspruchnahme nach § ...
- 3.2.2.4 Verjährung
- Aus § 191 Abs. 3 Satz 2 AO ergibt sich, dass die Festsetzungsfrist bei Steuerhinterziehung zehn Jahre beträgt. Nach § 191 Abs. 1 Satz 2 AO kann die Haftungsinanspruchnahme auch noch ergehen, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen oder die festzusetzend...
- 3.2.2.5 Haftungsinanspruchnahme
- Die Gemeinde hat den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln und kann sich, da ihr meist Teile hiervon unbekannt sind, an das Finanzamt wenden. Denn es handelt sich bei der Inanspruchnahme im Rahmen der Auswahl um eine Ermessensentscheidung nach § 5 A...
- 3.2.3 Haftung bei der Organschaft
- 3.2.3.1 Begriff der Organschaft
- Gemäß § 73 AO haftet die Organgesellschaft für solche Steuern des Organträgers, für welche die Organschaft zwischen ihnen steuerlich von Bedeutung ist. In Bezug auf die Gewerbesteuer ergibt sich die gewerbesteuerliche Organschaft aus § 2 Abs. 2 GewStG...
- 3.2.3.2 Haftungsschuldner
- Aus dem Vorgenannten ergibt sich, dass die Organgesellschaft für den Organträger in die Haftung genommen werden kann. Handelt es sich um mehrere Organgesellschaften, die dem gleichen Organträger zuzurechnen sind, dann unterliegen sie alle der Haftung ...
- 3.2.3.3 Umfang
- Die Organgesellschaft haftet für die Gewerbesteuer, für welche der Organträger Steuerschuldner ist solange, wie die Organschaft nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG besteht.203F Für die Haftung ist ausschlaggebend, dass das Organschaftsverhältnis für das ge...
- Auch ist festzustellen, dass es nicht darauf ankommt, wann die Steuer konkret zu zahlen ist.206F Die Gewerbesteuer wird für den Erhebungszeitraum nach dessen Ablauf festgesetzt (§ 14 Abs. 1 Satz 1 GewStG). Somit muss die Organschaft für den Erhebungs...
- Nach der herrschenden Ansicht umfasst die Haftung lediglich den Gewerbesteueranteil, welcher der jeweiligen Organgesellschaft zuzurechnen ist.207F Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich diesbezüglich keine Begrenzung, wodurch die Organgesellschaft im v...
- 3.2.3.4 Verjährung
- Die Verjährung ergibt sich aus § 191 Abs. 3 Satz 5 AO. Demnach beginnt die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahres, für das die Gewerbesteuer festgesetzt worden ist,211F und verjährt darüber hinaus auch nicht, bevor die gegen den Steuerschuld...
- 3.2.3.5 Haftungsinanspruchnahme
- Die Haftungsinanspruchnahme ist eine Ermessensentscheidung nach § 5 AO. Darüber hinaus ist die Haftung nach § 73 AO subsidiär.212F Soweit die Inanspruchnahme einer Organgesellschaft für die Gewerbesteuer des Organträgers oder einer der Organgesellsch...
- Die rechtliche Prüfung stellt sich für die Gemeinde als schwierig dar. Sie hat durch die Einzelfallprüfung das Ermessen auszuüben und den Sachverhalt sachlich und rechtlich vollständig zu würdigen.
- 3.2.4 Haftung des Eigentümers von Gegenständen
- 3.2.4.1 Allgemein
- Grundsätzlich dient § 74 AO als Pendant für die Möglichkeit der Sicherheitsleistung bei Überlassung von Gegenständen im Bereich des Handels- bzw. Privatrechts zum Beispiel nach den §§ 232-240 BGB. Der Fiskus, hier die Gemeinde, kann bei der Anmeldung ...
- 3.2.4.2 Unternehmen
- Der Gegenstand muss dem Unternehmen dienen. Der Begriff des Unternehmens basiert hierbei auf dem Umsatzsteuerrecht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG, Abschn. 2.7. UStAE).217F Da die Gewerbesteuerpflicht im Messbescheidsverfahren jedoch bereits durch das Finanz...
- 3.2.4.3 Gegenstand
- Es muss sich um einen Gegenstand handeln. § 74 AO enthält jedoch keine Legaldefinition für den Gegenstand. Der Gegenstand nach § 74 AO umfasst nicht nur Sachen i. S. v. § 90 BGB, sondern hat sich durch Auslegung und Rechtsentwicklung soweit erweitert,...
- 3.2.4.4 Haftungskreis
- Der Haftungskreis ergibt sich grundsätzlich aus § 74 Abs. 2 AO. Es kann sich bei der Person sowohl um eine natürliche als auch eine juristische Person handeln, ebenfalls kommt die Personengesellschaft in Betracht.222F
- Soweit eine Person wesentlich am Unternehmen beteiligt ist und diesem eigene Gegenstände nicht nur vorübergehend zur Verfügung gestellt hat, soll durch § 74 AO die Haftung des Eigentümers der Gegenstände ermöglicht werden.223F Es geht nicht um Beteil...
- Die Beteiligung kann auch durch einen beherrschenden Einfluss erfolgen, § 74 Abs. 2 Satz 2 AO. Ein solcher liegt vor, wenn der Einfluss gerade nicht durch Vermögenswerte bedingt ist, sondern „tatsächlich und in einer Weise ausgeübt wird, die dazu beit...
- 3.2.4.5 Umfang der Haftung
- Es sind ausschließlich Betriebssteuern, also unter anderem auch die Gewerbesteuer, von der Haftung betroffen. Dies folgt aus der Formulierung „für diejenigen Steuern des Unternehmens, bei denen sich die Steuerpflicht auf den Betrieb des Unternehmens g...
- Die Haftung erstreckt sich jedoch nur auf die Steuern, die während des Bestehens der wesentlichen Beteiligung entstanden sind, § 74 Abs. 1 Satz 2 AO. Soweit die Beteiligung beendet ist, endet gleichzeitig auch die Haftung für die Gewerbesteuer.229F D...
- Die Haftung des Eigentümers erfolgt zwar persönlich, aber nur mit dem dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Gegenstand, wobei sie nicht darauf beschränkt ist, dass sich der Gegenstand noch im Eigentum befindet.231F Somit kann auch der Wert des Geg...
- 3.2.4.6 Verjährung
- Nach § 74 Abs. 3 Satz 5 AO endet die Festsetzungsfrist nicht, bevor die gegen den Steuerschuldner festgesetzte Steuer verjährt ist. Gemeint ist hierbei die Zahlungsverjährung nach § 228 AO, welche 5 Jahren beträgt. Bei dieser Haftung handelt es sich u...
- 3.2.4.7 Geltendmachung mit Haftungsbescheid
- Der Haftungsbescheid hat im Tenor, die Haftung auf den konkreten Gegenstand auszurichten.234F Soweit diese Voraussetzung nicht erfüllt wird, mangelt es dem Bescheid an der notwendigen Bestimmtheit.235F Dies kann zur Nichtigkeit des Haftungsbescheids...
- Auch beim Tatbestand nach § 74 AO darf die Zahlungsaufforderung nur erfolgen, soweit die Vollstreckung gegen den Steuerschuldner, nach dem Grundsatz der Subsidiarität, erfolglos ist oder erfolglos erscheint, wobei die Vollstreckung dann die Verwertung...
- 3.2.5 Haftung des Betriebsübernehmers
- 3.2.5.1 Allgemein
- § 75 AO dient der Sicherung der Steuern aus dem übertragenen Unternehmen.237F Soweit noch eine rückständige Gewerbesteuer besteht, soll durch die Haftung des Betriebsübernehmers die Entziehung der Vollstreckungsgrundlage verhindert werden.238F
- 3.2.5.2 Voraussetzungen
- Voraussetzung für die Haftung ist, dass es sich um einen Betrieb bzw. ein Unternehmen handelt, das vollständig übereignet wird.239F
- Bei der Übertragung des ganzen Unternehmens muss es sich um ein sogenanntes lebendiges Unternehmen handeln.240F Nach der Rechtsprechung handelt es sich hierbei um ein Unternehmen, wenn „der Übernehmer das Unternehmen ohne nennenswerte finanzielle Auf...
- Der Erwerber kann der Haftung nicht mit der Begründung der Überschuldung, Insolvenzfähigkeit oder sonstigen Zahlungsproblemen des bisherigen Unternehmens entgehen, soweit er ein agiles Unternehmen erworben hat.245F Auch kann er zur Haftung herangezog...
- Soweit die Übertragung nicht vollständig zum Beispiel im Wege der Zurückbehaltung und somit erst zu einem späteren Zeitpunkt die Übereignung erfolgt, ist die Haftung weitgehend ausgeschlossen.247F
- § 75 AO bildet einen Gegensatz zum Zivilrecht, weil bei letzterem jeder Gegenstand einzeln übertragen werden muss, da es dort beim Erwerb von Unternehmen keine Gesamtrechtsnachfolge gibt.248F Hieraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass, soweit die Übe...
- Abschließend ist hier zu nennen, dass ein Haftungsausschluss i. S. d. § 25 Abs. 2 HGB als privatrechtliche Vereinbarung zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber in Haftungsangelegenheiten für die Betriebssteuern nach § 75 AO nicht möglich ist und eine...
- Der einzige gesetzliche Haftungsausschluss ergibt sich nach § 75 Abs. 2 AO, wenn der Erwerb aus einer Insolvenzmasse oder im Vollstreckungsverfahren stattfand.
- 3.2.5.3 Umfang
- Nach § 75 AO beschränkt sich die zeitliche Haftung nur auf solche Ansprüche, die seit dem Beginn des letzten vor der Übereignung liegenden Kalenderjahrs entstanden sind und bis zum Ablauf von einem Jahr nach Anmeldung des Betriebs durch den Erwerber f...
- Der Gesetzeswortlaut benennt nur den Beginn des Haftungszeitraums, jedoch kein Ende. Somit ist, auch aufgrund der Rechtsprechung, davon auszugehen, dass der Zeitraum endet, wenn der Erwerber selbst zum Schuldner der Gewerbesteuer wird.251F
- In Bezug auf die Gewerbesteuer entstehen die Ansprüche hieraus nach § 38 AO i V. m. §§ 14, 18, 21 GewStG, also konkret mit Ablauf des Kalenderjahres. Sobald hier folglich das Unternehmen, für welches gehaftet wurde, der neue Steuergegenstand wird, end...
- Neben der zeitlichen und der inhaltlichen Beschränkung ist die Haftung auch nach § 75 Abs. 1 Satz 2 AO auf den Bestand des übernommenen Vermögens beschränkt. Also ist der Fundus der übernommenen Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Haftungsinanspruchnahme...
- 3.2.5.4 Verjährung
- Aus § 191 AO ergibt sich für die Verjährung keine gesonderte Regelung. Jedoch ist für deren Berechnung zu berücksichtigen, dass hier ein Unternehmen als Ganzes zwar übertragen wird, dieses jedoch aus einzelnen Bestandteilen besteht. Die Frist für die ...
- 3.2.5.5 Haftungsinanspruchnahme
- Die Aufklärung des Sachverhalts obliegt der Behörde, jedoch trifft den Haftungsschuldner durch die Mitwirkungspflicht ebenfalls die Verantwortung.256F
- Kommt der Betroffene der Mitwirkungspflicht nicht oder nicht vollständig nach, kann die Behörde nach Aktenlage entscheiden und von einem für den Schuldner „ungünstigen Sachverhalt“257F ausgehen.
- Der Haftungsbescheid kann nur die übertragenen Gegenstände bzw. allgemein das Vermögen betreffen, was ebenfalls impliziert, dass die Vollstreckung auch nur in das vorgenannte erfolgen kann.258F Die betragsmäßige Beschränkung wird erst bei der Vollstr...
- Laut BFH sind die Haftungsnormen nach § 69 AO und § 75 AO gleichrangig.262F Welche Haftungsnorm im Rahmen der Haftung herangezogen wird, ist einzelfallabhängig sowie nach Ermessen der Behörden abzuwägen. Im Übrigen ist auf das Entschließungsermessen ...
- 3.2.6 Zwischenfazit
- Die oben dargestellten Haftungstatbestände nach der AO sind vielseitig und bieten der Gemeinde weitreichende Möglichkeiten. Der Haftungsbescheid kann dann gegenüber dem jeweiligen Personenkreis ergehen. Hierdurch werden der Steuerschuldner und der Haf...
- Auch wenn der Kreis der potenziellen Schuldner erweitert wird, so darf nicht vergessen werden, dass die Realisierung der Forderung dennoch fraglich bleibt. Der Haftungsbescheid und die Zahlungsaufforderung sind jedoch zu erlassen, um das Ausfallrisiko...
- 3.3 Zivilrechtliche Haftungsnormen i. V. m. § 191 AO
- Neben den Haftungstatbeständen nach der AO kann der Fiskus die Haftungsmöglichkeit nach § 191 Abs. 4 AO auch aus dem Zivilrecht herleiten.263F Hier ergeht dann ebenfalls ein Haftungsbescheid i. S. v. § 191 AO.264F
- Für die Prüfung der Verjährung ist vorab bereits auf § 191 Abs. 4 AO Bezug zu nehmen. Der Haftungsbescheid kann somit ergehen, solange der Haftungsanspruch, nach dem für die zivilrechtliche Haftungsnorm maßgebenden Recht, noch nicht verjährt ist. Dahe...
- 3.3.1 § 25 HGB
- 3.3.1.1 Allgemein
- Gemäß § 25 Abs. 1 HGB haftet derjenige, der ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft i. S. d. § 1 Abs. 2 HGB unter der bisherigen Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortführt. Die Haftung umfasst alle...
- 3.3.1.2 Haftungsvoraussetzungen
- Voraussetzung für die Haftung ist ein Gewerbebetrieb von Kaufleuten, insbesondere ins Handelsregister eingetragene i. S. v. § 1 HGB, wobei eine Erweiterung auf alle möglichen Unternehmer durch die Rechtsprechung, zum Beispiel durch „die Übertragung vo...
- Besonders relevant ist die Fortführung i. S. v. § 25 HGB. Unter Fortführung ist zu verstehen, dass eine Firmenkontinuität erfolgt.271F Es geht im Kern darum, mit welcher Firmenbezeichnung am Markt aufgetreten wird. Eine Stilllegung führt dazu, dass e...
- 3.3.1.3 Haftungsumfang
- Zum Umfang gehören insbesondere die Betriebssteuern, wie die Gewerbesteuer, jedoch auch der Säumniszuschlag und der Verspätungszuschlag.273F Durch die Firmenfortführung im Rahmen einer Rechtsnachfolge kommt es für den Erwerber der herrschenden Meinun...
- 3.3.1.4 Haftungsausschluss und Alternative
- Die Regelung nach § 25 Abs. 2 HGB lässt den Schluss zu, dass die Haftung des Erwerbers ausgeschlossen werden kann. Jedoch ist dies an Bedingungen geknüpft.
- Um die Haftung nach § 25 HGB wirksam ausschließen zu können, ist die Veröffentlichung im Handelsregister notwendig oder auch eine Mitteilung an die jeweiligen Gläubiger, dass eine Vereinbarung besteht, welche die Haftung ausschließt.275F Wenn ein Glä...
- Hierbei ist hervorzuheben, dass weiterhin die Möglichkeit besteht, die Haftung nach § 75 AO zu betreiben, wenn die Gemeinde bei der Prüfung der Haftung nach § 25 HGB feststellt, dass die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Jedoch stellt § 75 AO andere...
- 3.3.1.5 Ausschlussfrist und Verjährung
- Die Regelungen für die Haftung des Erwerbers und des Veräußerers ergeben sich für § 25 HGB aus § 191 Abs. 4 AO i. V. m. § 26 HGB.
- Bei der Frist nach § 26 HGB handelt es sich nicht um eine Verjährungsfrist, sondern ganz konkret um eine „Ausschlussfrist“276F . Dies hat zur Folge, dass der frühere Geschäftsführer für die Verbindlichkeiten nur haftet, wenn sie vor Ablauf von fünf Ja...
- Neben der Ausschlussfrist für den Veräußerer ist die Verjährungsregelung nach § 191 Abs. 4 AO anzuwenden, wonach der Haftungsbescheid ergehen kann, solange die Haftungsansprüche nach dem für sie maßgebenden Recht noch nicht verjährt sind. Eine direkte...
- Darüber hinaus finden die Regelungen nach § 26 Abs. 1 Satz 3 HGB i. V. m. §§ 204, 206, 210, 211 und 212 Abs. 2, 3 BGB Anwendung.
- 3.3.2 Haftung der Gesellschafter der Personengesellschaft
- Die Personengesellschaft, also GbR, OHG und KG, ist nach § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG Schuldner der Gewerbesteuer, soweit es sich nicht um eine reine Innengesellschaft handelt.283F Die Haftung der Gesellschafter der OHG erfolgt gemäß § 191 Abs. 1 AO i. V...
- Im Allgemeinen gilt, dass nach § 128 HGB die Gesellschafter einer GbR, OHG und KG den Gläubigern für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft als Gesamtschuldner persönlich haften. Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam.
- Nachfolgend werden die Haftungstatbestände der OHG, KG und der GbR im Einzelnen untersucht.
- 3.3.2.1 Haftung der Gesellschafter der OHG
- Der grobe Aufbau der OHG wurde bereits skizziert. Die OHG muss demnach mindestens zwei Gesellschafter haben und ist nach dem Gewerbesteuergesetz selbst Steuerschuldner. Demnach können die Gesellschafter Haftungsschuldner sein. Die Haftung der Gesellsc...
- Nach § 130 HGB erfolgt demnach die Haftung für Verbindlichkeiten, auch wenn diese vor dem Eintritt des jeweiligen Gesellschafters begründet worden sind.285F Soweit ein Gesellschafter ausscheidet, haftet dieser ab der Eintragung im Handelsregister für...
- Der Haftungsumfang ergibt sich mangels gesetzlicher Angaben aus der Rechtsprechung. Demnach erfasst der Umfang der Haftung nicht nur die Gewerbesteuer als Hauptforderung, sondern auch die steuerlichen Nebenleistungen, also auch Säumniszuschläge, wobei...
- Für den Fall der Insolvenz der OHG gelten besondere Regelungen. Die Haftung nach § 128 HGB kann dann nicht mehr durch die Gemeinde geltend gemacht werden.289F Nach § 93 InsO hat ausschließlich der Insolvenzverwalter die persönliche gesellschaftliche ...
- 3.3.2.2 Haftung der Gesellschafter der KG
- Wie die OHG, so wurde auch der Aufbau der KG eingangs bereits skizziert. Hierbei wurde dargestellt, dass die KG aus einem Vollhafter, dem Komplementär, und dem Teilhafter, dem Kommanditisten, besteht.
- Für die KG gelten in Bezug auf die Haftung die gleichen Grundsätze wie bei der OHG, wobei hier aufgrund der Gesellschafterstruktur der Haftungsumfang unterschiedlich ist. Dies ist für die Haftung von großer Bedeutung. Die Haftung des Komplementärs erf...
- Die Einlage des Kommanditisten ergibt sich aus § 171 Abs. 1 HGB. Seine Haftung ist davon abhängig, ob seine Einlage geleistet wurde oder nicht. Wenn die Einlage durch den Kommanditisten in voller Höhe geleistet wurde, kann er nicht zur Haftung herange...
- Problematisch ist es für den Kommanditisten, wenn die Einlage zurückgezahlt wird. Sie gilt dann gemäß § 172 Abs. 4 HGB als nicht geleistet. Die Rückzahlung gemäß § 172 Abs. 4 HGB liegt vor, wenn eine Zuwendung erfolgt, ohne dass ein adäquater Ersatz g...
- Für die Gemeinde ist relevant, welchen Betrag der Kommanditist als Einlage zu leisten hatte. Dies ergibt sich gemäß §§ 172 Abs. 1, 162 Abs. 1 und 2 i. V. m. §§ 106, 107 HGB aus dem Gesellschaftsvertrag und ist auch in das Handelsregister einzutragen.
- Eine Besonderheit bildet die GmbH & Co. KG. Die Besonderheit liegt darin, dass es sich zwar um eine Personengesellschaft in Form einer KG handelt, jedoch ist hier gemäß § 19 Abs. 2 HGB der Vollhafter die GmbH. Die Haftung der GmbH als Geschäftsführer ...
- Reicht das Gesellschaftsvermögen der GmbH zur Deckung der ausstehenden Gewerbesteuer nicht aus, so ist die Haftung des Geschäftsführers der GmbH nach Steuerrecht zu prüfen. Diese ergibt sich dann, wie bereits dargestellt, aus §§ 34 i. V. m. § 69 AO.
- 3.3.2.3 Haftung der Gesellschafter der GbR
- Die Gesellschafter der GbR haften, wenn sie ein gewerbliches Unternehmen betreiben, für die Gewerbesteuer, obwohl eine konkrete Rechtsgrundlage hierfür fehlt.297F Daher wird ihre Haftung hier unter Einbeziehung der historischen Entwicklung gesondert ...
- Der Aufbau bzw. die Entstehung der GbR wurde bereits dargestellt. Für die GbR sind mindestens zwei Gesellschafter erforderlich. Untersucht wird nunmehr, wie hier die Haftung durch die Gesellschafter für die Gewerbesteuer möglich wird.
- Grundsätzlich war zu klären, ob die GbR selbst ein Rechtssubjekt sein kann. Der BGH hat entschieden, dass die GbR sowohl aktiv wie auch passiv im Zivilprozess parteifähig ist.298F Die Gesellschafter haften für Verbindlichkeiten der GbR „akzessorisch“...
- Aus der Entwicklung im Zivilrecht lässt sich die Eigenschaft der GbR als Steuersubjekt übertragen.300F Inwieweit die zivilrechtliche Auffassung für das Steuerrecht als Analogie anwendbar ist, war lange umstritten, wobei letztlich festzustellen ist, d...
- Zivilrechtliche Haftungsbeschränkungen zum Schutze der Gesellschafter der GbR sind nicht möglich.306F
- Aus der vorliegenden Rechtsprechung ergibt sich weiter, dass die Haftung der Gesellschafter der GbR denen der OHG entspricht und damit § 128 HGB analog als Anspruchsgrundlage für die Haftung der Gesellschafter für die Gewerbesteuer der Gemeinde Anwend...
- Auch in die Haftung genommen werden kann der Gesellschafter einer Schein-GbR, der zwar keiner ist, jedoch aufgrund seines Handelns als ein solcher auftritt.310F Dies ist insbesondere bei der Mitwirkung als Angestellter in der oder für die GbR zu berü...
- 3.3.2.4 Verjährung für die Haftung nach Zivilrecht
- Die Verjährung für die Haftung nach Zivilrecht richtet sich gemäß § 191 Abs. 4 AO nach dem maßgebenden Recht. Als Folge hieraus sind die entsprechenden Verjährungsnormen nach dem BGB und dem HGB zu untersuchen.
- Wie bereits bei § 25 HGB dargestellt, gilt auch bei der zivilrechtlichen Haftung für die Personengesellschaften die allgemeine Verjährung nach §§ 195 ff. BGB. Daneben ist die besondere Verjährung für die jeweilige Haftungsgrundlage der Personengesells...
- Die Haftung der Gesellschafter der OHG, des Komplementärs oder des Kommanditisten einer KG erfolgt nach dem HGB. Relevant ist hierbei, ob die Gesellschaft aufgelöst oder Gesellschafter bereits ausgeschieden sind. Soweit die Gesellschaft besteht, erfol...
- Die Haftung bei ausgeschiedenen Gesellschaftern der OHG ergibt sich aus § 160 Abs. 1 HGB. Nach dieser Norm haftet der ausgeschiedene Gesellschafter für bis zum Austritt mittels Gewerbesteuerbescheid begründete Forderungen, wenn diese vor Ablauf von fü...
- Auch bei der Haftung der GbR sind die Verjährungsvorschriften nach § 191 Abs. 4 AO unter Berücksichtigung der Zivilrechtsnorm zu untersuchen. Im Hinblick auf das Ausscheiden eines Gesellschafters findet § 736 Abs. 2 BGB i. V. m. § 160 Abs. 1 HGB Anwen...
- Die Haftung der Gesellschafter nach der Auflösung der GbR erfolgt gem. § 726 Abs. 2 BGB i. V. m. § 159 Abs. 1 HGB. Hier verjähren die Ansprüche ebenfalls nach fünf Jahren.316F
- Durch § 159 Abs. 4 HGB wird die Wirkung des Neubeginns der Zahlungsverjährung nach § 231 Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 159 Abs. 4 HGB analog für die Gewerbesteuer auf die bisherigen Gesellschafter übertragen.317F Insbesondere die Gewährung einer Ausset...
- 4. Rechtsbehelfsmöglichkeiten
- Dieses Kapitel soll einen kurzen Überblick über die Rechtsbehelfsmöglichkeiten geben. Art. 19 Abs. 4 GG gibt die sog. Rechtsweggarantie. So kann der Steuerschuldner gegen den Gewerbesteuerbescheid und der Haftungsschuldner gegen den Haftungsbescheid r...
- Bei dem Gewerbesteuerbescheid und dem Haftungsbescheid der Gemeinde handelt es sich jeweils um einen Verwaltungsakt. Gegen diesen kann innerhalb eines Monats gemäß § 70 VwGO Widerspruch erhoben werden. Hier ist vorab das Verwaltungsverfahren vom Steue...
- Die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs ergibt sich aus § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte ergibt sich aus § 33 Abs. 2 FGO i. V. m. Art. 105 Abs. 2a, 108 Abs. 4 GG, wonach die Verwaltung der Gewerbesteuer als Realsteuer...
- Das Gewerbesteuerverfahren ist zweigliedrig, da das Finanzamt den Grundlagenbescheid und die Gemeinde den Folgebescheid erlässt. Das Einspruchsverfahren gegen den Messbescheid erfolgt nach §§ 347 ff. AO, der Einspruch wird beim zuständigen Finanzamt e...
- Sowohl für den Gewerbesteuerbescheid als auch für den Haftungsbescheid gilt, dass nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO der Widerspruch keine zahlungsaufschiebende Wirkung hat. Zu den öffentlichen Abgaben gehören demnach auch die Steuern in der Gestalt der Gewe...
- In Bezug auf den Gewerbesteuerbescheid der Gemeinde kann die Aussetzung der Vollziehung durch die Aussetzung des Grundlagenbescheides nach § 361 AO beim Finanzamt erreicht werden.322F Dies gilt nur dann, wenn die Gemeinde den Grundlagenbescheid inhal...
- Der Haftungsschuldner hat die Möglichkeit, einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung nach § 80 Abs. 4 VwGO bei der Behörde zu stellen, die den Haftungsbescheid erlassen hat, oder sich gleich an das zuständige Verwaltungsgericht nach den Bedingungen ...
- Soweit die Haftung in einem Haftungsbescheid neben der Zahlungsaufforderung auch Säumniszuschläge umfasst, gilt hier die Ausnahme, dass der Widerspruch für die Säumniszuschläge zahlungsaufschiebende Wirkung entfaltet.324F
- Der Haftungsschuldner hat nach höchstrichterlicher Entscheidung das Recht, sich nicht nur gegen den Haftungsbescheid, der ihn als Haftungsschuldner heranzieht, zu wehren, sondern auch gegen den bereits bestandskräftigen Gewerbesteuermessbescheid des F...
- 5. Fazit
- Diese Master-These hatte zum Ziel, die Entstehung der Gewerbesteuer mit Bezug zur Haftung nach der AO zu untersuchen. Hierzu wurde das Gewerbesteuerverfahren mit dem Steuergegenstand, Steuerschuldner und Steuergläubiger im Rahmen des zweigeteilten Ver...
- Auch wurde die Bekanntgabe an Gesellschaften in der Liquidation untersucht. Hier kann der Steueranspruch wirksam an den Liquidator bekannt gegeben werden. Bei der GbR i. L. kann der Gewerbesteuerbescheid an einen der früheren Gesellschafter bekannt ge...
- Ein besonderes Problemfeld bringt die Bekanntgabe des Gewerbesteuerbescheides bei gelöschten Gesellschaften mit sich. Das Finanzamt hat für die Bekanntgabe des Messbescheides den gleichen Aufwand wie die Gemeinde. Daher kann sich die Gemeinde an das F...
- Die Insolvenz oder Löschung der Gesellschaft und die Nichtzahlung der Gewerbesteuer durch den Steuerschuldner ist der Ausgangspunkt für ein Haftungsverfahren. Die Gewerbesteuer als kommunale Einnahmequelle hat ein bedeutendes Volumen. Daher sind die G...
- Die Untersuchung erfolgte durch die Betrachtung der einzelnen Bestandteile des Verwaltungsverfahrens sowie der Haftungsnormen nach Steuer- und Zivilrecht. Es hat sich gezeigt, dass das Haftungsverfahren und der Haftungsbescheid hohe Anforderungen an d...
- Weiter hat die Gemeinde von ihrem Ermessen Gebrauch zu machen. Hierzu gehören das Entschließungs- und das Auswahlermessen. Das Ermessen muss begründet werden. Insgesamt muss der Haftungsbescheid den strengen Anforderungen nach § 122 AO entsprechen, wo...
- Das Haftungsverfahren erfordert das grundsätzliche Bestehen einer Steuerschuld, wobei diese, wie sich aus der Untersuchung ergeben hat, nicht festgesetzt worden sein muss. Dies löst auch das Problem, wie bei einer gelöschten Gesellschaft die Forderung...
- Der Haftungsbescheid kann auch die Zahlungsaufforderungen enthalten. Hierbei handelt es sich um einen eigenständigen Verwaltungsakt, der auch selbstständig anfechtbar ist. Der Zahlungsaufforderung liegt der Grundsatz der Subsidiarität zugrunde. Hierun...
- Der Aspekt der Verjährung ist hervorzuheben. Die Untersuchung hat ergeben, dass unterschiedliche Verjährungsfristen zu berücksichtigen sind. Ausgangspunkt ist die Frage, ob der Steueranspruch bereits festgesetzt worden ist, da in der Folge, die Zahlun...
- Für die Haftung gibt es Normen im Steuerrecht und zivilrechtliche Normen. Diese wurden mit Bezug auf die Gewerbesteuer untersucht.
- Die Haftung nach § 69 AO erfasst einen umfangreichen Personenkreis und bildet eine Alternative zu § 75 AO und den zivilrechtlichen Haftungsnormen. Insbesondere wurde festgestellt, dass sowohl der „Strohmann“, welcher nur auf dem Papier der Geschäftsfü...
- Damit treffen diesen Personenkreis die gesetzlichen Pflichten nach §§ 34 und 35 AO. Für die Gewerbesteuer bedeutet dies insbesondere die Abgabe der Steuererklärung sowie die Zahlung der vierteljährlichen Vorauszahlungen und die Abschlussbeträge. Wenn ...
- Die Vermeidung der Haftung für den Geschäftsführer kann nur durch eine gewissenhafte Aufgabenerfüllung sowie die rechtzeitige Durchführung von Maßnahmen, wie die Beauftragung von Dritten, also Personen der steuer- oder rechtsberatenden Berufe, erfolge...
- Eine andere bedeutsame Möglichkeit für die Gemeinde ist die Haftung des Betriebsübernehmers nach § 75 AO. Hier ist vor allem festzustellen, dass die Regelung sowohl im Steuerrecht als auch im Zivilrecht Anwendung findet. Im Zivilrecht kann die Gemeind...
- Aus praktischen Erwägungen ist es daher ratsam, bei einer Betriebsübernahme sämtliche Vorgänge der Vergangenheit, insbesondere steuerliche Verbindlichkeiten und deren Zahlung, bereits vor der Übernahme zu betrachten. Der Käufer sollte sich demnach ein...
- Die zivilrechtlichen Tatbestände sind für die Personengesellschaften von besonderer Bedeutung. Die Gesellschafter einer OHG können in die Haftung genommen werden. Auch die Haftung von bereits ausgetretenen Gesellschaftern ist möglich. Dies gilt, aufgr...
- Bei der KG hat die Untersuchung ergeben, dass der Kommanditist, der durch seine Position in der Regel die Haftung vermeiden will, in die Haftung für die Gewerbesteuer kommt, wenn die Einlage, aus welchem Grund auch immer, als nicht mehr geleistet gilt.
- Die Untersuchung der Haftungstatbestände behandelte auch die GbR. Diese ist die einfachste Form der Personengesellschaft und schnell gegründet. Jedoch besteht bei diesem losen Verbund hohe Haftungsrisiken. Vor allem, weil neben der schnellen Gründung ...
- Insbesondere dürfen beim Austritt von Gesellschaftern oder der Auflösung der Gesellschaft die Steuerforderungen, die meist erst ein oder zwei Jahre später gegebenenfalls durch Schätzung festgesetzt werden, nicht in Vergessenheit geraten. Hierfür könne...
- Den Abschluss der Untersuchung bildeten die Rechtsbehelfsmöglichkeiten. Hier ist im Ergebnis kurz festzustellen, dass sowohl im Gewerbesteuerverfahren als auch im Haftungsverfahren Rechtsbehelfsmöglichkeiten bestehen. Hervorzuheben ist die Folge des W...
- Der Steuerpflichtige und die steuerpflichtige Gesellschaft, unabhängig ob Personen- oder Kapitalgesellschaft, dürfen nicht übersehen, dass der Haftungstatbestand, der für die Gewerbesteuer gilt, auch für die anderen Steuerarten wie zum Beispiel die Um...
- Abschließend lässt sich im Ergebnis festhalten, dass bei der untersuchten Problematik eine Kombination von Steuer- und Verwaltungsrecht vorliegt. Dieses Konstrukt hat seine Schwächen und auch die Verwaltungsgerichte haben bisweilen Probleme mit Sachve...
- Das Haftungsrecht ist für den Haftungsschuldner und die Gemeinde ein aufwendiger Komplex, der sich für beide vermeiden lässt, wenn die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden und es bestenfalls nicht zu einer Haftung kommt.
- Abkürzungsverzeichnis
- Erklärung
- Abkürzung
- Absatz
- Abs.
- Anwendungserlass zur Abgabenordnung
- AEAO
- Aktiengesellschaft
- AG
- AO
- Artikel
- Art.
- Der Betriebsberater
- BB
- Elektronische Entscheidungsdatenbank in beck-online
- BeckRS
- Bundesfinanzhof
- BFH
- Sammlung nicht veröffentlichter Entscheidungen des BFH
- BFH/NV
- Sammlung der Entscheidungen des BFH
- BFHE
- Bürgerliches Gesetzbuch
- BGB
- Bundesgerichtshof
- BGH
- Sammlung der Entscheidungen des BGH in Zivilsachen
- BGHZ
- Bundessteuerblatt
- BStBl
- Bundesverfassungsgericht
- BVerfG
- Sammlung der Entscheidungen des BVerfG
- BVerfGE
- Bundesverwaltungsgericht
- BVerwG
- Die öffentliche Verwaltung, Zeitschrift
- DÖV
- Deutsches Steuerrecht
- DStR
- Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift) – Entscheidungsdienst
- DStRE
- Entscheidungen der Finanzgerichte
- EFG
- Einkommensteuergesetz
- EStG
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den
- FamFG
- Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Finanzgerichtsordnung
- FGO
- Finanzverwaltungsgesetz
- FVG
- Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- GbR
- Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
- GemFinRefG
- Gewerbesteuergesetz
- GewStG
- Gewerbesteuer-Richtlinien
- GewStR
- Grundgesetz
- GG
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- GmbH
- Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- GmbHG
- Handelsgesetzbuch
- HGB
- im Sinne der
- i. S. d.
- im Sinne von
- i. S. v.
- in Verbindung mit
- i. V. m.
- Kommanditgesellschaft
- KG
- Kommanditgesellschaft auf Aktien
- KGaA
- Körperschaftsteuergesetz
- KStG
- Limited
- Ltd.
- Münchener Kommentar
- MüKo
- Neue Juristische Wochenschrift
- NJW
- NJW-Rechtssprechung-Report Zivilrecht
- NJW-RR
- Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
- NVwZ
- Offene Handelsgesellschaft
- OHG
- Oberverwaltungsgericht
- OVG
- Ständige Rechtsprechung
- St Rspr.
- Umsatzsteuerrundschau
- UR
- Umsatzsteuer-Anwendungserlass
- UStAE
- Umsatzsteuergesetz
- UStG
- Verwaltungsrechtsprechung
- VerwRspr
- Verwaltungsgerichtshof
- VGH
- Verwaltungsgerichtsordnung
- VwGO
- Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
- ZIP
- Hinsichtlich der übrigen Abkürzungen siehe Kirchner, Hildebert/Butz, Cornelie, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 8. Auflage, Berlin 2015.
- Entscheidungsverzeichnis
- Fundstelle
- Aktenzeichen
- Art
- Datum
- Bundesverfassungsgericht
- DStRE 1997, 124
- 2 BvR 1157/93
- Beschl.
- 29.11.1996
- NJW 2002, 3533
- 1 BvR 1103/02
- Beschl.
- 02.09.2002
- BVerfGE 112, 216
- 2 BvR 2185/04
- Beschl.
- 25.01.2005
- Bundesfinanzhof
- NJW 1955, 1916
- II ZR 44/54
- Urt.
- 13.10.1955
- BFHE 65, 122
- V 298/56 U
- Urt.
- 27.06.1957
- UR 1961, 86
- V 71/58
- Urt.
- 02.06.1960
- BFHE 73, 221
- III 329/58 U
- Urt.
- 16.06.1961
- V 32/60 U
- Urt.
- 30.08.1962
- BFHE 99, 14
- I R 176/69
- Entsch.
- 18.03.1970
- BFHE 100, 71
- VI R 24/67
- Entsch.
- 07.08.1970
- VII R 117/69
- Urt.
- 10.10.1972
- BFHE 108, 257
- II R 42/67
- Urt.
- 29.11.1972
- IV R 172/70
- Urt.
- 04.02.1974
- BFHE 120, 129
- IV R 105/75
- Urt.
- 12.08.1976
- VII R 63/73
- Urt.
- 19.10.1976
- BFHE 124, 90-94
- V R 50/74
- Urt.
- 06.10.1977
- BFHE 130, 128
- VI R 185/79
- Urt.
- 22.02.1980
- V S 13/81
- Beschl.
- 28.01.1982
- VII R 105/79
- Urt.
- 16.03.1982
- BFHE 137, 88
- IIR34/81
- Entsch.
- 06.10.1982
- BFHE 139, 242
- V R 18/79
- Urt.
- 10.11.1983
- BFHE 141, 312
- VIII R 239/82
- Urt.
- 02.05.1984
- BStBl II 1985, 541
- IR119/82
- Entsch.
- 06.03.1985
- BStBl II 1985, 581
- VI R 30/81
- Urt.
- 15.03.1985
- BFH/NV 1987, 210-210
- VII R 111/78
- Urt.
- 07.05.1985
- BFHE 144, 204
- VII R 189/82
- Urt.
- 06.08.1985
- BFHE 145, 13
- VII R 187/82
- Urt.
- 23.10.1985
- BFHE 146, 4
- VII R 179/83
- Urt.
- 21.01.1986
- BFHE 148, 331
- II R 118/84
- Urt.
- 22.10.1986
- BFHE 149, 125
- VII R 4/84
- Urt.
- 24.02.1987
- BFHE 153, 285
- IV R 219/85
- Urt.
- 14.04.1988
- VII R 78/85
- Urt.
- 08.11.1988
- BFHE 155, 497
- VII B 188/88
- Beschl.
- 24.01.1989
- BFHE 156, 46
- VII R 165/85
- Urt.
- 21.02.1989
- BFHE 158, 1
- VII R 100/86
- Urt.
- 27.06.1989
- BFHE 161, 390
- VII R 26/89
- Urt.
- 27.03.1990
- BFHE 163, 119
- VII R 85/88
- Urt.
- 11.12.1990
- BFHE 164, 203
- VII R 93/88
- Urt.
- 05.03.1991
- NJW 1992, 112
- XI ZR 256/90
- Urt.
- 17.09.1991
- BFH/NV 1993, 303
- IV R 146/88
- Urt.
- 21.05.1992
- BFH/NV 1993, 215
- VII R 73-74/91
- Urt.
- 22.09.1992
- BFHE 169, 294 - 299
- IV R 60/91
- Urt.
- 01.10.1992
- VII R 13/92
- Urt.
- 17.11.1992
- BFHE 171, 27
- VII R 86/92
- Urt.
- 11.05.1993
- BFH/NV 1995, 89-90
- VII B 239/93
- Beschl.
- 14.06.1994
- BFHE 175, 489
- I R 112/93
- Urt.
- 13.07.1994
- BFHE 175, 509
- VII R 101/92
- Urt.
- 30.08.1994
- BeckRS 1994, 12466
- VII E 7/94
- Beschl.
- 24.11.1994
- BFH/NV 1995, 941
- VII B 172/94
- Urt.
- 07.03.1995
- BFH/NV 1995, 950
- VII S 39/92
- Beschl.
- 16.03.1995
- BFHE 178, 227
- II R 7/91
- Urt.
- 21.06.1995
- BFH/NV 1996, 661
- VII B 243/95
- Beschl.
- 21.02.1996
- BFH/NV 1997, 386
- VII R 53/96
- Urt.
- 12.12.1996
- BFHE 183, 307
- VII R 63/97
- Urt.
- 26.08.1997
- BFH/NV 1998, 1325
- VII B 36/97
- Beschl.
- 05.03.1998
- BFH/NV 2000, 346-347
- I R 111/98
- Urt.
- 21.07.1999
- BFH/NV 2000, 541-543
- VII B 106/99
- Beschl.
- 18.08.1999
- BFHE 191, 494
- I R 65/98
- Urt.
- 27.04.2000
- BFH/NV 2001, 413
- VII B 260/99
- Beschl.
- 21.08.2000
- VII R 63/99
- Urt.
- 19.12.2000
- BFHE 195, 510
- VII R 28/99
- Beschl.
- 11.07.2001
- BFHE 197, 1
- VII B 155/01
- Beschl.
- 02.11.2001
- BFH/NV 2002, 827
- VII R 33/01
- Urt.
- 07.02.2002
- BFH/NV 2002, 891-894
- VII B 323/00
- Beschl.
- 11.02.2002
- DStR 2003, 205
- VII R 11/01
- Urt.
- 07.11.2002
- BFHE 201, 392
- I R 33/01
- Urt.
- 18.12.2002
- BFHE 201, 525
- X R 21/00
- Urt.
- 09.04.2003
- BFHE 204, 283
- I R 88/02
- Urt.
- 19.11.2003
- DStR 2004, 1038
- XI R 3/03
- Urt.
- 21.01.2004
- VIIB224/03
- Beschl.
- 10.02.2004
- DStR 2004, 1038
- BFHE 205, 14
- VII R 52/02
- Urt.
- 11.03.2004
- nv
- VII B 36/04
- Beschl.
- 26.04.2004
- BFH/NV 2004, 1368-1369
- V B 212/03
- Beschl.
- 21.05.2004
- BFHE 205, 539
- VII R 29/02
- Urt.
- 25.05.2004
- NWB 2006, 404
- XI R 1/03
- Urt.
- 08.09.2004
- VII R 76/03
- Urt.
- 05.10.2004
- BFH/NV 2005, 1217
- VII B 213/04
- Beschl.
- 22.02.2005
- BeckRS 2006, 25009763
- VII B 119/05
- Beschl.
- 14.02.2006
- BFHE 213, 194
- VIIR50/05
- Urt.
- 09.05.2006
- VI R 49/02
- Urt.
- 26.07.2006
- BFH/NV 2007, 1067-1069
- I R 103/05
- Urt.
- 29.11.2006
- BFH/NV 2008, 1448-1451
- VII B 262/07
- Beschl.
- 24.04.2008
- BFH/NV 2008, 1805-1807
- VII B 184/07
- Beschl.
- 18.07.2008
- DStR 2009, 2670
- VII R 43/08
- Urt.
- 23.09.2009
- BFHE 229, 358
- I R 41/09
- Beschl.
- 10.03.2010
- BFH/NV 2011, 81
- V R 13/09
- Urt.
- 05.08.2010
- VII R 63/10
- Urt.
- 22.11.2011
- BFHE 238, 16
- VII R 28/10
- Urt.
- 23.05.2012
- BFH/NV 2013, 512
- IV B 64/11
- Beschl.
- 09.01.2013
- nv
- VII R 36/12
- Urt.
- 14.05.2013
- nv
- I R 19/14
- Urt.
- 06.04.2016
- DStR 2017, 934
- VIII R 52/14
- Urt.
- 17.01.2017
- Bundesverwaltungsgericht
- VerwRspr 1967, 142
- V C 21/64
- Urt.
- 08.12.1965
- NJW 1993, 2453-2455
- 8 C 20/90
- Urt.
- 12.03.1993
- NJW 1994, 602
- 8 C 64/90
- Urt.
- 13.08.1993
- NVwZ 1999, 300
- 8 B 143/97
- Beschl.
- 16.09.1997
- BFH/NV 2016, 527
- 9 C 11.14
- Urt.
- 14.10.2015
- NVwZ 2017, 56
- 9 A 16/15
- Urt.
- 15.07.2016
- Bundesgerichtshof
- BGHZ 34, 293-299
- III ZR 71/60
- Urt.
- 16.02.1961
- NJW 1987, 1633
- II ZR 303/85
- Urt.
- 01.12.1986
- DStR 1992, 878
- II ZR 54/91
- Urt.
- 10.02.1992
- DStR 2001, 310
- II ZR 331/00
- Urt.
- 29.01.2001
- DStR 2003, 1084
- IIZR56/02
- Urt.
- 07.04.2003
- NJW2008, 1085
- III ZR 33/07
- Urt.
- 20.09.2007
- Verwaltungsgerichtshof
- München21.12.1998
- BeckRS 1999, 20341
- 4 ZS 98.2811
- Beschl.
- München06.06.2005
- BeckRS 2005, 16637
- 4 ZB 03.3250
- Beschl.
- Oberverwaltungsgericht
- Koblenz12.02.2008
- BeckRS 2008, 33506
- 6 A 11154/07
- Urt.
- Nordrhein-Westfalen12.05.2017
- DÖV 2017, 781
- 14 A 2484/14
- Beschl.
- Oberlandesgericht
- BayObLG (München)
- ZIP 1984, 450
- BReg. 3 Z 192/83
- Urt.
- 02.02.1984
- BayObLG (München)
- NJW 1997, 1936
- 5 St RR 159/96
- Urt.
- 20.02.1997
- BayObLG (München)
- NVwZ-RR 2005, 135
- 1Z RR 5/03
- Urt.
- 25.05.2004
- Hamm
- NJW-RR 1990, 615
- 11 U 158/88
- Entsch.
- 19.05.1989
- Hamm
- NJW-RR 1995, 489
- 8 U 11/93
- Urt.
- 05.01.1994
- Köln
- BB 1970, 1335
- Ss 104/70
- Urt.
- 01.09.1970
- Saarbrücken
- NJW 2006, 2862
- 8 U 91/05
- Urt.
- 22.12.2005
- Finanzgericht
- Baden-Württemberg11.12.2002
- EFG 2003, 662
- 7 K 86/00
- Urt.
- Berlin-Brandenburg20.01.2011
- EFG 2011, 2096
- 9 K 9091/10
- Urt.
- Düsseldorf04.08.1992
- EFG 1992, 702
- 14 V 2425/92 A (H)
- Beschl.
- Düsseldorf22.02.2018
- EFG 2018, 721-722
- 9 K 280/15 H(U)
- Urt.
- Hamburg23.05.2000
- NWB 2000, 3207
- I 30/98
- Urt.
- Hessen05.12.2017
- EFG 2018, 616
- 1 K 1239/15
- Urt.
- Köln17.09.1997
- EFG 1998, 162-163
- 6 K 5459/91
- Urt.
- Köln09.12.1999
- EFG 2000, 203-205
- 15 K 1756/91
- Urt.
- München15.02.1978
- EFG 1978, 474
- III 113/77
- Urt.
- Münster15.09.2009
- EFG 2010, 287-289
- 2 K 32/09 U
- Urt.
- Nürnberg11.12.1990
- BeckRS 1990, 07532
- II 238/86
- Urt.
- Saarland27.01.1994
- EFG 1994, 686-687
- 2 K 164/91
- Urt.
- Schleswig-Holstein14.03.1979
- EFG 1979, 369
- IV 75/77
- Urt.
- Schleswig-Holstein01.12.2005
- EFG 2006, 321
- 2 K 174/04
- Urt.
- Verwaltungsgericht
- Bayreuth26.03.2015
- BeckRS 2015, 100018
- B 4 S 15.58
- Beschl.
- Köln27.08.2008
- BeckRS 2008, 39522
- 23 K 2853/06
- Urt.
- Köln21.06.2018
- BeckRS 2018, 29235
- 24 L 535/18
- Beschl.
- Magdeburg24.05.2017
- nv
- 2 A 373/15
- Urt.
- München15.12.2015
- nv
- M 10 S 15.3945
- Beschl.
- München21.04.2016
- nv
- M 10 K 15.5124
- Urt.
- Neustadt an der Weinstraße (Kammer)17.12.2014
- BeckRS 2015, 41243
- 1 K 717/14.NW
- Urt.
- Oldenburg05.12.2005
- BeckRS 2006, 20550
- 2 B 3951/05
- Beschl.
- Landgericht
- Frankenthal21.07.2004
- NJW 2004, 3190
- 2 S 75/04
- Urt.
- Literaturverzeichnis
- Baumbach, Adolf/Hopt, Klaus J.
- Handelsgesetzbuch: HGB mit GmbH & Co., Handelsklauseln, Bank- und Kapitalmarktrecht, Transportrecht (ohne Seerecht), 38. Aufl., München 2018.
- Birk, Dieter/Desens, Marc/Tappe, Henning
- Steuerrecht, 21. Aufl., Heidelberg 2018.
- Braun, Rainer (Hrsg.)/Günter, Karl-Heinz (Hrsg.)
- Das Steuer-Handbuch. ABC-Praxis des Steuerrechts, Stand: Dezember 2018, Köln 2018.
- Brinkmeier, Thomas
- Steuerhaftung des GmbH-Geschäftsführers. Zum Beitrag von Hans Dieter Eich in KÖSDI 2005, 14759, GmbH-StB 2005, 313.
- ders.
- Ermessensfehler beim Erlass von Haftungsbescheiden. Zum Beitrag von Dr. Alois Th. Nacke in GmbHR 2006, 846, GmbH-StB 2006, 308–309.
- Dißars, Björn-Axel
- Die gesellschaftsrechtliche Haftung der Gesellschafter für steuerliche Verbindlichkeiten von Personen- und Kapitalgesellschaft, DStR 1995, 1510–1511.
- Haarmeyer, Hans/Frind, Frank
- Insolvenzrecht, 5. Aufl., Stuttgart 2018.
- Halaczinsky, Raymond
- Die Haftung im Steuerrecht, 4. Aufl., Herne 2013.
- Hidien, Jürgen W./Pohl, Carsten/Schnitter, Georg
- Gewerbesteuer. 15. Aufl., Achim b. Bremen 2014.
- Hübschmann, Walter/Hepp, Ernst/Spitaler
- Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Kommentar, 250. Aktualisierung, Stand: Dezember 2018, Köln 2018.
- Klein, Franz/Gersch, Eva-Maria/Jäger, Markus/Rätke, Bernd/Ratschow, Eckart/Rüsken, Reinhart/Werth, Franceska
- Abgabenordnung. Einschließlich Steuerstrafrecht., 14. Aufl., München 2018.
- Krömker, Ulrich
- Haftung des Täters und Gehilfen einer Steuerhinterziehung. Voraussetzungen einer Inanspruchnahme durch Haftungsbescheid, AO-StB 2002, 389–391.
- Lenski, Edgar/Steinberg, Wilhelm
- Gewerbesteuergesetz – Kommentar, Stand: November 2018, Mainz 2018.
- Lippross, Otto-Gerd/Seibel, Wolfgang
- Basiskommentar Steuerrecht. AO, AStG, BewG, EigZulG, ErbStG, EStG, FGO, GewStG, GrEStG, GrStG, InvZulG, KraftStG, KStG, SolZG, UmwStG, UStG, Stand: November 2018, Saarbrücken 2018.
- ders.
- Haftung für Steuerschulden. Beratung, Gestaltung, Verfahren, 4. Aufl., Köln 2017.
- Reischl, Klaus
- Insolvenzrecht. 4. Aufl., Heidelberg 2016.
- Sapienti-AG
- http://blog.sapienti-ag.de/type/quote/ (Zugriff 19-02-11, 21:03 MEZ)
- Saenger, Ingo/Aderhold, Lutz/Lenkaitis, Karlheinz/Speckmann, Gerhard (Hrsg.)
- Handels- und Gesellschaftsrecht. Praxishandbuch. 2. Aufl., Wiesbaden 2011.
- Schoch, Friedrich/Schneider, Jens-Peter/Bier, Wolfgang
- Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar. Stand: September 2018, 35. Auflage, München 2019.
- Statistisches Bundesamt
- Unternehmen und Arbeitsstätten Insolvenzverfahren, Hg. v. Statistisches Bundesamt (Destatis), Stand: Oktober 2018, erschienen am 11.01.2019.
- Streck, Michael/Kamps, Heinz-Willi/Olgemöller, Herbert
- Der Steuerstreit, 4. Aufl., Köln 2017.
- Stuhldreier, Knut
- „Rechtzeitige“ Ermessenabwägungen bei Haftungsbescheiden, AO-StB 2004, 244–245.
- Thomas, Karin/Windhorst, Gerrit
- Steuerbescheide in der Praxis: Änderungen und Festsetzungsfristen, 1. Aufl., Wiesbaden 2007.
- Tipke, Klaus/Kruse, Heinrich Wilhelm
- Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung. Kommentar zur AO und FGO, Stand: Dezember 2018, 154. Aktualisierung, Köln 2018.
- Tipke, Klaus/Lang, Joachim
- Steuerrecht, 23 Aufl., Köln 2018.
- Westermann, Harm Peter/Wertenbruch, Johannes
- Handbuch Personengesellschaften. Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht; Verträge und Formulare. Stand: Juli 2018. 71. Aktualisierung, Köln 2018.