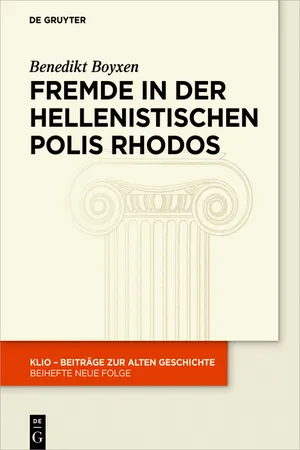1Einleitung
Die Eroberungen Alexanders des Großen hatten weitreichende und nachhaltige Folgen für die gesamte griechische Poliswelt. Eine gesteigerte Form der Mobilität in ganz neuen geographischen Dimensionen, eine Erweiterung des Handels- und Wirtschaftsraumes und besonders der Kontakt zwischen Griechen und Nichtgriechen, der zu einem intensiven kulturellen und personellen Austausch führte, können als prägende Merkmale des Hellenismus bezeichnet werden. In gleichem Maße intensivierte sich die Kommunikation zwischen verschiedenen Poleis, die ein vielgestaltiges Beziehungsnetz hervorbrachte – sei es durch panhellenische Feste und Agone, die Entsendung von Richtern zur Streitschlichtung oder verschiedene Formen von Bündnisschlüssen. In zahlreichen Verträgen, in denen Rechtsverhältnisse zwischen Poleis geregelt wurden, berief man sich sogar auf eine gemeinsame Verwandtschaft (syngeneia), wodurch das Verhältnis zu nah oder fern gelegenen Orten definiert und konstruiert wurde. Selbst ursprünglich nichtgriechische Gemeinwesen konnten in diesen ›Stammbaum‹ aufgenommen werden1. Jenseits der Polis entstanden damit vielfältige Formen der Kommunikation, die das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Lebenswelt verstärkten. Trotzdem blieb auch in hellenistischer Zeit die eigene Polis der zentrale Bezugspunkt eines jeden Griechen – ein Befund, der mittlerweile unbestrittener Forschungskonsens ist2.
Die zunehmende Mobilität führte indessen dazu, dass sich immer häufiger Bürger einer Polis oder auch Personen aus nichtgriechischen Gemeinwesen in einer anderen, fremden Polis aufhielten. Dem Thema ›Fremdheit‹ kommt demnach für die Epoche des Hellenismus in verschiedenen Hinsichten eine ganz herausragende Bedeutung zu; gleichzeitig bietet es zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Untersuchung von Mobilitäts- und Migrationsphänomenen. Bereits seit längerer Zeit werden Begegnungen zwischen Griechen und Nichtgriechen intensiv unter dem Aspekt der Akkulturation diskutiert und Fragen nach Fremd- und Selbstwahrnehmungen gestellt3. Jüngere Ansätze richten den Blick zudem insbesondere auf die Formen der Vernetzungen, in die jede Polis eingebettet war, und auf die verschiedenen Gruppen, die sich in Bewegung setzten4. Demgegenüber wurde bislang noch nicht systematisch untersucht, welche sozialen Auswirkungen diese neuen Rahmenbedingungen auf die Bürgerschaft einer Polis hatten sowie insbesondere umgekehrt, was der Wohnortswechsel für den Einzelnen genau bedeutete und wie sich das räumliche Neben- oder Miteinander von Bürgern und Nichtbürgern gestaltete.
Das für Rhodos in großer Zahl vorhandene Quellenmaterial erlaubt es, die Folgen der zunehmenden Migration und Mobilität an einem Ort, der im Schnittpunkt dieser Dynamik lag, umfassend zu betrachten. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es ganz allgemein, die soziale Stellung der Fremden innerhalb der Polis Rhodos zu bestimmen. Die bewusste Konzentration auf das rhodische Polisterritorium bietet dabei die Möglichkeit, aus mikrohistorischer Perspektive verschiedene Gruppen von Nichtbürgern zu unterscheiden, die Formen der Interaktion der Fremden mit den Polisbürgern in den Blick zu nehmen und nach Möglichkeiten sozialer Mobilität zu fragen. Dabei werden detailliert die zentralen Lebensbereiche der Polisbewohner betrachtet, um konkrete Inklusions- und Exklusionsbereiche auszumachen. Der ›Fremde‹ war in der Polisgesellschaft nicht primär durch seine Herkunft, sondern durch die Nichtzugehörigkeit zum Bürgerverband definiert. Die gerade auf Rhodos vielfach abgestufte rechtliche Kategorisierung der Nichtbürger war für ihre soziale Stellung ausschlaggebend und bildet daher auch den Ausgangspunkt der vorliegenden sozialgeschichtlichen Untersuchung5.
In den wechselnden Mächtekonstellationen der Diadochenreiche gelang Rhodos der Aufstieg zu einer bedeutenden See- und Handelsmacht. Gerade deshalb war die Polis für zahlreiche Fremde attraktiv. Die Fremden kamen entsprechend den weitgespannten rhodischen Handelsbeziehungen zu einem Großteil aus dem östlichen Mittelmeerraum, aus Syrien und Ägypten sowie aus den Poleis der kleinasiatischen Küste und der vorgelagerten Inseln – aber auch aus dem kleinasiatischen Binnenland sowie dem Schwarzmeergebiet. Viele von ihnen hielten sich nicht nur für zeitweilige Handelsgeschäfte in Rhodos auf, sondern verlegten dauerhaft ihren Wohnsitz an diesen Ort. Andere wurden in großer Zahl als Sklaven dorthin verschifft oder standen als Söldner im Dienst der Polis. Neben Athen, Alexandria und Pergamon ist Rhodos überdies in die Reihe der hellenistischen Bildungszentren einzuordnen und zeigt in dieser Hinsicht ebenso kosmopolitische Züge. Polemaios aus Kolophon liefert eines der gut belegten Beispiele eines Bildungsreisenden, der sich nach einem ausgiebigen Studium in seiner Heimatstadt nach Rhodos begab, um dort in den auf private Initiative gegründeten Schulen die weithin bekannten Lehrer zu hören6. Auch ein großer Teil der in Rhodos tätigen Bildhauer war fremder Herkunft; einige dieser Künstlerfamilien gingen über mehrere Generationen ihrem Handwerk in der Polis nach und unterhielten vielfach enge Kontakte zu Mitgliedern der rhodischen Oberschicht7.
Eine wichtige Voraussetzung für den Aufstieg von Rhodos war der Zusammenschluss der bis dahin unabhängigen rhodischen Poleis Ialysos, Kamiros und Lindos zu einem gemeinsamen Staatsverband im Jahr 408/7 v. Chr. sowie die kurz darauf folgende Gründung der Stadt Rhodos an der Nordspitze der Insel, die allein über fünf Häfen verfügte. Spätestens gegen Ende des 4. Jhs. v. Chr. umfasste das Territorium von Rhodos auch einige der umliegenden Inseln sowie Gebiete auf dem Festland (die sog. Peraia), die in das Demensystem der Polis einbezogen wurden8. Im Zuge der Eingliederung erhielt die dortige Bevölkerung das rhodische Bürgerrecht. Die Bewohner der neu hinzugetretenen Gebiete blieben keineswegs Bürger ›zweiter Klasse‹, sondern erreichten innerhalb kürzester Zeit bedeutende politische, militärische und kultische Ämter. Hinweise darauf, dass bestimmte Gruppen von der Verleihung des Bürgerrechts ausgenommen wurden, lassen sich den Quellen nicht entnehmen.
Die weiteren Gebietsgewinne, die Rhodos insbesondere nach dem Krieg gegen Antiochos III. im Jahr 188 v. Chr. von römischer Seite zugesprochen wurden, gliederten die Rhodier jedoch nicht in das Polisgebiet ein. Die Bewohner dieser ›unterworfenen Peraia‹ standen zwar in rhodischer Abhängigkeit, blieben aber dauerhaft von der Bürgerschaft ausgeschlossen9. Zwar musste Rhodos bereits 20 Jahre später aufgrund der unklaren Haltung im Perseuskrieg fast die gesamten karischen und lykischen Gebiete wieder abtreten und gleichzeitig die Erklärung von Delos zum Freihandelshafen hinnehmen, doch hatten diese Maßnahmen keine langfristigen Auswirkungen auf die rhodische Wirtschaft10. Im Gegensatz zu anderen Poleis gelang es Rhodos insbesondere im 3. und 2. Jh. v. Chr. stets weitgehend unabhängig zu agieren; maßgeblich dafür war der Umstand, dass ab 323 v. Chr. keine Fremdbesatzungen mehr in der Polis stationiert waren.
Auf zwei weitere Eigenheiten der Polis Rhodos, die bei einer Betrachtung der Nichtbürger eine besondere Berücksichtung finden müssen, sei an dieser Stelle noch hingewiesen: Zum einen ist die differenzierte Binnenstruktur der Polis zu erwähnen. Vor allem die Phylen, aber auch die Demen und ktoinai, bei denen es sich um territoriale Untergliederungen der Demenbezirke handelt, besaßen in verschiedenen Belangen eigene Kompetenzen. Insofern ist auch hinsichtlich der Partizipationsmöglichkeiten der Nichtbürger innerhalb der Polis mit unterschiedlichen Praktiken zu rechnen. Zum anderen stellt das rhodische Vereinswesen einen wesentlichen Untersuchungsbereich für die Einordnung der Nichtbürger dar. Die Vereine führten oftmals Personen von unterschiedlichem rechtlichem und sozialem Status zusammen. Auffälligerweise werden jedoch selbst in Dekreten, die von den Vereinsmitgliedern erlassen wurden, Fremde mit den von der Polis vergebenen Privilegien aufgeführt, obwohl hier die Möglichkeit bestanden hätte, sich von diesen rechtlich-sozialen Bewertungsmaßstäben zu lösen. Vor diesem Hintergrund wird besonders zu überlegen sein, ob bzw. inwieweit sich die Vereine von der Polis als rechtlichem und sozialem Bezugssystem zu lösen vermochten.
Der wesentliche Quellenbestand, der für eine Untersuchung der Fremden auf Rhodos von Bedeutung ist, umfasst mehrheitlich Grabinschriften sowie ferner Dedikationen, Ehreninschriften, Ehrendekrete und Subskriptionslisten. Der Großteil der epigraphischen Quellen datiert in das 2. und 1. Jh. v. Chr.; nur vereinzelte Inschriften stammen aus dem 4. Jh. v. Chr. An dieser Verteilung der Quellen orientiert sich im Wesentlichen auch der Untersuchungszeitraum dieser Arbeit. Bereichert wird das Quellenmaterial durch einige kaiserzeitliche Inschriften, die wichtige Brüche und Kontinuitäten aufzeigen und deshalb für bestimmte Kontexte ebenso zu berücksichtigen sind. Insbesondere die Grabinschriften lassen aber oftmals keine oder allenfalls eine grobe zeitliche Einordnung zu, zumal vielfach ein genauer archäologischer Zusammenhang fehlt.
Auf das umfangreiche, fast ausschließlich epigraphische Quellenmaterial zu den Fremden in Rhodos ist immer wieder verwiesen worden11, ohne dieses allerdings eingehender auszuwerten. Donato MORELLI hat im Jahr 1956 sämtliche bis dahin bekannten Belege für Nichtbürger und Sklaven nach ihrer Herkunft geordnet aufgelistet; Giulia SACCO hat 1980 den Bestand um die entsprechenden Neufunde erweitert. Seitdem sind stetig weitere wichtige Inschriften hinzugekommen12. Was eine detaillierte Beschäftigung mit den rhodischen Inschriften grundsätzlich zu einer zeitraubenden Angelegenheit macht, ist die schwierige Publikationslage: Die von Friedrich HILLER VON GAERTRINGEN edierten Faszikel eins und drei des zwölften Bandes der Inscriptiones Graecae, in denen neben den Inschriften der Insel Rhodos auch diejenigen der sukzessive in das rhodische Polisterritorium eingliederten Nachbarinseln Chalke, Karpathos, Saros, Kasos, Syme, Megiste, Telos und Nisyros enthalten sind, weisen mittlerweile bereits ein Alter von fast 120 Jahren auf. Abgesehen von den lindischen Inschriften, die Christian BLINKENBERG als Ergebnis der dänischen Ausgrabungen in zwei Bänden mit hervorragenden Fotos und Faksimiles versehen im Jahr 1942 vorgelegt hat, verteilen sich die seither veröffentlichten Inschriften auf zahlreiche Publikationsorte13. Insofern stellt die Datenbank des Packard Humanities Institute, die einen Großteil der rhodischen Inschriften vereint, eine wichtige Hilfe dar, um sich einen Überblick über einzelne Fragen zu verschaffen, was aber freilich nicht den Blick in die kritische Edition zu ersetzen vermag14. Hinsichtlich der Datierung der Inschriften ist nun insbesondere die Arbeit von Nathan BADOUD zu berücksichtigen, der für die Feinchronologie wichtige Korrekturen erarbeitet hat15.
Für die vorliegende Arbeit wurden unabhängig von den Listen, die MORELLI und SACCO erstellt haben, sämtliche Quellen in eine Datenbank aufgenommen, aus der eine aktualisierte Namensliste generiert wurde, die hier in Appendix II abgedruckt ist. Der Namensbestand von MORELLI und SACCO konnte damit um rund 500 Namen erweitert werden, was einem Zuwachs von 32 % entspricht. Da der überwiegende Teil der Inschriftenneufunde aus den letzten 30 Jahren, die insbesondere bei den Ausgrabungen der Nekropolen von Rhodos-Stadt zutage getreten sind, noch nicht publiziert ist, kann diese Liste nur einen vorläufigen Charakter haben16. In statistischer Hinsicht hat sich seit der Bestandsaufnahme MORELLIS die Relation der Häufigkeiten nicht substantiell verschoben17. Deutlicher als zuvor tritt jedoch die Dominanz von Personen aus Ephesos hervor18, so wie überhaupt die kleinasiatischen Regionen eine stärkere Präsenz zeigen.
Insgesamt beläuft sich die Zahl der Personen, die durch das Ethnikon eindeutig als Fremde ausgewiesen sind, derzeit auf etwa 1560 19. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass viele Grabinschriften lediglich den Namen des Fremden vermerken. Weiterführende Untersuchungen sind entsprechend nur begrenzt möglich; trotzdem lassen sich in onomastischer Hinsicht wichtige Erkenntnisse gewinnen und – sofern weitere Verwandte genannt werden – Aussagen über das Heiratsverhalten treffen. Da bei den Fremden nur selten die Filiation dem Namen beigefügt ist, sind prosopographische Auswertungen hingegen in vielen Fällen nicht oder nur mit großer Vorsicht vertretbar.
Um bestimmte Phänomene in Rhodos besser einordnen zu können, wurden auch immer wieder Beispiele aus den Poleis der Nachbarregionen herangezogen; insbesondere sind dies Kos, Milet und Iasos. Es wurde bewusst davon Abstand genommen, eine systematische Gegenüberstellung verschiedener Fallbeispiele vorzunehmen, die zwangsläufig zu Lasten einer detaillierten Analyse des rhodischen Befundes gegangen wäre. Dass Rhodos in vielerlei Hinsicht eine...