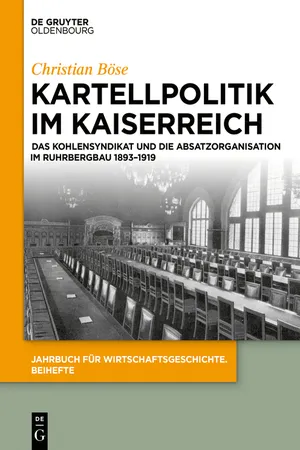1.1Themenaufriss und Fragestellung
Wettbewerbsverzerrungen durch Kartellabsprachen erhalten zumeist eine große mediale Aufmerksamkeit. Zum Jahresbeginn 2014 wurde zum Beispiel bekannt, dass namhafte deutsche Brauereien Preisabsprachen vorgenommen hatten.1 Bereits 2012 waren nach der Aufdeckung eines „Schienenkartells“ große Unternehmen aus der Stahlindustrie mit hohen Strafen belegt worden.2 Rechtliche Sanktionen für beteiligte Unternehmen sind deshalb möglich, weil Kartellabsprachen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem 1958 eingeführten Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), dem sogenannten Kartellgesetz, verboten wurden.3 Auch abseits der rechtlichen Bewertung werden gegenwärtig Preiskonventionen und Mengenabsprachen innerhalb einer Branche unter volkswirtschaftlichen und wirtschaftsethischen Gesichtspunkten mehrheitlich abgelehnt. Dies war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch keineswegs der Fall. Mit Erlass des Kartellgesetzes wurde institutionell eine jahrzehntelange deutsche Tradition beendet, die bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch wirtschaftspolitische Eingriffe der Alliierten massiv zurückgedrängt worden war.4 Bis zum Kriegsende galt das Deutsche Reich als das „klassische Land der Kartelle“5. Die hier vorliegende, wirtschaftshistorische Untersuchung wird daher das Kartellwesen am Beispiel der Verkaufsorganisation im Ruhrkohlenbergbau von den späten 1890er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg in den Blick nehmen.
Kartellvereinigungen entwickelten sich seit dem späten 19. Jahrhundert gerade im Deutschen Reich in nahezu allen Branchen zu einer regulären Form der firmenübergreifenden Kooperation. Der Kartellforscher Friedrich Kleinwächter definierte Kartelle im Jahr 1883 als „Uebereinkommen […] der Unternehmer der nämlichen Branche, deren Zweck dahin geht, die schrankenlose Konkurrenz der Unternehmer unter einander einigermaßen zu beseitigen und die Produktion mehr oder weniger derart zu regeln, dass dieselbe wenigstens annähernd dem Bedarfe angepasst werde, […]“6. Weniger deutlich auf die Produktion fixiert ist dagegen das aktuell gültige Kartellgesetz, das im Paragraphen §1 von „Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse [n] von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte[n] Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, […]“7 spricht. Letztere Definition ist auch für die historische Rückschau deutlich besser geeignet, weil Kartelle in ihrer Blütezeit über unterschiedliche Wege den Wettbewerb beeinflussten. Neben Preisabsprachen als bekannteste Form der Kartellbildung konnte dies ebenso, wie von Kleinwächter dargestellt, über die unternehmensübergreifende Steuerung der Produktionsmengen oder auch durch gemeinschaftliches Vorgehen im Absatz erreicht werden.8
Kartelle wurden im Deutschen Reich durch Gerichtsurteile mehrfach rechtlich legitimiert und in einigen Industriezweigen sogar durch den Gesetzgeber eingefordert. Ein „Zwang“ zu einem solchen Zusammenschluss betraf insbesondere die Grundstoffindustrien, wo im Vergleich zu anderen Branchen eine große Anzahl von Kartellgründungen zu verzeichnen war.9 Die einstige Bedeutung des Kartellwesens in Deutschland ist vielfach kaum mehr bekannt. Noch weniger geläufig ist, dass viele Kartelle, wie schon angedeutet, nicht nur Preis- und Mengenabsprachen vorgenommen, sondern auch die Verkaufstätigkeit der beteiligten Unternehmen zentralisiert und sich damit zur höchsten Kartellform, dem sogenannten Syndikat, zusammengeschlossen hatten. Von den 366 Industriekartellen, die 1906 im Deutschen Reich gezählt wurden, besaßen etwa 200 Vereinigungen eine eigene Verkaufsorganisation.10
Als das prägendste Beispiel einer syndizierten Verkaufsorganisation tritt das 1893 gegründete Rheinisch-Westfälische Kohlen-Syndikat (RWKS) hervor, das in dieser Untersuchung im Mittelpunkt steht. Allein durch seine über 50-jährige Existenz galt es als besonders stabile Organisation, wenngleich deren Fortbestehen seit dem Ersten Weltkrieg durch Gesetzgebungen gesichert werden musste. Der Autor Volkmar Muthesius schrieb zum Jubiläum 1943 von dem „bedeutendste[n] Kartell, das die deutsche Volkswirtschaft je gesehen hat, dieses Gebilde, das in seiner Größe wohl sogar ohne Gegenstück in der ganzen Welt dasteht […].“11 Etwas nüchterner bezeichnete Hans Buschmann das RWKS für dessen „Blütezeit“ vor dem Ersten Weltkrieg als „Musterexemplar eines Kartells“12. Erich Maschke und Julius Flechtheim hoben den Vorbildcharakter des Kohlensyndikats hervor, was dazu führte, dass Maschke das Gründungsjahr 1893 als das „bedeutungsvollste in der Geschichte der deutschen Kartelle“13 bezeichnete.14
Kohle sowie die daraus hergestellten Nebenprodukte wie Koks und Briketts waren bis weit in das 20. Jahrhundert hinein als „Brot der Industrie“ und als Brennstoff in den Haushalten ein unverzichtbares Verbrauchsgut. Für das Jahr 1913 wird die Steinkohlenförderung im Deutschen Reich mit 190 Millionen Tonnen angegeben, von denen fast 115 Millionen Tonnen im Ruhrgebiet gefördert wurden. Knapp 102 Millionen Tonnen dieser Förderung stammten dabei aus Schachtanlagen, die dem Ruhrsyndikat angehörten.15 Diese Zahlen zeigen jedoch auch, dass das RWKS auf den Kohlenmärkten keine Monopolstellung besaß. Bereits im „natürlichen“ Absatzgebiet, also den Regionen, in denen die Ruhrkohle wegen ihrer Transportkostenvorteile keine Konkurrenz aus anderen Fördergebieten zu befürchten hatte, musste sich das Syndikat vor dem Ersten Weltkrieg mit dem Wettbewerb zu nicht-syndizierten Unternehmen auseinandersetzen. Außerhalb des Kernmarkts, auf den sogenannten bestrittenen Absatzrevieren, waren es Kohleproduzenten aus anderen deutschen Förderrevieren und dem Ausland, mit denen die Syndikatszechen um Marktanteile konkurrierten. Hinzu kam seit dem frühen 20. Jahrhundert ein stetiger Bedeutungsgewinn der Braunkohlenförderung in Deutschland, der mit dem Ersten Weltkrieg nochmals zunahm.
Auch das Kohlensyndikat selbst stellte nur auf den ersten Blick ein tatsächlich „geschlossenes Organ“ der Ruhrzechen dar.Während der gesamten Existenz war das Kartell durch zahlreiche Interessengegensätze der beteiligten Unternehmen geprägt, die ohne staatliche Eingriffe mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahr 1915 zur Auflösung geführt hätten. In der historischen Rückschau werden zumeist Streitigkeiten zu produktionspolitischen Fragen genannt, die den Fortbestand des Syndikats mehrfach gefährdet hatten. So sei das Kartell im „Innern“ über viele Jahre hinweg durch Auseinandersetzungen um die sogenannte Beteiligungsziffer geprägt worden, deren Höhe neben der Bestimmung der Produktionsmengen auch an Stimmrechte in den Gremien der Kartellorganisation gekoppelt war.16 Auseinandersetzungen im Syndikatsgefüge, die ihren Ursprung in der gemeinschaftlichen Verkaufspolitik hatten, werden häufig erst für den Zeitraumder 1920er Jahre als schwerwiegende Problemlagen thematisiert. Zwar hatte die zeitgenössische Kartellforschung den seinerzeit oftmals als „Händlerfrage“ titulierten Themenkomplex für den Zeitraum vor dem Ersten Weltkrieg nicht ignoriert, jedoch war sie nur unzureichend auf die Bedeutung der Absatzorganisation für die Funktionsfähigkeit der Kartellorganisation eingegangen.17 Der Grund für die geringe Beachtung war seinerzeit eine stark produktionsorientierte wirtschaftswissenschaftliche Forschung. So war zum Beispiel nach Einschätzung von Ernst Storm die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Ruhrbergbaus bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs mit Hilfe des Kohlensyndikats „weniger durch den Verkauf der Kohlen, […], als dadurch [eingetreten], daß es durch die Festsetzung der Beteiligungsziffern die Förderung so regelte, daß ein gesunder Durchschnittspreis erzielt werden konnte“18.
Die Etablierung einer eigenen Vertriebsorganisation ist ein klares Indiz dafür, dass viele Kartelle der Absatzpolitik schon seinerzeit eine wichtige Funktion beigemessen hatten. Nicht ohne Grund nahm auch das Kohlensyndikat alle Instrumente der Kartellpolitik auf: Neben der Produktionsregulierung, bei der die Förderung der angeschlossenen Zechen durch die Steuerung der Beteiligungsmengen an die Aufnahmefähigkeit der Kohlenmärkte angepasst wurde, war auch die Preispolitik eine zentrale Aufgabe des Syndikats. Bezogen auf die Absatzregulierung stellte das RWKS das zentrale Verkaufsorgan der angeschlossenen Unternehmen dar.19 Im Unterschied zur Produktions- und Preispolitik war allerdings die Übernahme des Vertriebs und die damit verbundene Institutionalisierung einer leistungsstarken und für die Kartellziele wirksamen Absatzorganisation ein deutlich langwierigerer Prozess.
Für eine umfassende Analyse der Absatzorganisation im Ruhrbergbau ist es jedoch zwingend notwendig, eine Kartellorganisation wie das RWKS auch über deren Marktzugangseinrichtungen und unter Berücksichtigung der von ihr bearbeiteten Absatzmärkte zu betrachten. Es gibt zahlreiche Hinweise, dass der Erfolg eines Syndikats ganz entscheidend von den Möglichkeiten des Marktzugangs abhängt. Gerade Kartelle als „hybride Organisationen“20 zwischen Markt und Unternehmen sorgten für eine gewisse „Verschmelzung beider Allokationsmechanismen“21. Produktions- und preisorientierte Perspektiven können dazu keine umfassenden Antworten geben. Schwierigkeiten, welche die Funktionstüchtigkeit einer Kartellorganisation beeinflussten, machten sich nämlich häufig zuerst auf den Absatzmärkten bemerkbar. Der Bergbau bildet dafür ein ideales Beispiel. Überproduktionen und damit verbundene Fördereinschränkungen, die zu einer starken Erhöhung der Selbstkosten führten, waren neben konjunkturellen Einflüssen vor allem ein Problem fehlender Nachfrage, die aus zu kleinen Absatzmärkten oder unzureichend ausgebauten Vertriebskanälen resultierten. Die Konkurrenz durch nicht-syndizierte Betriebe, die von der Existenz eines Kartells profitierten, ohne sich finanziell an dessen Erhalt zu beteiligen, bekam die Kartellorganisation zuerst auf den gemeinsam bearbeiteten Märkten zu spüren. Der Kohlenmarkt war aufgrund von Jahreszeiten und Konjunktureinflüssen zudem stark durch eine schwankende Nachfrage geprägt.
Auch die Preispolitik eines Kartells konnte ohne parallel verlaufende Eingriffe in die Absatzorganisation wirkungslos sein: Die Preisbemessung für Kohleprodukte wurde stark durch Transportfragen, die Konkurrenzsituation am Absatzort, Konjunkturverläufe und die Organisation der Handelswege beeinflusst. Der endgültige Verkaufspreis konnte weder allein von einer zentralen Vertriebsstelle festgelegt noch von dieser bis zum Endabnehmer kontrolliert und durchgesetzt werden.22 Diese Problematik wurde zusätzlich dadurch begünstigt, dass die Ruhrzechen einer sehr heterogenen Abnehmerschaft gegenüberstanden, die durch große Selbstverbraucher aus der Industrie und zunächst noch durch eine hohe Anzahl mächtiger Großhändler als Wiederverkäufer geprägt war.
Das Kohlensyndikat hatte der Bildung einer möglichst effektiven Absatzorganisation aufgrund der Erfahrungen vorangegangener Kartellierungsbestrebungen seit der Gründung im Jahr 1893 hohe Priorität beigemessen. Der zentrale Vertrieb durch ein rechtlich selbstständiges Organ war elementarer Bestandteil des Ruhrsyndikats. Dies sollte möglichst ohne weiteren Einfluss der beteiligten Zechen geschehen, die damit einen wichtigen Teil ihrer unternehmerischen Autonomie abzugeben hatten. Die Integration der Vertriebsorganisation ging jedoch über die Etablierung einer zentralen Verkaufsstelle hinaus. Prägend für die Syndikatspolitik der folgenden Jahre war die zunehmende Einflussnahme auf weitere Absatzstufen, wozu die Bildung von eng an das Syndikat gebundenen Handelsgesellschaften gehörte, die einzelne Absatzgebiete zugewiesen bekamen. Die wichtigste dieser Organisationen war die Rheinische Kohlenhandel- und Rhederei-Gesellschaft mbH, das sogenannte Kohlenkontor, welches nicht nur den Alleinverkauf für das überaus wichtige süddeutsche Verkaufsgebiet, sondern auch die Kohlentransporte über den Rhein kartellierte.23
Die absatzpolitischen Maßnahmen des Kohlensyndikats waren aufwendige Prozesse, die ihre Wirkung nicht verfehlten. So konnte nach Meinung vieler zeitgenössischer Autoren schon kurze Zeit nach der RWKS-Gründung von einer „Beherrschung der Produktion durch den Kohlenhandel“24 keine Rede mehr sein. Vielmehr hätte seit der Bildung des Kohlensyndikats ein Rollenwechsel stattgefunden, so dass der Kohlenhandel für das Kartell nur noch „Mittel zum Zweck“25 war. Maßnahmen zur Absatzpolitik sollten jedoch nicht nur die Marktstellung stärken, sondern gleichzeitig die Kartellorganisation nach innen festigen. Eine Handelssyndizierung stellte aus Sicht von Fritz Blaich die Selbstständigkeit der beteiligten Unternehmen in Frage, da diesen bei einem möglichen Ausscheiden aus dem Kartell eine eigene Vertriebsorganisation fehlte. Damit hätte der gemeinschaftliche Verkauf auch die Funktion eines Bindeglieds zwischen den Syndikatsmitgliedern eingenommen.26
Die Vertriebsintegration schuf jedoch ...