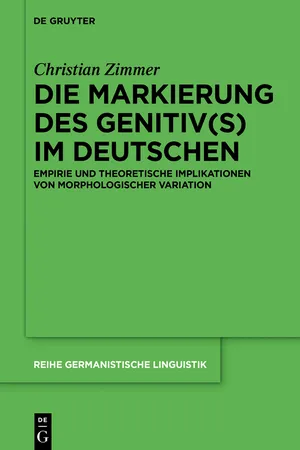1.1Thema, Ziel und Methoden
Im Gegenwartsdeutschen werden starke Maskulina und Neutra in der Regel mit -s oder -es im Genitiv Singular verwendet, während Feminina endungslos bleiben. Allerdings gibt es auch zahlreiche Belege für genitiv-s-los verwendete Nichtfeminina. Solche Belege sind nicht auf ein bestimmtes Register, auf mündliche oder schriftliche Kommunikation und auch nicht auf das Gegenwartsdeutsche begrenzt. Die s-losen Substantive in (1) bis (4) veranschaulichen diesen Befund. Aufgeführt sind hier jeweils ein Beleg aus lektorierter Schriftsprache (1), einem Internetforum (2), mündlicher Kommunikation (3) sowie ein Beleg aus dem 18. Jahrhundert (4).
| (1) | Netzfeminismus, hier muss man kurz ausholen, meint einen „zeitgemäßen“ Feminismus, der sich strategisch der Mittel des Internet zu bedienen weiß. |
| <http://www.zeit.de/kultur/2014-12/feminismus-internet-intellektuelle-essay> |
| (2) | sowohl im Real-Live als auch in den weiten des Internet gibt es nur eine geringe Anzahl Menschen die wirklich wissen wer und was ich bin und wie ich mich wirklich fühle! |
| <http://www.zimtrausch.de/forum-showposts-8757-p1-xquotStreitkulturquot.html> |
| (3) | Der Totalitarismus des Internet besteht nicht aus dem, was wir landläufig darunter verstehen, also Bewusstseinskontrolle und Unterdrückung, sondern in seiner Unausweichlichkeit. |
| Hörbeleg, ARD-Sendung druckfrisch, 01.11.2015, 23:41:54 Uhr |
| (4) | Ueber den Bau, die Feſtigkeit und Bequemlichkeit der Gartenwege, wobey man vorzuͤglich auf die Beſchaffenheit des Klima und des Erdbodens Ruͤckſicht zu nehmen hat, findet man in den Schriften der Gaͤrtnerey hinlaͤnglichen Unterricht. |
| Hirschfeld (1780: 130): Theorie der Gartenkunst, Bd. 21 |
Die Lexeme, die gegenwärtig (auch) genitiv-s-los verwendet werden, unterliegen in aller Regel erheblicher Variation. Nicht selten handelt es sich bei der Flexion dieser Substantive gemäß der Definition von Klein (2003: 7) um echte sprachliche Zweifelsfälle, da kompetente MuttersprachlerInnen darüber in Zweifel geraten, welche der beiden Varianten standardsprachlich korrekt ist – was häufig in intraindividueller Variation resultiert. Das veranschaulichen die Belege in (5) bis (8). Die hier zitierten flexionsmorphologischen Varianten sind jeweils in unmittelbarer Nähe zueinander verwendet worden.
| (5) | Als erster westlicher Politiker traf er dabei auch den neuen Hoffnungsträger des Irak, den zukünftigen Präsidenten Abadi. |
| Hörbeleg, Tagesschau vom 16. August 2014, 20:02:19 Uhr |
| (6) | Eine neue Regierung steht für die vielleicht letzte Chance, den Zerfall des Iraks noch aufzuhalten. |
| Hörbeleg, Tagesschau vom 16. August 2014, 20:02:26 Uhr |
| (7) | Statt des Genitiv wird in diesen Fällen in der Regel die Konstruktion mit von + Substantiv verwendet |
| Wahrig (22009: 323): Richtiges Deutsch leicht gemacht |
| (8) | Statt des Genitivs ist natürlich immer die Konstruktion mit von + Name möglich. |
| Wahrig (22009: 321): Richtiges Deutsch leicht gemacht |
Die Untersuchung dieser flexionsmorphologischen Schwankung zwischen -s und -Ø im Genitiv Singular starker Maskulina und Neutra steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit.2 Dabei werden immer wieder auch andere Schwankungs- und Zweifelsfälle in die Untersuchung einbezogen, um relevante Parallelen und/oder Unterschiede aufzudecken, so z.B. Fremdwortplurale (s. Abschnitt 4.1.2 und 4.1.3), die Variation zwischen -s und -es im Genitiv Singular (s. Abschnitt 4.1.3), die Verwendung von Apostrophen (s. Abschnitt 4.1.1.2) oder die Auslassung des Pluralmarkers bei Kurzwörtern (s. Abschnitt 4.3.2). Auf diese Weise kann aufgezeigt werden, inwiefern viele verschiedene Aspekte gegenwartssprachlicher Variation eng miteinander verwandt und auf identische Motivationen zurückzuführen sind.
Ziel der Arbeit ist es zunächst, eine fundierte empirische Basis zu schaffen und Faktoren zu ermitteln, die die Variation steuern. Auf dieser empirischen Grundlage aufbauend sollen dann verschiedene Erklärungsansätze evaluiert, weiterentwickelt und präzisiert werden. Nicht nur die sprachlichen Fakten sollen also beschrieben werden, sondern auch – soweit es geht – die dahinterstehenden Motivationen und Prinzipien.
Darüber hinaus ist ein wesentlicher Teil der Arbeit nicht nur der Beschreibung und Erklärung der Variation gewidmet, sondern auch der Frage, inwiefern die Analyse des Schwankungsfalls Erkenntnisse hinsichtlich allgemeiner Zusammenhänge und theoretischer Aspekte generieren kann. Es soll also nicht nur etwas über die Variation, sondern auch etwas anhand der Variation ausgesagt werden. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Themenbereiche relevant, die in den entsprechenden Kapiteln im Detail erläutert werden. Dazu zählen das Konzept von Zentrum und Peripherie einer Sprache, das Verhältnis dieser beiden Bereiche und das Phänomen der morphologischen Integration (vgl. Abschnitt 3.1 und 4.1), das grammatische Sonderverhalten von Eigennamen und die dafür verantwortlichen Motivationen (vgl. Abschnitt 4.2) sowie die Relevanzhierarchie (vgl. Abschnitt 4.3.2). Weiterhin ist die untersuchte Variation bedeutsam mit Blick auf das Deklinationsklassensystem des Deutschen. Dies wird hier genutzt, um Vor- und Nachteile verschiedener Flexionsklassendefinitionen zu diskutieren. Schließlich wird auch die Relevanz der Variation hinsichtlich sprachübergreifender Prinzipien wie dem Paradigm Economy Principle und dem No Blur Principle erörtert (vgl. Abschnitt 5.2). In diesen theoretischen Aspekten manifestiert sich ein großer Teil des Erkenntnispotentials der untersuchten Variation.
Darüber hinaus ist die Untersuchung des Phänomens auch aus methodologischer Perspektive aufschlussreich, gerade mit Blick auf den diachronen Aspekt der untersuchten Variation. Bei der Schwankung im Genitiv gilt, was ebenso auch auf die meisten anderen sprachlichen Zweifelsfälle zutrifft: Die synchrone Variation ist hier (auch) auf aktuell ablaufenden Sprachwandel zurückzuführen. Sprachwandel erfolgt nie abrupt, denn eine grammatische Variante löst die andere nie ab, ohne dass es eine Phase gibt, in der beide miteinander konkurrieren. Eine der Varianten setzt sich dabei in der Regel durch, oft sind diese zeitweise aber gleichermaßen akzeptabel und weitestgehend austauschbar. In der daraus resultierenden synchronen Variation wird Sprachwandel dann greifbar, was insofern von besonderem Interesse ist, als die Wandelursachen hier mithilfe eines sehr großen methodischen Repertoires untersucht werden können: Während bei bereits abgeschlossenem Wandel fast ausschließlich (schriftliche) Korpusdaten analysiert werden können, die oft nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, kann man bei der Erforschung aktuell ablaufenden Wandels auf die ganze Brandbreite methodischer Möglichkeiten zurückgreifen. So kann hier auch die Rezeptionsseite von Sprache systematisch berücksichtigt werden, indem z.B. Akzeptabilitätsstudien oder Analysen zur Verarbeitung der Varianten durchgeführt werden. Korpusdaten, auch solche aus diachron ausgerichteten Korpora des Nhd., sind im Vergleich zu historischen Korpora vergangener Sprachstufen wesentlich umfangreicher, besser annotiert und beinhalten unterschiedliche Register. Darüber hinaus ist es möglich, Daten zu elizitieren, mithilfe derer bestimmte besonders relevante Aspekte präzise angesteuert werden können.
Es eröffnen sich also viele Möglichkeiten, wenn man bei der Erforschung von sprachwandelrelevanten Motivationen auch gegenwartssprachliche Variation berücksichtigt. Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit verfolgt. Morphologische Schemakonstanz – ein Konzept, das in Kapitel 3 näher erläutert wird – wirkt sich sowohl auf synchrone als auch auf diachrone Variation (s. hierzu vor allem Abschnitt 4.1) aus und wird auch als relevant mit Blick auf bereits abgeschlossenen Sprachwandel angesehen (vgl. Abschnitt 4.2; s. hierzu auch Ackermann 2018a). Um diese Motivation und deren Einfluss genauer fassen zu können, werden in den folgenden Kapiteln sehr unterschiedliche Arten von Daten herangezogen. Dazu gehören synchrone und diachrone Korpusdaten aus unterschiedlichen Korpora geschriebener Sprache (vgl. Kapitel 2 und 4), psycholinguistische Evidenz aus einer Self-Paced-Reading-Studie (vgl. Abschnitt 3.6), Akzeptabilitätsurteile (ebd.) sowie einige Daten aus mündlichen Korpora (vgl. Abschnitt 2.4.7). Da die Erhebung gewisser Datentypen zur Untersuchung von Variation und Wandel im Geg...