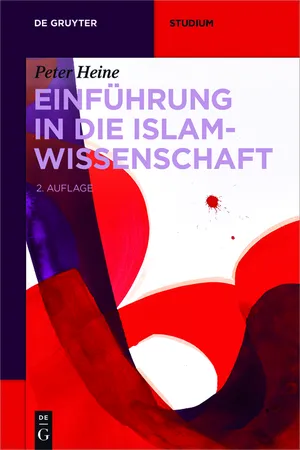
- 222 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Einführung in die Islamwissenschaft
Über dieses Buch
Das Buch bietet einen Überblick über Geschichte und Entwicklung des Islam von den Anfängen zur Weltreligion. Behandelt werden Themen wie Koranauslegungen und Glaubenstraditionen, Rechte und Pflichten der Gläubigen, die Verbreitung des Islam im Abendland, Politik und Religion: Einheit oder Widerspruch? Toleranz oder Terrorismus? Daneben werden Kunst und Architektur untersucht und Aspekte von Kulturtransfer und politischem Austausch beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Einführung in die Islamwissenschaft von Peter Heine im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Islamische Theologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Die Geschichte der Islamwissenschaft

Wilhelm Gentz (1822–1890) stammte aus einer wohlhabenden Familie in Neuruppin. Als Maler bereiste er 1847 Spanien und Marokko, 1850 Ägypten, einige arabische Teil des Osmanischen Reichs und Istanbul. Frucht dieser Reisen ist eine Fülle von Bildern in verschiedenen Techniken mit orientalischen Sujets. Die vorliegende Grafik dokumentiert den Lehrbetrieb, wie man ihn sich an der Azhar-Universität in Kairo in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch vorstellen kann. Der Unterricht und das Studium finden vor allem in den weitläufigen Höfen der Universität, die zugleich Moschee ist, statt. Man erkennt einen Prediger, der von einer Kanzel lebhaft auf seine Zuhörerschaft einwirkt. Davon lässt sich ein Student im Vordergrund nicht ablenken, der in einem Buch, vielleicht dem Koran, liest, das auf einem Ständer ruht. Der Ständer wird als ‚Kursî‘ (Thron) bezeichnet. Jungen Studenten sitzen daneben im Kreis um ihren Dozenten, der stehend vorträgt. In der Bildmitte befindet sich eine Anzahl von jüngeren Gelehrten, die einem bedeutenden Scheich zuhören. Im Hintergrund sieht man eine Gruppe um einen Lehrenden, in dessen Rücken sich eine Säule befindet, an die er sich auch anlehnen kann.
Das folgende Kapitel skizziert die Geschichte der Beschäftigung der westlichen Welt mit dem Islam. Geschildert wird, wie die islamische Welt abwechselnd als Quelle naturwissenschaftlichen und philosophischen Wissens, als Hort von Brutalität und Ausschweifungen, als militärische Bedrohung oder als exotisches Sehnsuchtsland gesehen wurde. In einem zweiten Abschnitt wird die Reaktion der muslimischen Denker auf diese Perspektiven der westlichen Welt beschrieben. Die Begeisterung für die wissenschaftliche Offenheit der westlichen Gelehrten führte zu Versuchen, die eigene Kultur wissenschaftlich aufzuarbeiten. Da diese den Standards der westlichen Welt nicht genügten, entwickelte sich bald eine Überheblichkeit des Westens gegenüber dem Orient, die dann im 20. Jahrhundert auch im Westen stark kritisiert wurde. Schließlich geht es noch um die
Entstehung von universitären Einrichtungen zur Ausbildungen von muslimischen Religionslehrern und Imamen seit dem Beginn des 21. Jahrhundert.
1.1Das mittelalterliche Abendland, der moderne Westen und die islamische Welt
Die akademische Beschäftigung mit der islamischen Welt ist älter als die Islamwissenschaft als Unterrichtsfach, das zum Ende des 19. Jahrhunderts an den deutschen und europäischen Universitäten eingeführt wurde. So lehrte z. B. Jacob Christmann (1554–1613) ab 1609 in Heidelberg Arabisch. Für das mittelalterliche Abendland waren der Islam und die Muslime seit dem Beginn der Begegnung mit diesen Fremden immer ein gewaltiges Problem. Man war es gewohnt, die Welt in Christen und Heiden einzuteilen. Außerdem gab es auch noch die Gruppe der Juden, die man aus der christlichen Perspektive jedoch nicht als Heiden betrachten konnte, da sie als Teil des göttlichen Heilsplanes galten, dessen Existenz im Mittelalter fester Bestandteil der Lehre der Kirche war. Schon im 7. Jahrhundert n. Chr. (also im 1. Jahrhundert islamischer Zeitrechnung) hatte man erkannt, dass auch die Anhänger des Propheten Mohammed nicht in dem Sinne als Heiden bezeichnet werden konnten, wie man das mit den vorchristlichen Anhängern der ägyptischen, römischen oder griechischen Götter tun konnte. Man musste zur Kenntnis nehmen, dass diese Muslime Monotheisten waren, in ihren religiösen Lehren Jesus und seine Mutter Maria eine wichtige Rolle spielten, sie über ein elaboriertes ethisches System verfügten und ein komplexes Rechtssystem kannten. Mit einer sich verbessernden Kenntnis der muslimischen Gedankenwelt und dem Schrifttum, das in der islamischen Welt produziert wurde, wurde die Einschätzung des Islams nicht einfacher.
Die führenden Theologen und Vertreter der politischen Eliten waren sich bewusst darüber, dass man mehr über den Islam und seine Dogmen in Erfahrung bringen müsse, ehe man in eine Erfolg versprechende Auseinandersetzung mit ihnen eintreten könnte. Sie verwendeten für diese neue Religionsgemeinschaft Begriffe wie Mahometanismus etc. und bezeichneten die Anhänger der Religion als Mohammedaner u. Ä. oder Sarazenen. Die Bezeichnung Islam wurde einheitlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendet. Ab diesem Zeitpunkt wurde auch die Bedeutung des Wortes Islam (arabisch für: Ergebung in den Willen Gottes) eine weit verbreitete Erläuterung. Vor allem von Muslimen wird die Verwandtschaft des Wortes Islam mit dem arabischen Wort für Frieden (salâm) betont. Mit dem Begriff Muslim (zunächst eine Partizip Aktiv-Form) bezeichnet man Personen, die sich dem Willen Gottes ergeben. Zwischen islamisch und muslimisch als den entsprechenden Adjektiven wird nicht immer konsequent unterschieden. Korrekt wäre es, mit islamisch ausschließlich auf die Religion bezogene Begriffe zu spezifizieren, während muslimisch sich auf alle religiösen und alltäglichen Handlungen von Muslimen bezieht.
Vor allem auf der Iberischen Halbinsel, auf der Muslime seit dem Jahr 711 Fuß gefasst hatten, kamen abendländische Abenteurer, Söldner, Kaufleute und Gelehrte mit dem Islam in seiner ganzen Vielfalt in Kontakt. In Toledo entwickelte sich z. B. ein lebhafter Austausch zwischen Gelehrten, bei dem die abendländischen Besucher vor allem die Nehmenden waren. Gäste aus allen europäischen Ländern lernten hier Arabisch, um die Gedanken der großen Philosophen und Theologen des Islams, aber auch der muslimischen Naturwissenschaftler und Mediziner mit ihren bahnbrechenden Ideen und Praktiken kennenzulernen und in das Lateinische als die Lingua franca des mittelalterlichen Europa zu übersetzen.
Toledo war der richtige Ort für Petrus Venerabilis (1094–1156), den Abt des französischen Klosters Cluny, um jemanden zu finden, der den Koran aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzen könnte. Denn Petrus Venerabilis war der Meinung, dass man die Anhänger Mohammeds nicht zum Christentum bekehren könne, wenn man zuvor nicht über deren Glaubensüberzeugungen informiert sei. Mit einigem Recht ging er davon aus, dass man dazu viel im heiligen Buch der Muslime, im Koran, finden könne. Er reiste also nach Toledo und beauftragte Robert von Ketton, der sich dort mit der Übertragung von naturwissenschaftlichen Texten aus dem Arabischen ins Lateinische befasste, den Koran gegen ein stattliches Honorar in die Sprache der Intellektuellen des christlichen Abendlands zu übertragen. Die Auseinandersetzung mit dem Koran auf Basis dieser Übersetzung führte zu einer überraschend präzisen Darstellung der grundlegenden Vorstellungen des Islams.
Sehr viel weitere Kenntnisse stammen von Ricoldus de Monte Crucis (1243–1320), einem Dominikaner, der ab 1288 längere Zeit in Bagdad, der Hauptstadt des Abbasidenreiches, verbrachte hatte. Dabei gewann er einen genauen Einblick in die praktische Ausübung der islamischen Religion, die er in einem beeindruckenden Text der Nachwelt vermittelt hat. Er beschrieb Bagdad folgendermaßen:
„Es begab sich also, als ich in Baghdad weilte, […] dass mich die Annehmlichkeiten des Gartens, in dem ich mich befand, entzückten. Denn er war wie das Paradies durch den Reichtum seiner Bäume und die Fruchtbarkeit und Mannigfaltigkeit seiner Früchte. Er war emporgewachsen durch die Quellen des Paradieses, und goldene Häuser wurden auf ihm errichtet. Andererseits ließ mich das Massaker und die Gefangennahme von Christen und ihre Eroberung von Akko in tiefste Trauer verfallen, wenn ich die Freude und den Jubel der Muslime sah und die Christen vernachlässigt und geistig erschüttert. Ich begann noch sorgfältiger als sonst nachzudenken über die Entscheidungen Gottes bezüglich der Herrschaft über die Welt und vor allem über Muslime und Christen.“ (Ricoldus 1997, S. 210)
An anderer Stelle heißt es:
„Von Indien bis in die Gegenden des Westens beherrschen die Muslime in Frieden und ohne Widerstand die herrlichsten Dinge und reichsten Königreiche, in denen es die schönsten irdischen Vergnügen gibt. Dort gibt es Berge von Salz, Springbrunnen von Öl, Manna vom Himmel, die Flüsse des Paradieses, aromatische Gewürze, kostbare Edelsteine, herrliche Weintrauben und köstliche Früchte.“ (Ricoldus 1997, S. 209)
Beide Texte, die Übersetzung des Korans aus dem Arabischen wie die Erfahrungen des florentinischen Dominikaners, wurden von dem großen Reformator des 16. Jahrhunderts, Martin Luther, mit lebhaftem Interesse zur Kenntnis genommen. Er lebte in der Zeit, in der die ‚Türkennot‘‚ also die Angst vor den Angriffen der osmanischen Heere, die Menschen bewegte. So heißt es in einer in Siebenbürgen im Jahr 1661 verbreiteten Flugschrift:
„Der Türk ist komen auff die ban
ach hört wie er thit hausen
lasst niderseblen Weib und Mann
schrecklicher weiß viel tausend
spißt, pfält die Menschen groß und klein
solt das nicht zu erbarmen sein
wem solt darob nicht grausen.“
(Özyurt 1972, S. 22)
Mit der Niederlage der Türken vor Wien 1683 änderte sich die grundsätzliche Einstellung des Abendlands gegenüber dem Islam. Er wurde nun weniger als eine Bedrohung empfunden als vielmehr wegen seiner Exotik geschätzt. Die Oberschicht Europas ließ es sich nicht nehmen‚ sich in orientalischen Gewändern von den bekanntesten Malern der Zeit porträtieren zu lassen. Auch andere Motive der bildenden Kunst stammen aus dem orientalischen Kontext. Dabei lassen sich einige inhaltliche Momente feststellen, die auch schon aus der mittelalterlichen Einschätzung des Islams und der Muslime herrühren. Das erste ist die Vorstellung von der Gewaltbereitschaft und Brutalität des Islams. In zahlreichen europäischen Büchern wurde darauf hingewiesen, dass der Islam den ‚Glaubenskrieg‘ predige und die Religion mit Feuer und Schwert verbreiten wolle (Graf 2008, S. 1–30). Neben dem Gewaltaspekt spielt auch die Frage der Sexualität eine Rolle. Die Tatsache, dass die Scheidung nach islamischem Recht aus der Position des Ehemannes verhältnismäßig einfach bewerkstelligt werden kann und eine unmittelbare oder spätere Wiederverheiratung mit einer anderen Frau gestattet wurde, forderte die mittelalterlichen christlichen Theologen zu heftiger Kritik heraus. Nicht weniger indigniert zeigten sie sich angesichts der Tatsache, dass das islamische Recht einem Mann gestattet, mit vier Frauen gleichzeitig verheiratet zu sein – unter der Bedingung, dass er sie alle gleich behandele.
Diese noch aus den mittelalterlichen Überzeugungen von der Gewalt und der sexuellen Ausschweifung stammenden Vorstellungen vom Islam blieben auch weiterhin tief in dem Bild vom Islam in der deutschen Öffentlichkeit vorhanden. Sie wurden nicht zuletzt durch Übersetzungen von Schriften von englischen oder französischen Literaten und Gelehrten ins Deutsche verstärkt.
Diesen grausamen Bildern vom Islam und vom Orient standen seit der Übersetzung der Märchensammlung Tausendundeine Nacht (1704–1717) aus dem Arabischen von Antoine Galland Orientbilder gegenüber, die ein hohes Maß an Romantisierung der islamischen Welt mit sich gebracht hatten. Dieses romantisierende Moment wurde geprägt durch eine Reihe von Dichtern und Schriftstellern des 19. Jahrhunderts, von denen als erster Johann Wolfgang Goethe genannt werden muss. Er hat sich, wie mit vielen anderen Themen auch, intensiv mit dem Islam befasst und sogar versucht, in die tieferen Geheimnisse der arabischen Sprache einzudringen. Für Goethe war der Orient ein Fluchtpunkt, kein realer Ort, zu dem er sich vor den Erschütterungen der Französischen Revolution zurückzog. In seinem einleitenden Gedicht zum West-östlichen Diwan (1. Auflage 1827) heißt es:
„Nord und West und Süd zersplittern,
Throne bersten, Reiche zittern,
Flüchte du, im reinen Osten
Patriarchenluft zu kosten;
Unter Lieben, Trinken, Singen
Soll dich Chisers Quelle verjüngen.
[…]
Wo sie Väter hoch verehrten,
Jeden fremden Dienst verwehrten;
Will ich freun der Jugendschranke:
Glaube weit, eng der Gedanke,
Wie das Wort so wichtig dort war,
Weil es ein gesprochnes Wort war.“
(Goethe 1994, I, Bd. 3, 1, S. 12)
Zahlreiche deutsche Schriftsteller und Dichter des 19. Jahrhunderts waren vom Orient fasziniert.
Heinrich Heine (1797–1856) hatte wegen seiner jüdischen Herkunft und seiner Konversion zum Christentum ein besonderes Verhältnis zum Islam. In seinen Gedichten über die Muslime Andalusiens nach der Reconquista, verglich er die Lage der Anhänger Muhammads mit der Situation die Lage der Juden seiner Zeit in Deutschland an.
Friedrich Rückert (1788–1866) prägte nicht nur die Dichtung der Romantik, sondern wirkte als Professor in Erlangen und Berlin auch als Orientalist, der wie kaum ein anderer Deutscher Verständnis für die Sprache des Korans und der arabischen Dichtung entwickelte.
Den stärksten Eindruck auf Generationen deutscher Kinder machten die Darstellungen des Orients in den Romanen des Abenteuerschriftstellers Karl May (1842–1912). Ohne Europa schon selbst verlassen zu haben, erdachte er sich nicht nur die farbenfrohen Geschichten über Winnetou und Old Shatterhand, sondern auch solche über den deutschen Orientreisenden Kara Ben Nemsi, die Ende des 19. Jahrhunderts für wahre Reiseberichte gehalten wurden. May stand dem Islam ablehnend gegenüber und erfand immer wieder Muslime, die im Begriff waren, sich dem Christentum zuzuwenden, weil sie es aufgrund des vorbildlichen Verhaltens von Kara Ben Nemsi als die ethisch höher stehende Religion erkannt hatten:
„Was war ich für ein Mann, als du mich kennenlerntest! Ein nach Rache, nach blutiger Vergeltung schnaubender Mensch, ein Anhänger des Islams, der nur sich selbst liebte, seine Feinde haßte und gegen alle anderen Personen nichts als stolze Gleichgültigkeit empfand. Du warst der erste unter allen Leuten, der mich zur Achtung zwang. Darum wünschte ich, ebenso wie Hadschi Halef, unser jetziger Scheich, dass du Mohammedaner werden möchtest; denn wir hatten dir so viel zu verdanken und wollten dir die Himmel gönnen, die wir nur für die Anhänger des Propheten offen glaubten. […] Du lebtest ein Leben, das eine überzeugende Predigt deines Glaubens war. Wir waren deine Begleiter und lebten dies dein Leben mit. Der Inhalt des deinigen war Liebe. Wir lernten diese Liebe kennen und liebten zunächst auch dich. Wir konnten nicht von dir lassen und also auch nicht von ihr. Sie wurde größer und immer mächtiger in uns, sie umfasste dich und nach und nach auch alle, mit denen wir in Berührung kamen. Jetzt umfängt diese unsere Liebe die ganze Erde und alle Menschen, die auf ihr wohnen. Wir haben den Koran vergessen und sind gleichgültig geworden für die Gesetze des Propheten.“ (May 1951, S. 54f.)
Die Form, in der die islamische Welt seit der Erfindung des Films einem breiten Publikum vermittelt wurde, entspricht der Kombination von Grausamkeit und Erotik, wie man sie in der Malerei der sogenannten Orientalisten findet. Auch hier sind der beiden Momente die grundlegenden Kennzeichen des Islams und der Muslime. Dabei spielten hinsichtlich der Filme und der heutigen TV-Produktionen die jeweils aktuellen politischen Verhältnisse eine wichtige Rolle für das Bild. Sind es doch oft dunkelhaarige, schnauzbärtige Protagonisten, die die Rolle des Bösewichts ausfüllen, und in Action-Filmen werden nicht selten Szenen mit sogenannten Bauchtanzdarbietungen gezeigt. Man denke an den James Bond Film Liebesgrüße aus Moskau (1963) oder an den Film Cleopatra mit Elizabeth Taylor und Richard Burton aus dem gleichen Jahr. Inzwischen werden auch bei TV-Pro...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Geschichte der Islamwissenschaft
- 2 Koran und Koranauslegung
- 3 Authentizität oder Fälschung – Die Prophetentraditionen
- 4 Das islamische Recht in Geschichte und Gegenwart
- 5 Orthodoxie und Heterodoxien im Islam
- 6 Gottesfreunde oder Nachahmer des Propheten
- 7 Alltagskultur
- 8 Das Bilderverbot – Übertretungen und kreative Alternativen
- 9 Islam in Deutschland
- 10 Die Stellung der Frau im Islam
- 11 Die islamische Stadt
- 12 Muslimbrüder und Islamische Gesellschaft
- 13 Der neue Jihâd
- 14 Christlich-islamischer Dialog
- 15 Serviceteil
- 16 Anhang
- Personenverzeichnis