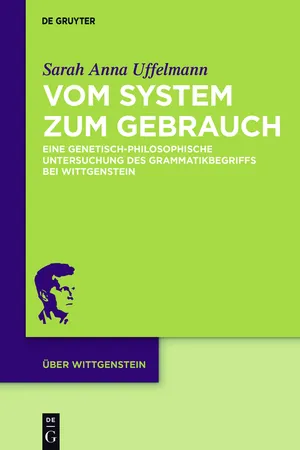
eBook - ePub
Vom System zum Gebrauch
Eine genetisch-philosophische Untersuchung des Grammatikbegriffs bei Wittgenstein
- 249 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Vom System zum Gebrauch
Eine genetisch-philosophische Untersuchung des Grammatikbegriffs bei Wittgenstein
Über dieses Buch
This international series publishes outstanding philosophical monographs and edited volumes about Wittgenstein. Publications may focus on his work as a whole or on specific topics. The series also addresses Wittgenstein's life, his sources, and the impact of his works. The volumes are peer-reviewed and present state-of-the-art Wittgenstein research.
German-language contributions will be published in the series Über Wittgenstein, and English-language contributions in the series On Wittgenstein.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Vom System zum Gebrauch von Sarah Anna Uffelmann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Sprache in der Philosophie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Philosophisch-philologische Betrachtungen von Wittgensteins Grammatikbegriff
1.1Zur Rolle der Grammatik in Wittgensteins Philosophie
Wer davon ausgeht, dass diejenigen Begriffe, die Wittgenstein besonders häufig verwendet und die sich durch sein gesamtes philosophisches Denken ziehen – wie etwa „Sprache“ –, eine zentrale Rolle in seiner Philosophie spielen, wird kaum bestreiten können, dass dem Begriff der Grammatik eine solche Rolle zuzuordnen ist. Gemäß der Bergen Electronic Edition (BEE) verwendet Wittgenstein diesen Begriff in etwa 1487 Bemerkungen auf etwa 1269 Seiten seines Nachlasses.22 Beziehen wir die Derivate von „Grammatik“ mit in die Suche ein, erhalten wir als Ergebnis etwa 2470 Bemerkungen und 2156 Seiten.23 Bereits im TLP stoßen wir auf „Grammatik“.24 Der Begriff häuft sich vor allem in Wittgensteins Texten aus den frühen 30er Jahren. Danach begegnen wir ihm weniger, jedoch oft an entscheidender Stelle. Bis in seine spätesten Manuskripte hinein hat Wittgenstein nicht davon abgelassen, die Grammatik zu behandeln. Er selbst streitet jedoch, zumindest in den frühen 30er Jahren, ab, dass diesem Begriff aufgrund seines häufigen Vorkommens eine bedeutende Rolle in seinen Überlegungen beizumessen sei. In Alice Ambrose’ Notizen zu Wittgensteins Vorlesungen der Jahre 1932/33 lesen wir:
[…] I once thought that certain words could be distinguished according to their philosophical importance: ‘grammar’, ‘logic’, ‘mathematics’. I should like to destroy this appearance of importance. How is it then that in my investigation certain words come up again and again? It is because I am concerned with language, with troubles arising from a particular use of language. The characteristic trouble we are dealing with is due to our using language automatically, without thinking about the rules of grammar.
(AWL 13)
Nicht nur möchte Wittgenstein hier dem Eindruck entgegenwirken, dass dem Begriff der Grammatik – sowie den Begriffen der Logik und der Mathematik – in seinem Denken eine besondere Bedeutung zuzuweisen sei, sondern er möchte ihn sogar zerstören.25 Dies zeigt, dass er sich seines häufigen Gebrauchs von „Grammatik“ durchaus bewusst war. Er wehrt sich jedoch dagegen, den Grund dafür in der Wichtigkeit des Begriffs zu sehen, sondern verweist zur Erklärung auf seinen Ansatz, Probleme zu betrachten, die aufgrund eines unreflektierten Sprachgebrauchs entstehen, welcher die grammatischen Regeln außer Acht lasse. Dieser Ansatz, so scheint er hier sagen zu wollen, zwinge ihn geradezu, bestimmte Worte wiederholt zu gebrauchen. Doch soweit wir Ambrose’ Aufzeichnungen Glauben schenken dürfen, enthält Wittgensteins Begründung für das zahlreiche Vorkommen von „Grammatik“ selbst einen Verweis auf eben diesen Begriff: Das Wort „Grammatik“ erscheint so häufig, weil wir uns der grammatischen Regeln der Sprache bewusst werden sollen, um philosophische Probleme zu vermeiden. Wittgensteins Begründung rückt somit den Begriff der grammatischen Regel ins Zentrum, ohne an dieser Stelle näher auf ihn einzugehen oder ihn gar zu erklären. Damit bleibt die Frage nach der Grammatik weiterhin nicht nur offen, sondern auch zentral, denn Wittgenstein gelingt es offenkundig nicht, ohne Bezug auf die Grammatik die Häufigkeit des Begriffs der Grammatik zu erklären. Im Gegenteil betont er erneut, dass es ihm in seinem philosophischen Ansatz um das Aufzeigen grammatischer Regeln geht – und damit um Grammatik. Dieser Gedanke ist tief in seinem Denken verankert, nicht nur in den frühen 30er Jahren, sondern auch später in den PU („unsere Betrachtung ist daher eine grammatische“ (PU 89)) und noch später in einem seiner letzten Manuskripte, worin er die Frage aufwirft „was ich denn eigentlich will, wieweit ich die Grammatik behandeln will“ (BÜF III 309). Hieraus wird die Zentralität der Grammatik deutlich; die Grammatik spielt eine Schlüsselrolle in Wittgensteins Spätphilosophie26, weil sie untrennbar mit seinem Ansatz und seiner Methode verwoben ist. Genau darin liegt auch die Schwierigkeit,Wittgensteins Grammatikbegriff zu fassen.
Eine genaue Betrachtung von Wittgensteins Verwendungsweise des Begriffs „Grammatik“ lenkt den Blick zunächst auf zwei Probleme. Zum einen gebraucht er den Begriff nicht gemäß unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch, zum anderen ist sein eigener Gebrauch nicht einheitlich. Beides stellt nicht notwendig eine Schwierigkeit dar; in der Philosophie, wie in anderen Disziplinen, ist eine eigene Fachterminologie durchaus üblich, und auch mit unterschiedlichen Verwendungsweisen desselben Begriffs lässt es sich leicht umgehen, wenn das Gemeinte aus dem jeweiligen Kontext klar hervorgeht. In Bezug auf Wittgensteins Philosophie ergeben sich jedoch Schwierigkeiten, die im Folgenden erläutert werden. Dazu werde ich zunächst die herkömmlichen Gebrauchsweisen des Begriffes kurz beleuchten, bevor Wittgensteins eigener Gebrauch von „Grammatik“ ins Zentrum der Untersuchung rückt.
1.2Herkömmliche und historische Gebrauchsweisen
1.2.1Etymologie von „Grammatik“
Etymologisch betrachtet ist das Wort „Grammatik“ dem lateinischen Ausdruck „(ars) grammatica“ entlehnt, was mit „Sprachlehre“ (Kluge 1995: 333) oder auch „Schriftkunde, Elementarlehre der Sprache, Sprachwissenschaft“ (Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (DWB))27 übersetzt wird. Der lateinische Ausdruck geht wiederum auf das griechische „grammatiké (téchne)“ zurück, wobei „grámma“ „Geschriebenes“ oder „Buchstabe“ bedeutet und sich von „gráphein“ (einritzen, schreiben) herleitet (Kluge 1995: 333). Gemäß Heinrich Roos bedeutete Grammatik „ursprünglich die Fertigkeit des Lesens, wurde aber schon früh als ein Wissen von der Sprache verstanden“ (Roos 1974: 846). Als erster (griechischer) Grammatiker gilt ihm zufolge Dionysius Thrax, welcher im 2. Jh. v. Chr. die Grammatik als „die Wissenschaft, welche alle Probleme, die zur vollständigen Interpretation eines literarischen Werkes benötigt werden, behandelt“ (ebd.). Gemäß diesem frühen Grammatikbegriff ist Grammatik also nicht bloß Sprach-, sondern auch Literaturwissenschaft – und zudem empirisch, da sie die Sprache, so wie sie vorliegt, katalogisiert und systematisiert (ebd.). Doch bereits die klassischen römischen Grammatiker Aelius Donatus und Priscian, auf deren Werke man sich auch im Mittelalter bis ins 12. Jahrhundert hinein stützte, fassten Grammatik allein als Sprachwissenschaft auf und verstanden sie als „1. Lehre von den Sprachelementen, 2. Lehre von den acht Redeteilen, 3. Lehre von der Syntax“ (ebd.). Beginnend mit der Rezeption des Aristoteles wurde Grammatik schließlich als „grammatica speculativa“28 umgedeutet und nicht mehr als empirische und normative, sondern als spekulative Wissenschaft verstanden, die sich mit dem Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit befasst. (ebd.: 847 f) Im christlichen Mittelalter war „Grammatik“ zudem der Name der ersten und grundlegenden der Sieben Freien Künste (septem artes liberales)29 und bezeichnete jene Disziplin, die sich mit der Sprache im Allgemeinen und mit dem Spracherlernen beschäftigte (DWB).
1.2.2„Grammatik“ im deutschen Sprachgebrauch
Das DWB unterscheidet vier Bedeutungsfelder von Grammatik, nämlich erstens Grammatik als (mittelalterliche) Disziplin, zweitens als „die einer Sprache zugrundeliegende formale Struktur, die Summe und das System der in ihr sich ausdrückenden und auswirkenden Regeln, Gesetze und Ordnungsprinzipien; ebenso deren Kenntnis und Anwendung“, drittens als Buch und viertens als Grammatik im metaphorischen, bildlichen Sinne (DWB). Die zweite dieser Definitionen enthält verschiedene Bedeutungen von „Grammatik“ – zum einen Grammatik als formale Struktur, zum anderen als Summe von Regeln und letztlich als Kenntnis und Anwendung einer Sprache. Die vierte Bedeutung wird u. a. deutlich in Johann Christoph Adelungs Charakterisierung von Grammatik als „die Kunst, eine Sprache richtig zu reden und zu schreiben; die Sprachkunst“ aus dem Jahr 1811 (DWB). Der Begriff der Grammatik umfasst der Grimmschen Definition zufolge also Struktur, Regeln und Anwendung von Sprache. Dabei wird mit dem Begriff der Regel der normative Charakter von Grammatik hervorgehoben: der richtige Sprachgebrauch folgt grammatischen Regeln, bezogen sowohl auf einzelne Fälle als auch auf die gesamte Praxis des Sprechens (DWB).30
In der Bedeutung von Grammatik als Buch unterscheidet das DWB zwischen Büchern mit normativen und solchen mit historischen Darstellungen von Sprache bzw. Sprachsystemen und verweist auch auf die rein gegenständliche Verwendung von „Grammatik“ als Buch (DWB). Der übertragene, bildliche Gebrauch von Grammatik komme ferner lediglich vereinzelt vor, so etwa bei Karl Ludwig Börne, Johann Gottfried Herder („dies sagt Luther von der Grammatik der Worte, und noch mehr ließe es sich von der Grammatik der Gedanken, der Philosophie, sagen“ (1878: 472)) oder Novalis (DWB).
Heutzutage ist uns der Begriff der Grammatik aus der Linguistik und dem Alltagsgebrauch bekannt. Im Gegensatz zum DWB, das, wie wir gesehen haben, vier Bedeutungen von „Grammatik“ unterscheidet – Disziplin, formale Struktur und Regelwerk, Buch, Metapher –, führt der Duden lediglich zwei Bedeutungen an. Das Historische Wörterbuch für Philosophie unterscheidet ebenfalls zwischen zwei Bedeutungen, nämlich zwischen einerseits Grammatik als wissenschaftliche Analyse einer Sprache, welche sich wiederum in Morphologie und Syntax untergliedert und die seit der neueren Sprachwissenschaft, d. h. ab dem beginnenden 19. Jahrhundert, neben Phonologie und Semantik steht, und andererseits Grammatik als Struktur dieser Sprache (Schmidt 1974: 852). Eine solche Auffassung von Grammatik als Lehre bzw. Disziplin und Grammatik als Sprachstruktur könne ferner sowohl für die Umgangssprache als auch für den sprachwissenschaftlichen Kontext gelten (ebd.).
Sowohl der Duden als auch das Historische Wörterbuch und das DWB führen die Bedeutung von „Grammatik“ als Sprachlehre an. Das Historische Wörterbuch lässt den Gebrauch von „Grammatik“ als Buch unberücksichtigt – was nicht verwundert, denn den Alltagsgebrauch der Wörter zu erklären, gehört nicht zu seinem Aufgabenbereich – und der Duden erwähnt nicht den Gebrauch von „Grammatik“ als Struktur der Sprache. Das DWB enthält hingegen alle drei Bedeutungen und verweist zusätzlich, wie wir gesehen haben, auf sowohl Grammatik als mittelalterliche Disziplin als auch den bildlichen Gebrauch von „Grammatik“.
Wenn wir im Alltag von „Grammatik“ sprechen, denken wir tatsächlich meist an die Grammatik, wie sie uns in der Schule begegnet, nämlich als die – in Büchern dargestellte – Lehre von Satzbau, Flexion, Wortarten etc., dh. als Lehre von Syntax und Morphologie. Wir sagen z. B., dass wir die Grammatik einer fremden Sprache, die wir erlernen, noch nicht vollständig beherrschen, weil wir etwa noch nicht alle Bildungsarten für die Verben im Imperfekt kennen. Oder wir nennen es einen „grammatischen Fehler“ – einen Fehler des Satzbaus, der Syntax –, wenn jemand sagt: „Es sein bald Frühling.“ Um zu überprüfen, ob ein Satz den Regeln der Grammatik als Lehre oder Struktur entspricht, sehen wir in der Grammatik im Sinne eines Buches nach. Die Bedeutungen von „Grammatik“ als Sprachlehre, Sprachstruktur und Buch (über Sprachlehre bzw. Sprachstruktur) sind uns also wohl vertraut. Es ist jedoch wic...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- Vorwort
- Danksagung
- Prolog
- Einleitung
- 1 Philosophisch-philologische Betrachtungen von Wittgensteins Grammatikbegriff
- 2 Von der Logik zur Grammatik: Logisch-philosophische Abhandlung und Bemerkungen 1929/30
- 3 Vom Allgemeinen zum Besonderen: Big Typescript und Brown Book
- 4 Die Philosophischen Untersuchungen und Wittgensteins späte Manuskripte
- Epilog
- Literaturverzeichnis
- Personenindex
- Sachindex