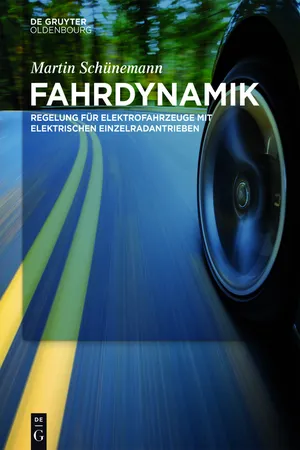
- 224 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Mit dem Einsatz innovativer Technik gewinnt das Elektrofahrzeug an Bedeutung für ambitionierte Klimaschutzziele. Das Buch zeigt ein dreigliedriges hierarchisches Konzept zur Fahrdynamikregelung für Elektrofahrzeuge mit Einzelradantrieben. Die Nutzung der auf den drei Ebenen (Fahrer, Einzelrad, Gesamtfahrzeug) gewonnenen Daten erlaubt eine hochdynamische, präzise und energieeffziente Regelung der Fahrzeugdynamik.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Fahrdynamik von Martin Schünemann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Technik & Maschinenbau & Künstliche Intelligenz (KI) & Semantik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Einleitung
Die Elektromobilität wird für den Individualverkehr im privaten und gewerblichen Sektor als eine der Schlüsseltechnologien zum Erreichen der von Politik und Gesellschaft formulierten ambitionierten Klimaschutzziele gesehen. Insbesondere die Vorteile der lokalen Emissionsfreiheit werden zwar kontrovers diskutiert, würden aber erheblich zur Verbesserung der Luftqualität in urbanen Regionen und Stadtzentren beitragen. Mit Hilfe strenger Reglementierungen zum Schadstoffausstoß, beispielsweise in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und manchen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika, sollten Anreize zur Entwicklung und Vermarktung von Fahrzeugen mit Plug-In-Hybrid oder reinem Elektroantrieb innerhalb der Fahrzeugflotte der Automobilhersteller gegeben werden. Um die bezüglich konventioneller Antriebe derzeit höheren Anschaffungskosten dieser Fahrzeuge für den Käufer zu kompensieren, werden zusätzlich auf nationaler Ebene, mittlerweile auch in Deutschland, Kaufprämien ausgezahlt und Steuerermäßigungen ausgesprochen. Trotzdem liegen die bisherigen Verkaufszahlen hinter den Erwartungen der Politik zurück, was hauptsächlich auf die geringe elektrische Reichweite der Fahrzeuge sowie offene Fragen zur Ladeinfrastruktur und der damit verbundenen geringen Käuferakzeptanz zurückzuführen ist. Deshalb ist die Traktionsbatterie ein wichtiger Forschungs- und Entwicklungsbereich der Elektrofahrzeuge, der von Grundlagenforschung neuer Zelltechnologien bis zur Systementwicklung und Produktionstechnik reicht. Im Gegensatz dazu ist die Entwicklung von elektrischen Maschinen sowie der zu deren Ansteuerung benötigte Leistungselektronik vergleichsweise weit vorrangeschritten und lässt sich an die gestellten Anforderungen eines automotiven Einsatzbereichs anpassen.
Die Vorzüge der Elektroantriebe sind der hohe Wirkungsgrad bei guten Leistungskennwerten sowie die geringe Geräuschentwicklung. Darüber hinaus eröffnen die Eigenschaften der elektrischen Antriebe neue Möglichkeiten zur Gestaltung des Antriebsstrangs und folglich auch der Fahrgastzelle. Neben achsweisen Antrieben ermöglichen vor allem Einzelradantriebe die Umsetzung von Fahrdynamikregelungen, die mit höherer Dynamik und Präzision bei gleichzeitig weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen bremsbasierten Systemen arbeiten. Aus diesem Grund rückt die Entwicklung leistungsfähiger Radnabenmotoren und deren Einbindung in die sicherheits- und komfortorientierte Regelung der Fahrzeugdynamik immer mehr in den Fokus von Wirtschaft und Wissenschaft. Aktuelle in Serienfahrzeugen eingesetzte Systeme zur Regelung der Fahrdynamik wurden für Fahrzeuge mit konventionellen Antriebssystemen mit einem Zentralmotor entwickelt, sodass radindividuelle Eingriffe ohne zusätzliche komplexe (elektro/hydro-)mechanische Komponenten zur Leistungsverteilung nur durch das Bremssystem realisiert werden können. Die Verwendung elektrischer Einzelradantriebe ist im Gegensatz zu dem Einsatz der Bremse weitaus weniger verlustbehaftet, verschleißfrei und ermöglicht das radindividuelle Aufbringen sowohl positiver als auch negativer Drehmomente. Hierdurch ergeben sich mehr Freiheitsgrade bei der Umsetzung der Regelungsaufgabe (Stellgrößenverteilung, Energieeffizenz,...) und unter Verwendung der für den Betrieb der elektrischen Maschine ohnehin notwendigen Sensoren neue Ansätze zur Fahrzustandsschätzung (Quergeschwindigkeit, Radschlupf, Reifenkraft,...). Mit einer erweiterten und genaueren Schätzung fahrdynamischer Kenngrößen können die Genauigkeit und die Effizienz des Regeleingriffs weiter gesteigert werden.
1.1Etablierte und konzeptionelle Fahrdynamikregelsysteme
In Folge der stetigen Zunahme der Verkehrsdichte sowie der Entwicklung von Kraftfahrzeugen mit immer leistungsfähigeren Antriebssystemen entstehen im alltäglichen Straßenverkehr weitaus häufiger kritische Fahrsituationen, in denen zum Beispiel Notbremsungen oder unplanmäßige Ausweichmanöver notwendig werden. In diesen Situationen reagiert ein gewöhnlicher Fahrer zumeist mit zu hohen Lenkrad- und Gaspedal- beziehungsweise Bremspedalbetätigungen, die zur Instabilität des Fahrzeuges führen [31, 65]. Das Fahrzeug reagiert dann beispielsweise durch Über- oder Untersteuern nicht mehr wie gewohnt auf weitere Eingriffe des Fahrers. Um die Stabilität des Fahrzeuges auch in kritischen Fahrsituationen zu erhalten, wurden seit Anfang der 1970er Jahre Fahrdynamikregelungen entwickelt. Insbesondere die serienmäßigen Einführungen des Anti-Blockier-Systems nach 1978 und des Elektronischen Stabilitätsprogramms nach 1995 tragen zu einem stetigen Abfall der Todesfälle trotz höherer Unfallzahlen in Folge der steigenden Verkehrsdichte bei, wie die Grafik in Abbildung 1.1 verdeutlicht.

Im Folgenden werden die Struktur und die Funktionalität heute gängiger Fahrdynamikregelungen Anti-Blockier-System, Antriebsschlupfregelung und Elektronisches Stabilitätsprogramm erläutert. Darüber hinaus werden Ansätze zu integrierten Fahrdynamikregelungen vorgestellt, die diese klassischen Regelsysteme mit modernen Lenkungs- und Fahrwerksregelungen vereinen. Durch den verbreiteten Einsatz konventioneller Antriebssysteme mit Zentralmotor werden radindividuelle Eingriffe zur Fahrdynamikregelung mittels mechanischer Bremse umgesetzt. Im Gegensatz dazu bieten elektrische Einzelradantriebe mehr Freiheitsgrade zur Fahrdynamikregelung, auf deren bestehende Konzepte am Schluss dieses Abschnitts eingegangen wird.
1.1.1Anti-Blockier-System
Seit der Entwicklung des ersten in Serienfahrzeugen eingesetzten Anti-Blockier-Systems (ABS) der Firma Bosch im Jahre 1978 erfolgten durch verbesserte Fertigungstechnik und hochintegrierte Elektronikbauteile weitreichende Weiterentwicklungen der Systemkomponenten und Funktionen [31]. Das Ziel des ABS ist es, bei sehr starken Bremsungen ein Überschreiten des kritischen Schlupfes am Rad zu vermeiden. Dies würde für die Reibpaarung von Reifen und Fahrbahn den Übergang von der Haftreibung in die Gleitreibung entsprechen, in der die übertragbare Kraft abnimmt und schließlich das Rad blockiert. Daraus resultieren längere Bremswege und der Verlust der Fahrzeugstabilität und Lenkbarkeit, da die für die Spurführung des Fahrzeuges benötigten Seitenkräfte nicht mehr realisiert werden können oder gar ein Reifenplatzer auf Grund der Überbeanspruchung des Reifens auftritt. In der ursprünglichen Funktionsausprägung wurde das ABS mittels Steuerung des Bremsdrucks in Abhängigkeit der Umfangsgeschwindigkeit sowie der Winkelbeschleunigung des Rades realisiert. Zur Ausnutzung des maximalen Kraftschlusspotenzials wird in neueren Ausführungen des ABS mit Hilfe einer unterlagerten Bremsdruckregelung der Umfangsschlupf an jedem Rad auf den Wert des kritischen Schlupfes geregelt [31, 65, 92]. Dazu müssen mittels Beobachter die Werte für die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Radwinkelbeschleunigung und den Umfangsschlupf am Rad geschätzt werden, wie Abbildung 1.2 verdeutlicht. Der Sollwertrechner detektiert das Erreichen des kritischen Schlupfes und gibt den entsprechenden Sollschlupf an den Bremsschlupfregler weiter, welcher die Sollwerte der Bremsdrücke an den jeweiligen Rädern ermittelt. Den detaillierten Ablauf eines ABS-Regelzyklus sowie die Beschreibung der eingesetzten Aktoren und Sensoren kann [26, 31, 65, 92] entnommen werden. In neueren Fahrzeugen übliche elektrohydraulische Bremssysteme setzen mit Hilfe von Pumpen und Proportionalventilen die angeforderten Bremsdrücke unter Berücksichtigung der Vorgaben des Fahrers und der ABS-Regelung radindividuell um, wobei der Fahrer lediglich einen Pedalgefühlssimulator betätigt und aus der Bremsdruckregelung teilweise entkoppelt werden kann [26, 31]. Gleichzeitig erlauben elektrohydraulische Bremssysteme einen ABS-Regelzyklus mit bis zu 12 Hz umzusetzen, wodurch eine Schlupfregelung erst ermöglicht wird, da konventionelle Bremssysteme lediglich Abtastraten von 2-3 Hz erreichen [31]. Neben der beschriebenen Grundfunktion des ABS werden heutzutage weitere Funktionen zur Erhaltung der Fahrzeugstabilität während des Bremsvorgangs umgesetzt, die die Spurführung und Lenkbarkeit des Fahrzeuges erhalten beziehungsweise ein Über- oder Untersteuern verringern. Die Verzögerung des Giermomentaufbaus [92] beziehungsweise eine Gierratenkompensation sind hier als Funktionen des ABSplus [5] zu nennen und stellen eine Vorstufe des Elektronischen Stabilitätsprogramms dar.

Die Funktion einer radindividuellen Bremsschlupfregelung des ABS wird in weiteren Fahrdynamikregelungen, wie Antriebsschlupfregelung und Elektronisches Stabilitätsprogramm eingesetzt, da sie in konventionellen Antriebssystemen mit Zentralmotor einen radindividuellen Stelleingriff erst ermöglicht. Allerdings stellt die Bremse ein stark nichtlineares und verschleißbehaftetes Stellglied dar, welches die überschüssige Antriebsleistung in ungenutzte Wärme umwandelt. Hierdurch wird eine präzise Regelung der Bremsmomente am Rad verhindert und somit die Genauigkeit der Schlupfregelung reduziert. Elektrische Einzelradantriebe bieten hier Möglichkeiten durch kooperative Bremseingriffe eine hochgenaue, in Grenzen lineare Erzeugung eines Bremsmoments am Rad zu realisieren und gleichzeitig einen Teil der kinetischen Energie zurück zu gewinnen [70].
1.1.2Antriebsschlupfregelung
Die Entwicklung neuer Technologien in der Motoren- und Antriebstechnik, beispielsweise die Turboaufladung bei Verbrennungsmotoren, werden mittlerweile auch in Fahrzeugen der Kompakt- und Mittelklasse eingesetzt und steigern durch eine erhöhte Antriebsleistung das Beschleunigungsvermögen des Fahrzeuges. Folglich entstehen nicht nur im Brems-, sondern auch im Antriebsfall trotz guter Straßenverhältnisse häufiger kritische Fahrsituationen, in denen es zum Durchdrehen der Antriebsräder bei Überschreiten des kritischen Schlupfes kommt. Wie im Bremsfall kann dies zu einem instabilen Fahrzeugverhalten führen, was den Fahrer überfordern und zu Fehlreaktionen verleiten kann [65]. Die 1987 durch die Firma Bosch entwickelte Antriebsschlupfregelung (ASR) stellt eine konsequente Erweiterung des ABS auf den Antriebsfall dar und verhindert das Durchdrehen der Räder durch zu hohe Antriebsmomente, zum Beispiel bei Beschleunigungen auf glatter Fahrbahn oder beim Anfahren am Berg [31, 65]. Auf Grund der hohen Trägheit des eingekuppelten Antriebsstranges ist eine Regelung des Antriebsschlupfes auch bei längeren Regelzyklen möglich, sodass die Traktion...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort
- Inhalt
- Abkürzungen und Symbole
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 3 Fahrdynamikregelung mit elektrischen Einzelradantrieben
- 4 Beobachtung und Bewertung des Fahrzustandes
- 5 Fahrdynamikregelung
- Anhang A: Analyse der Gierdynamik des linearen Einspurmodells
- Anhang B: Herleitung der Modellgleichungen des ebenen Zweispurmodells
- Anhang C: Auslegung des Reifenlängsschlupf-Reglers
- Anhang D: Auslegung des Fahrzeuggierraten-Reglers
- Literatur
- Stichwortverzeichnis