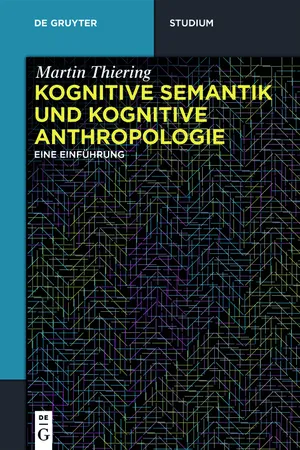1Einleitung und Setzung der Themen: Vorhang auf!
Die Leser*innen, die sich diese Einführung in die Kognitive Semantik und Kognitive Anthropologie herausgesucht ausgesucht und aufgeschlagen haben, erwarten sicherlich einige Bemerkungen zu der Frage, weshalb diese zwei Themenfelder hier zusammengebracht werden. Diese Bemerkungen sollen dieser Einleitung in der Tat vorangestellt werden. Es wird hiermit dazu eingeladen, durch die unterschiedlichen interdisziplinär ausgerichteten Forschungsrichtungen zwei recht neue Forschungsansätze kennenzulernen, zu erweitern und eben (wieder) zusammenzubringen.1 Ebenso sollen Denkanstöße gegeben und kritische Überlegungen zum Verhältnis von Kultur2, Sprache und Kognition präsentiert werden, die einige verbreitete Vorannahmen zu diesem Verhältnis in Frage stellen.3 Dabei steht grundsätzlich die Frage nach Universalien und Kulturspezifika in der Raumlinguistik und Raumkognition im Vordergrund.
Grundsätzlich liegt der Fokus in der Kognitiven Linguistik auf Fragen nach allgemeingültigen, universalen kognitiven Prinzipien bzw. kulturspezifischen Ausprägungen kognitiver Phänomene, die in der Kognitiven Semantik verhandelt werden. Sprache wird in dieser Einführung dementsprechend nicht isoliert betrachtet und verstanden, sondern im Zusammenhang mit weiteren kognitiven Prozessen im Wechselspiel mit der Umwelt.
Dieser Band ergänzt Einführungswerke wie Schwarz-Friesels Einführung in die kognitive Linguistik (2008) oder Wolfgang Wildgens Einführung in die kognitive Grammatik (2012) vor allem in zweierlei Hinsicht: Leser*innen sollen nicht nur die wesentlichen Aspekte der nordamerikanisch geprägten Kognitiven Semantik näher gebracht werden, sondern durch die Beschäftigung mit der Kognitiven Anthropologie auch dazu angeregt werden, den Blick über das rein Mentale bzw. Kognitive hinaus auf das situierte Handeln von Menschen im Raum zu erweitern.4 Dies setzt besonderes Interesse an interdisziplinärer Arbeit und ebenso ein wenig Geduld im Umgang mit den unterschiedlichen, teils recht abstrakten Theorien, Heuristiken und Modellen voraus.
Zugleich möchte dieses Studienbuch eine Gebrauchsanleitung zu kognitiv-semantischen Analysen bieten. Durch die Einbeziehung wahrnehmungs- und verkörperungstheoretischer Ansätze wird dabei dem Subjekt als zentralem Akteur aller Bedeutungszuweisung eine fundamentale Rolle zugewiesen. Dabei wird der Aufbau der Einzelkapitel nicht nur zu einer fundierten und forschungsaktuellen Einführung hinleiten, sondern auch zu einer Neuausrichtung der Kognitionswissenschaften, zu denen die Kognitive Semantik und Kognitive Anthropologie zählen. Nach dem forschungstheoretischen Hintergrund sollen die Leser*innen einen interdisziplinären Einblick in ausgewählte kognitive Strukturen und Bereiche und ihre sprachlichen Manifestationen erhalten haben, die sich anhand unterschiedlicher Wissenssysteme und Praktiken zeigen lassen. Diese sind primär sprachlich, aber eben auch handlungsbasiert und abhängig von umweltspezifischen Faktoren – den sogenannten affordances von Objekten.5
Als Ausgangspunkt und exemplarischen Untersuchungsgegenstand nimmt dieses Studienbuch die Navigation und Orientierung im Raum.6 Dies bietet sich nicht nur deshalb an, weil die aktuelle Forschung zur Frage des Einflusses von Sprache auf Kognition verstärkt den Fokus auf Raumkognition setzt, sondern auch, weil die Anfänge der nordamerikanisch geprägten Kognitiven Semantik und der Kognitiven Linguistik generell von wahrnehmungstheoretischen Ansätzen des frühen 20. Jahrhunderts ausgehen. Ebenso spielt in der Kognitiven Anthropologie der n-Raum eine wesentliche Rolle, also die Idee, dass es unterschiedliche Räume gibt (z.B. sprachliche, mentale, historische, mathematische; siehe Thiering 2015 und Blomberg & Thiering 2016 zu n-Räumen).
Nun zum Titel, der die Kognitive Semantik und Kognitive Anthropologie zusammenbringt. Kognition wird hier verstanden als die Gesamtheit sämtlicher geistiger (mentaler) Prozesse. Dazu zählen unter anderem:
a)die Wahrnehmung (visuell, taktil, auditiv, olfaktorisch oder sensitiv),
b)das Problemlösen (siehe hierzu das Kapitel zu mentalen Modellen; beispielhaft sei hier bereits auf das Turm-von-Hanoi-Problem oder Bouldern hingewiesen, dazu später mehr),
c)die Verarbeitung und die Speicherung von Informationen,
d)der Abruf von Informationen, der Kategorisierung der außersprachlichen Welt etc.
e)das Erinnern und Antizipieren von Ereignissen.
Mit Bezug auf die Sprache zählen zur Kognition außerdem:
f)die Sprachproduktion (der Übergang eines Gedankens zu sprachlichen Lauten) und damit die Anwendung korrekter phonologischer, morphologischer, syntaktischer, semantischer und pragmatischer Regeln,
g)die Sprachrezeption (die Übergang und Einordnung von etwas Gesagtem und die Fähigkeit, darauf adäquat zu antworten),
h)der Spracherwerb (der Erwerb eines oder auch mehrerer Sprachsysteme)
Dieser Katalog zeigt bereits die zu verhandelnde Vielschichtigkeit des Themas und damit zugleich die Grenzen dieses Studienbuchs auf, da die verschiedenen Dimensionen und Facetten dieses Themas nur ansatzweise diskutiert werden können. Der Fokus liegt exemplarisch auf der Frage nach dem grundsätzlichen Zusammenhang von Kultur, Sprache und Kognition im Rahmen von Raumwahrnehmung und Raumkonstruktion. Der Zusammenhang von Kultur, Sprache und Kognition kann, wie der Ethnolinguist (cultural linguist) Farzad Sharifian zutreffend schreibt, als „[o]ne of the most important and at the same time challenging questions facing anthropological linguists“ (Sharifian 2015: 488) angesehen werden. In dieser Einleitung wird der Versuch unternommen, diesem Dreiklang im Kontext der Raumkognition nachzuspüren.
Es sei betont, dass kognitive Prozesse hier nicht als nur ergebnisorientiert behandelt werden sollen. Zum Beispiel sind sie nicht nur auf Problemlöseprozesse zu reduzieren, sondern implizieren die Kategorisierungen oder auch das (Ein)Ordnen der Welt bzw. Weltansichten (Wilhelm von Humboldt; zu Humboldts Weltansichten siehe insbesondere Heeschen 1977, 2014; Wagner 2001). Der Begriff der Kategorisierung – hier verstanden als ein aktiver Akt der Bedeutungswerdung und -verhandlung oder Sinngebung – wirft folgende Fragen auf:
a)Wie und mit welchen Mitteln kategorisieren Menschen ihre Umwelt?
b)Wie wird diese Umwelt sinnvoll strukturiert und repräsentiert?
c)Welcher Ausschnitt der jeweiligen Umwelt wird in den Fokus genommen?
d)Wie interagieren die unterschiedlichen Informationssysteme?
e)Welche Funktion haben Sprachen und Sprechen in diesen Kategorisierungsprozessen?
Die Grundidee dieses Studienbuches ist der Begriff der Kultur, da Sprache und Denken immer in einem historisch spezifischen Kontext praktiziert werden. Deshalb ist es auch richtig, den Begriff der Kognition der Kultur voranzustellen. Das Konzept der kulturellen Kognition (cultural cognition) wird im folgenden Zitat von Sharifian vorgestellt:
Cultural cognition embraces the cultural knowledge that emerges from the interactions between members of a cultural group across time and space. […] In other words, cultural cognition is the cognition that results from the interactions between parts of the system (the members of a group) which is more than the sum of its parts (more than the sum of the cognitions of the individual members). Like all emergent systems, cultural cognition is dynamic in that it is constantly being negotiated and renegotiated within and across the generations of the relevant cultural group, as well as through the contact that members of that group have with other cultures. Language is a central aspect of cultural cognition as it serves […] as a ‚collective memory bank‘ of the cultural cognition of a group. Many aspects of language are shaped by the cultural cognition that prevailed at earlier stages in the history of a speech community. Historical cultural practices leave traces in current linguistic practice, some of which are in fossilised forms that may no longer be analysable. In this sense language can be viewed as storing and communicating cultural cognition. In other words language acts both as a memory bank and a fluid vehicle for the (re-)transmission of cultural cognition and its component parts or cultural conceptualisations […]. (Sharifian 2015: 476–477; Hervorhebung im Original)
Sharifian hebt hervor, dass kulturelle Kognition ein Resultat der Interaktion zwischen sozialen Systemen oder Teilen von Systemen ist. Kulturelle Kognition ist inhärent dynamisch, verändert sich ständig und muss immerzu neu verhandelt werden.
Damit erfüllt Sprache eine wesentliche und konstitutive Funktion bei der Bedeutungsgenerierung.7
In der Linguistik wird Sprache synchron analysiert, aber – um hier noch einmal einen Ausschnitt aus dem obigen Zitat zu wiederholen – „[h]istorical cultural practices leave traces in current linguistic practice […]. In this sense language can be viewed as storing and communicating cultural cognition.“ In der Sprache finden sich Spuren (traces) kultureller Praktiken, diese verweisen wiederum auf vergangenes Wissen und Wissensformen. Damit wird Sprache hier als panchron (diachron [historisch] + synchron [aktuell] = panchron) betrachtet, also als Produkt des Zusammenspiels historischer und aktueller Faktoren.
Sprache ist also wesentlicher Bestandteil der cultural cognition. Dabei werden kulturelle Praktiken und sprachliche Praktiken, in welchen Erstere, wie Sharifian feststellt, Spuren hinterlassen haben, in diesem Studienbuch gemeinsam als semiotische Praktiken verstanden.8 Diese sprachlichen Praktiken bestehen dabei aus einem Netz, „das über die Wirklichkeit geworfen wird; die Maschen dieses Netzes sind nicht in allen Sprachgemeinschaften […] gleich groß und verlaufen nicht überall gleich“ (Pelz 1984: 35).
Die Sprache kann als eine Art Wissensspeicher verstanden werden. In und mit der Sprache werden kulturelle Formen geprägt, aufbewahrt und modifiziert. Des Weiteren wird Sprache und Sprechen hier als Praxis verstanden.9 Im Gebrauch von Sprache und im Zusammenspiel mit weiteren außersprachlichen Faktoren wie z.B. Gestik und Mimik konstituieren Sprecher*innen ihre jeweiligen Welten oder Wirklichkeiten.
1.1Praktiken
Praktiken sollen hier als alltägliche Handlungen verstanden werden, die bewusst oder unbewusst ablaufen. Die Praxis des intentionalen (mit einer bestimmten Absicht) Sprechens geschieht primär bewusst, aber die korrekte Verwendung grammatischer Regeln, syntaktischer Strukturen und semantischer Bedeutungsvarianten laufen dabei unbewusst ab. Dies wird immer dann deutlich, wenn jemandem „etwas auf der Zunge liegt“. Dies zeigt sich während des Sprechens in Form einer Pause durch ein „äh“, „hmm“ oder durch „genau“ als eine Art Selbstvergewisserung. Ebenso sind kurze Sprechpausen oft Hinweis auf das bewusste Suchen eines passenden Wortes. Sprecher*innen müssen somit nicht nur die Syntax beherrschen, sondern auch die semantischen Besonderheiten etwa bei mehrdeutigen Begriffen kennen.
Es wird sich in dieser Einführung zeigen, dass die Interaktion von sprechenden Akteur*innen mit der Umwelt konstitutiv ist für die Kategorisierung einer außersprachlichen Welt. Auch wird sich dabei en passant zeigen, dass die Arbeiten von frühen Vertretern der strukturalen Linguistik und Semiotik weiterhin aktuell sind.10
In dieser Einführung soll die Bedeutung als Sprachpraxis, die durch und mit Sprachen hervorgebracht wird, beleuchtet werden.11 Das linguistische Teilgebiet, das sich mit der Wortbedeutung beschäftigt, also der Beschreibung und Definition von atomisierten Worteinheiten und deren Bedeutungen innerhalb eines Satzes basierend auf satzimmanenten Wortfeldern, ist die Semantik, oder genauer die lexikalische Semantik. Im weitesten Sinne werden in der Semantik sprachliche Zeichensysteme untersucht, die allerdings von weiteren kognitiven Faktoren oftmals abgekoppelt werden. Ebenso werden in semantischen Untersuchungen lexikalische Einheiten als Bedeutungsträger analysiert, die auf der Satzebene verweilen, wobei der Zusammenhang zwischen Kulturen, Sprache und Denken keine vordergründige Rolle spielt.12
Die Zusammenführung von Kognition und Semantik spiegelt vor allem die nordamerikanische Tradition in der Sprachwissenschaft Ende der 1970er wider, die davon ausgeht, dass sprachliche Strukturen allgemeinen kognitiven Mechanismen und Wahrnehmungsprozessen unterliegen und damit Sprache nicht von diesen Zusammenhängen abgekoppelt werden kann.13 Kognition bedeutet aber auch, dass es um die einzelne Sprecher*in und ihre mentalen Leistungen geht.14 Die Einbeziehung der Kognitiven Anthropologie erweitert diesen Ansatz in Richtung einer angewandten Semantik, die über die Wort- und Satzgrenze hinausgeht, aber auch über die Pragmatik als der Beschäftigung mit der Verwendung von Sprache in konkreten kommunikativen Situationen, die sich im realen oder im virtuellen Raum abspielen können. Sprache wird damit im alltäglichen Gebrauch in unmittelbarer Abhängigkeit von umweltbedingten und auch evolutionären Faktoren verstanden.
Mit Bezug auf eine gängige Definition der Kognitive Anthropologie schreibt Casson in der MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences:
Cognitive anthropology is a unified subfield of cultural anthropology whose principal aim is to understand and describe how people in societies conceive and experience their world […]. The definition of cultur...