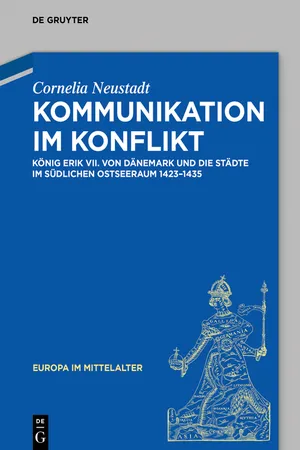1.1Eingrenzung des Themas
In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde der Ostseeraum in großem Maße von den Hegemonialbestrebungen König Eriks VII. von Dänemark (1397–1439) geprägt. Aus dem pommerschen Herzogshaus stammend, erlangte er auf Betreiben seiner Großtante, Margrete von Dänemark (✝ 1412), in den Reichen Dänemark, Norwegen und Schweden, die sich 1397 in Kalmar zu einer Union zusammenschlossen, die Königswürde.1 Zu einem zentralen Konflikt seiner Regierungszeit erwuchs der Streit um die Stellung des Herzogtums Schleswig, das ursprünglich als Lehen der dänischen Krone den Grafen von Holstein aus der Familie der Schauenburger übertragen worden war. Diese gewannen während der Regierungszeiten der Könige Valdemar IV. (1340–1375) und Olav II. (1376–1387) eine starke Unabhängigkeit. Nach dem Tod Graf Gerhards VI. im Jahr 1404 versuchte zunächst Margrete, die Autorität und Reichweite des Königtums durch Ausnutzung der Parteibildung innerhalb des schleswigschen Adels zu stärken. Nach ihrem Tod beschritt König Erik VII. den Weg der gerichtlichen Prozesse, um die Stellung des Herzogtums als Lehen der dänischen Krone festzuschreiben und dieses damit der direkten Kontrolle des Königtums zu unterstellen.2 Seine Bestrebungen kulminierten 1416 in einem langanhaltenden Krieg, der 1426 noch weiter eskalierte, da das Unionskönigtum nun einem Bündnis der Grafen von Holstein mit den Städten Lübeck, Hamburg, Stralsund, Rostock, Wismar und Lüneburg gegenüberstand. Dabei begründeten die Städte ihre Beteiligung mit der Verletzung der hansischen Handelsprivilegien in den Unionsreichen. Dies betraf in Dänemark zum einen die allgemeinen Freiheiten in allen Teilen des Reiches, zum anderen besonders die Niederlassungen in Schonen, dem Zentrum des Heringsfanges.3 Nicht zuletzt kontrollierte der dänische König mit dem Øresund die Durchfahrt von der Nord- zur Ostsee. Die Frage der Privilegien wie auch die dänische Präsenz in der Ostsee hatten bereits die Auseinandersetzungen der Hanse mit Valdemar IV. bestimmt. Doch musste dieser im Krieg gegen die Städte der Kölner Konföderation eine Niederlage hinnehmen und im Stralsunder Frieden 1370 die Sundschlösser ausliefern. An die von Valdemar vorangetriebene Hegemonialpolitik knüpfte nun Erik an.4
In diesen hier kurz umrissenen Konflikt mit dem dänischen König waren jedoch nicht nur die Holsteiner Grafen und die genannten Städte Lübeck, Hamburg, Stralsund, Rostock, Wismar und Lüneburg, sondern fast der gesamte Ostseeraum und die dort präsenten Kräfte involviert.5 Zu nennen sind besonders der Deutsche Orden, die Städte in Preußen und Livland sowie die norddeutschen Herrschaften und Herzogtümer. Schon allein dadurch, dass die Konfliktparteien durch die Anwerbung von Ausliegern die unbeteiligten Dritten stark schädigten, wurden diese mit in den Konflikt hineingezogen. Die unterschiedliche Anteilnahme der anderen hansischen Städtegruppen lässt sich dabei als ein Indiz für die partikularen Interessen betrachten, die den Charakter der Hanse im 15. Jahrhundert bestimmten.6
Greifbar werden diese Auseinandersetzungen im besonderen Maße in den dokumentarischen Quellen aus den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. So brachte der Konflikt des Unionskönigs mit den Holsteinern und den Städten der südlichen Ostseeküste eine Vielzahl an Schriftzeugnissen hervor, deren Erhalt und Aufbewahrung einen qualitativen und quantitativen Sprung gegenüber früheren Konflikten aufzeigen. Dafür stehen in Lübeck z. B. die insgesamt 217 Einzelstücke in einem der ersten Ordner der „Externa Danica“ des ehemaligen Senatsarchivs, denen nur drei originale Briefe aus der gesamten Zeit vor 1404 entgegenzusetzen sind.7
Hinter diesem Phänomen steht der Zusammenfluss zweier grundsätzlicher Entwicklungen. Zum einen lässt sich nicht nur für die hansischen Städte, sondern auch für weitere Teile des nördlichen Europas seit der Mitte des 14. Jahrhunderts eine Zunahme der Literarität beobachten. Sie war besonders verbunden mit der wachsenden Verbreitung des Beschreibstoffs Papier, mit dem auch ein signifikanter Anstieg von Verwaltungsschriftgut und dessen Aufbewahrung in den Kanzleien einherging.8 Zudem standen die Schriftstücke, die vorzugsweise aufbewahrt wurden, sehr oft im Zusammenhang mit Konflikten. Dass gerade Rechtsstreitigkeiten und Unglücke einen wichtigen Grund für die Überlieferung von Quellen spielten, wurde in der Mediävistik, nicht zuletzt im Anschluss an Arnold Esch, immer wieder thematisiert und gehört inzwischen zu den grundsätzlichen Erkenntnissen des Fachs.9 Während Esch dieses Ungleichgewicht in der archivalischen Überlieferung als einen Faktor der Quellenkritik problematisierte, soll die vorliegende Untersuchung gerade bei diesem direkten Konnex zwischen Konflikt und Impuls zur Aufbewahrung im Archiv ansetzen. Anwendungsfeld ist der eingangs vorgestellte räumliche und zeitliche Rahmen. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, inwieweit die Zusammensetzung der Überlieferung aus dem historischen Kontext heraus zu erklären ist, sondern auch jene, ob sich darin besondere Schwerpunkte feststellen lassen. Dies könnten Schriftguttypen ebenso wie bestimmte Sachverhalte oder Vorgänge sein. Obwohl bei jedem Archiv zufällige Verluste und nachträgliche Neuordnungen anzunehmen sind, können die vorhandenen Dokumente doch Hinweise auf die ursprünglichen Intentionen für die Aufbewahrung geben. Dadurch bieten sie – zumindest in Ansätzen – Informationen über die Aspekte des Konfliktes, die von der bewahrenden Instanz mittel- bzw. langfristig als relevant angesehen wurden.
Nach der Definition von Hermann Kamp, die er in Anlehnung an den Rechtsethnologen Simon Roberts entwickelt hat, lässt sich ein „Konflikt“ als ein soziales Phänomen charakterisieren. Es setzt voraus, „dass sich jemand aufgrund seiner Vorstellung von dem, was andere zu tun und zu lassen haben, verletzt und angegriffen fühlt, jemand anderen dafür verantwortlich macht und Widerspruch offen diskutiert.“10 Dabei lassen sich politische Konflikte im Mittelalter – seiner Meinung nach – sowohl an Auseinandersetzungen um Herrschaftsrechte, Besitz und Einfluss als auch um Rechte, Ehre und Ansehen festmachen. Die eigentlichen Motivationen seien nicht immer so klar voneinander zu trennen, da z. B. Auseinandersetzungen um Macht und Einfluss als Ehr- oder Rechtskonflikte erscheinen konnten.11 Gerade diese Vermischung von Motiven beschreibt auch die Situation in dem Konflikt um die Zugehörigkeit des Herzogtums Schleswig und bestimmt die Rechtfertigung des Krieges im Rahmen rechtmäßiger Fehde. In verschiedenen Fällen wird auf „Ehre“ Bezug genommen, sei es als Anlass für eine Kriegserklärung oder als Begründung für die Ablehnung von Friedensverträgen, deren Bedingungen als unzureichend betrachtet werden.12 Diese Rechtfertigungen oder Zurückweisungen finden sich primär in den dokumentarischen Schriftquellen, in denen sie artikuliert oder als Reflexion mündlicher Kommunikation festgehalten wurden.
Steht hinter Auswahl und Charakter der zu untersuchenden Quellenbestände der „Konflikt“ als Motivation, fallen Entstehung und Funktion der einzelnen Dokumente in den Rahmen von „Kommunikation“. Dieser Begriff lässt sich zunächst als eine Sammelbezeichnung für „alle Formen von Verkehr, Verbindung, Vermittlung und Verständigung“ anwenden. Dabei richtet sich das Augenmerk auf den „Vorgang der Mitteilung, seine Mittel, seine Aktionen und Reaktionen und widmet sich den aus ihm notwendig folgenden Wirkungen“.13 Gleichzeitig können die verschiedenen Aspekte von Kommunikation, wie Kontaktaufnahme, Verständigung, Einsatz oder Herstellung eines Mediums, als menschliche „Handlungen“ beschrieben werden. Als solche dienen sie zur Erklärung und/oder Gestaltung der Welt und sind prinzipiell auf ein Mittel oder einen Zweck hin ausgerichtet. 14 Da Kommunikation grundsätzlich auf der Interaktion von zwei Akteuren (Sender und Empfänger) beruht, lassen sich alle ihre einzelnen Elemente als soziale Handlungen charakterisieren.15 Darüber hinaus zielen sie auf ein bestimmtes Ergebnis – die Wirkung – ab, welches ihren Zweck ausmacht und die Wahl der entsprechenden Mittel beeinflusst.16
Der Untersuchungsschwerpunkt dieses Buches liegt einerseits auf dem Funktionsspektrum von Schriftlichkeit, andererseits auf ihrem Einsatz im Rahmen zweckbezogener Handlungen. Der Blick richtet sich dabei vor allem auf die Kommunikationspraxis, welche die Entstehung schriftlicher Dokumente bedingte oder ihnen eine besondere Wirkung zukommen ließ.17 Dabei fallen nicht nur die Vorgänge ins Gewicht, die zur Herstellung der physischen Objekte führten, sondern auch ihre Aufbewahrung und weitere Benutzung.18 Alle drei Aspekte stehen für verschiedene Momente in der Interaktion zwischen Personen oder Personengruppen. Schließlich verbindet sich mit der Existenz der Dokumente auch die Frage, wer sich darin artikuliert: der Aussteller, der Empfänger oder die mit der Produktion beauftragten „Schriftprofessionellen“. Grundsätzlich ist jedes geschriebene Dokument als Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen mindestens zwei dieser Seiten einzuschätzen, dem Absender und seinen Schreibern. In vielen Fällen handelt es sich jedoch um komplexere Vorgänge, bei denen z. B. die Konsensfindung zwischen Absender und Empfänger einer Niederschrift vorausging oder diese begleitete. Bereits das Schreiben selbst lässt sich als eine Sequenz sozialer Handlungen begreifen,19 wenn der „Schriftprofessionelle“ dabei auf Traditionen und Konventionen wie Urkunden- und Briefformulare zurückgriff und sich bei der Herstellung eines Dokumentes quasi in einem Dialog mit diesen Vorlagen befand. Darüber hinaus dienten die im Zuge der Kommunikationsprozesse zwischen Absender, Empfänger und Schreibenden entstandenen Schriftstücke dem sozialen und politischen Handeln des Ausstellers, des Empfängers bzw. beider Seiten.20 Sie bieten Einblicke in Herrschaftsverständnis, Umgangsformen, Argumentationen und rechtliche Rahmenbedingungen.
Die Schriftstücke, die als Materialbasis für die vorliegende Untersuchung dienen, resultieren aus der Sondersituation des Konflikts. Daher spiegeln sie vorrangig das soziale oder politische Handeln der in die Auseinandersetzung verwickelten Personen und Personengruppen.