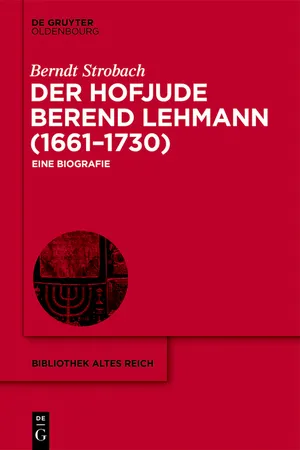
- 482 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Der Financier Berend Lehmann zählt zu den großen und umstrittenen Persönlichkeiten der jüdischen Geschichte der Frühen Neuzeit. Als "Hofjude" Augusts des Starken war er maßgeblich beim Erwerb der Polenkrone beteiligt. Von Juden wurde er als heiligenähnlicher Patriarch und Wohltäter verehrt, von Antisemiten als Wucherer diffamiert. Strobach legt eine erste, auf zahlreiche Quellen gestützte kritische Biographie vor.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730) von Berndt Strobach im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Deutsche Geschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Hofjuden, – das waren in der Regel finanziell hervorragend aufgestellte und gut vernetzte Juden, die in einem auf Dauer angelegten Finanz- und Warendienstverhältnis zu einem höfischen Herrschaftszentrum standen. Sie waren im Allgemeinen – anders als etwa Hofkapellmeister oder gar Hofnarren – keine Angestellten des Hofes, sondern freie Unternehmer. Seine Blütezeit hatte das europäische Hofjudentum zwischen 1600 und 1800.
Der in Essen geborene, in Halberstadt ansässige und dort verstorbene Jissachar ben Jehuda haLevi (1661 – 1730), der sich deutsch Berend Lehmann nannte, zählt zu den großen Persönlichkeiten der jüdischen Geschichte der Frühen Neuzeit. Als Hofjude wird er in einem Atemzug erwähnt mit dem Stuttgarter ‚Jud Süß‘, Joseph Oppenheimer (1698 – 1738), seinem Wiener Namensvetter Samuel Oppenheimer (1630 – 1703) und dessen dortigem Kollegen Samson Wertheimer (1658 – 1724), mit dem Hannoveraner Leffmann Behrens (1634 – 1714) bis hin zu dem späten Meyer Amschel Rothschild (1743 – 1812).6 Die Rolle, die er beim Erwerb der polnischen Königskrone durch den Kurfürsten von Sachsen, August den Starken, spielte, hat ihm einen festen Platz in der sächsischen, polnischen, deutschen und jüdischen Geschichtsschreibung gesichert und ist bis heute maßgeblich für die Faszination verantwortlich, die von ihm ausgeht. Seit sich die Geschichtsschreibung mit dem Phänomen des Hofjudentums beschäftigt, gilt Berend Lehmann als Musterbeispiel.7
Die allseits anerkannte Bedeutung Berend Lehmanns steht im Missverhältnis zur Gründlichkeit seiner Erforschung. Die einschlägige Literatur ist nicht nur wenig umfangreich, sondern vielfach auch veraltet und tendenziös, und sie beruht auf einer schmalen Quellengrundlage. In den Lehmann-Bildern, die über die Jahrhunderte gezeichnet wurden, spiegeln sich nicht nur verschiedene historiographische Ansätze, sondern auch unterschiedliche jüdische, polnische und deutsche Mentalitäten und Geschichtsdeutungen.
1.1 Zielsetzung
Leider gibt es kein Bildnis von Berend Lehmann8, und es gab bisher keine „heutigen Ansprüchen genügende Monographie“.9 Mit dem vorliegenden Buch soll erstmals eine quellenfundierte und kritische Biografie Berend Lehmanns vorgelegt werden, die auf zum großen Teil bislang unerschlossenen Archivalien basiert und zu einem neuen Bild von Berend Lehmann führt.
Was kann der Leser erwarten? Große jüdische Geschichte soll im Mikroformat von personalem und lokalem Kontext greifbar werden. Das Leben eines prominenten Juden der Barockzeit wird im historischen Zusammenhang dargestellt. Das Buch ist einerseits eine Biografie Berend Lehmanns, d. h. eine Schilderung seiner Lebensereignisse. Andererseits werden seine Person und die Bedingungen seines Handelns unter politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Gesichtspunkten rekonstruiert. An der Biografie Lehmanns kann der Leser daher Aufschluss gewinnen über die Handelspraktiken und -risiken jüdischer Kaufleute und Bankiers, über deren Bildung und Ausbildung, über jüdische Handlungsstrategien gegenüber unterschiedlichen Obrigkeiten, über die Freiräume und Grenzen jüdischer Religionsausübung, über Sesshaftigkeit, den Grunderwerb und die Migration von Juden. Auch wenn aufgrund der vielfach unbefriedigenden Quellenlage manche Lücken bestehen bleiben, vermag es das Buch erstmals, belastbare Erkenntnisse zu bisher nicht beachteten Fragen zu liefern und den Forschungsstand in entscheidenden Punkten zu revidieren oder kritisch zu hinterfragen.
Anhand konkreter Beispiele erhält der Leser Einblick in die Lebenswelt eines Angehörigen der jüdischen Oberschicht des Barockzeitalters, in christliche Judenfeindschaft wie in funktionale Beziehungen zwischen Christen und Juden, in die Binnenverhältnisse des Fürstentums Halberstadt, in interne Entscheidungsprozesse in Brandenburg-Preußen und Kursachsen, aber auch in das Zusammenspiel und die Konkurrenz unterschiedlicher politischer Akteure im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die Analyse des Plans einer Teilung Polens führt den Leser auf das diplomatische Parkett des 18. Jahrhunderts. Die Untersuchung der Tätigkeit Lehmanns als Münzjude macht den Leser mit den Herausforderungen der Währungs- und Wirtschaftsordnung der Frühen Neuzeit bekannt. Das Buch zeigt, welche Möglichkeiten Juden im Zeitalter vor der Emanzipation schon offenstanden, aber auch, an welche Grenzen sie stießen. Eine Besonderheit ist Lehmanns Streben nach adelsähnlichen Lebensverhältnissen, das ihn zum Beispiel zu einem jüdischen Gutsherren machte.
Berend Lehmanns früher Erfolg im Münz- und Kreditwesen machte ihn zum langjährigen Geschäftspartner Augusts des Starken, eines der ehrgeizigsten Herrschers der Barockzeit, dem er mit Darlehen entscheidend half, Kriege zu führen, seinen Status vom Kurfürsten zum König zu erhöhen und seine Kunstsammlungen zu bereichern. Hierbei ergeben sich vielfältige Einblicke in das Geld- und Wirtschaftswesen der Frühen Neuzeit, unter anderem in die Praxis der obrigkeitlich betriebenen Münzverschlechterung.
August machte Lehmann nicht nur zum Hofjuden, sondern verlieh ihm darüber hinaus den Titel eines Residenten. Dieser, wenn auch niederrangige, diplomatische Titel erhöhte seinen Status auf eine für Juden sonst kaum erreichbare Stufe. Lehmann war sowohl Akteur als auch Objekt in den Auseinandersetzungen zwischen dem Kurfürsten, dessen Regierung und den Ständen. Gerade die hier neu erschlossenen Akten aus dem Dresdner Staatsarchiv, die darüber informieren, zeigen, dass politische Entscheidungen im vermeintlichen Zeitalter des Absolutismus durchaus nicht „absolut“ vom Herrscher bestimmt werden konnten, sondern vor dem Hintergrund erbitterter Konflikte zustande kamen. Sie sind Musterbeispiele für das, was durch einen überholten Absolutismusbegriff nicht erfasst wurde, nämlich das politische Mitwirken von „ständisch-korporativen Gewalten und andere[n] die monarchische Herrschaft beschränkende[n] Faktoren“ an einem Prozess des „Aushandelns“.10
In dem Jahrzehnt um die Wende von 17. zum 18. Jahrhundert, als seine Geschäfte prosperierten, trat Lehmann als Förderer jüdischer Religion und Kultur hervor. Mit drei Großtaten dankte er seinem Schöpfer, unterstützte die Judenheit und sicherte sich selbst eine bleibendes Andenken: mit der Finanzierung des Neudrucks des Babylonischen Talmud, mit der Gründung einer Jeschiwah, d. h. einer theologischen Lehr- und Forschungsstätte, und durch den Bau einer Synagoge an seinem Wohnort. Damit erhielt das bevölkerungsreiche Halberstädter Judenviertel, dessen Wohn- und Eigentumsverhältnisse nach Quellen aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz exemplarisch rekonstruiert werden, seinen religiösen, kulturellen und architektonischen Mittelpunkt.
Immer wieder wurde Berend Lehmann in den Vorstand der Halberstädter jüdischen Gemeinde gewählt. Zeitweise galt er sogar als der „Landschtadlon“, d. h. als oberster Repräsentant und Fürsprecher der gesamten brandenburgisch-preußischen Judenschaft. Die Untersuchung erschließt deshalb auch die differenzierte Reaktion der preußischen Politik auf das Anwachsen des jüdischen Bevölkerungsanteils in Halberstadt.
Der Halberstadt gewidmete Teil des Buches endet mit einem Blick auf das Privatleben Lehmanns und seine Rolle als Mäzen, die sich an noch erhaltenen Kunstgegenständen nachvollziehen lässt.
Quasi-diplomatische Aufträge ermutigten Lehmann dazu, selbst politische Initiativen zu ergreifen. Mehrere solcher politischer Projekte konnten für diese Arbeit aus den Berliner, Hannoveraner und Dresdner Archiven erschlossen werden. Er glaubte aufgrund seiner Verbindungen zu Glaubensgenossen, Verwandten, Geschäftsfreunden sowie christlichen Entscheidungsträgern Einfluss auf dem internationalen Parkett ausüben zu können. Er scheitert und wird mit hohen Geldbußen bestraft.
Lehmanns Bankrott hatte nicht nur politische, sondern auch geschäftliche Gründe. Am Beispiel mehrerer letztlich ruinöser Kredite, deren Geschichte in den Akten über Jahrzehnte detailliert verfolgt werden konnte, gewinnt man Einblicke in typische Finanzvorgänge der Frühen Neuzeit.
Lehmanns hier erstmalig behandelte Begegnungen mit führenden christlichen Politikern seiner Zeit fügen auch deren Biografien Bausteine hinzu. Das gilt für den Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. und den Kurfürsten-König August den Starken genauso wie für deren Minister Ilgen und Flemming, aber auch für den hannoverschen Premierminister König Georgs I. von Großbritannien, Andreas Gottlieb Freiherr von Bernstorff und für den braunschweigischen Herzog Ludwig Rudolf.
Als Nebenergebnis gewinnt eine neue Biografie aus Lehmanns Kreis Umriss. Es ist die seines Schwagers Jonas Meyer, dessen erheblicher Anteil an Lehmanns Zweiggeschäft in Dresden und an der Gründung der dortigen Gemeinde greifbar wird. Ähnliches gilt für Lehmanns Prokuristen Assur Marx, den Gründer der Hallenser Judengemeinde, und für Seckel Nathan, den Vorsteher der Hildesheimer Judenschaft.
Der Ausblick nennt Desiderata der Berend-Lehmann-Forschung und weist auf Stellen hin, an denen erfolgversprechend weitergearbeitet werden könnte.
1.2 Forschungsstand: Die verschiedenen Lehmann-Bilder
Berend Lehmann ist schon zu Lebzeiten sehr verschieden bewertet (und entsprechend den Bewertungen auch selektiv dargestellt) worden. Diese Disparität bleibt bis ins 20. Jahrhundert hinein bestehen. Nur zögernd hat sich zwischen Verehrern und Verächtern Lehmanns unvoreingenommene Geschichtsschreibung angebahnt. Diese Entwicklung wird im folgenden Kapitel dargestellt; sie ist einerseits, inhaltlich gesehen, ein Spiegelbild des Verhältnisses von Juden und Christen (beziehungsweise nichtjüdischen Deutschen) vom 18. bis ins 21. Jahrhundert, andererseits zeigt sie, methodisch gesehen, den Wandel im Umgang mit überlieferten Quellen.
1.2.1 18. Jahrhundert: Bewunderung durch die jüdischen Zeitgenossen
Zusammenhängende Charakterisierungen oder Bewertungen Berend Lehmanns von christlichen Autoren aus dem 18. Jahrhundert sind bisher nicht bekannt geworden. Einzelne kurze Äußerungen, die an späterer Stelle in dieser Arbeit erwähnt werden11, sind überwiegend abschätzig (Dresdner, hannoversche und Berliner Hofbeamte) selten anerkennend (Kurfürstin Sophie von Hannover, Helmstedter Hebraist Hermann von der Hardt).
Dagegen steht „Bärmann Halberstadt“ (so sein Name in jüdischen Quellen) bei seinen Glaubensgenossen in höchstem Ansehen, das schlägt sich z. B. in den Halberstädter Gemeindechroniken nieder.
Das Ehrengedenken im Memorbuch
Traditionell wurde das Bild eines ‚zu den Vätern versammelten‘ Juden durch den Grabsteintext geprägt; eine ausführlichere Fassung des Ehrengedenkens findet sich im Fall Berend Lehmanns, entsprechend seiner Bedeutung als Wohltäter der Halberstädter Gemeinde und als ihr langjähriger Vorsteher, im hebräisch abgefassten Memorbuch der Halberstädter Klaus, des von ihm gegründeten Lehrhauses:12
Sie lautet in der modernen Übersetzung von Dirk Sadowski (2010):
Der Herr erinnere die Seele des Edlen und Vermögenden, des berühmten Fürsten und Hauptes, des großen Fürsprechers [schtadlan], des Vorstehers des Geschlechts und seiner Wohltäter, der Wohltäter des Herrn, des Obersten der Oberen der Leviten, des ehrwürdigen Meisters, unseres Rabbis Jissas’char Berman, Sohn des Jehuda Lema Halewi, sein Andenken zum Segen, aus Essen13,
dessen Leben voller guter Taten war, die den Armen und Reichen, den Fernen und den Nahen galten;
der die sechs Ordnungen [der Mischna bzw. des Talmud] druckte und aus seiner Tasche Gold fließen ließ, da er die Thora und die sie Studierenden liebte; der die Gebote befolgte und keine böse Sache kannte;
der in Gnade ern...
dessen Leben voller guter Taten war, die den Armen und Reichen, den Fernen und den Nahen galten;
der die sechs Ordnungen [der Mischna bzw. des Talmud] druckte und aus seiner Tasche Gold fließen ließ, da er die Thora und die sie Studierenden liebte; der die Gebote befolgte und keine böse Sache kannte;
der in Gnade ern...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Vorbemerkung
- 1 Einleitung
- 2 Berend Lehmanns frühe Jahre
- 3 Geschäftstätigkeit für August den Starken 1696 – 1706
- 4 Zu Hause in der Judenschaft von Halberstadt
- 5 Die Mitzwot (Leistungen aus religiöser Verpflichtung) als Konsequenz des erworbenen Wohlstands
- 6 Die Tätigkeit für Fürst Ludwig Rudolf von Blankenburg
- 7 Die „Firma“ Lehmann-Meyer in Dresden
- 8 Der Resident in der Rolle des Politikers
- 9 Berend Lehmanns Bankrott
- 10 Die Persönlichkeit Berend Lehmanns
- 11 Jüdische Existenzbedingungen im Vergleich
- Ausblick
- Anhang
- Dokumente
- Historische Abkürzungen
- Chronologie
- Stammtafeln
- Benutzte Literatur
- Benutzte Archivalien
- Benutzte Internet-Ressourcen
- Abbildungsnachweise
- Personenregister
- Geografisches Register
- Abstract