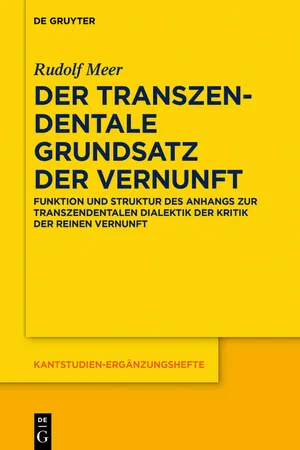Bemerkenswert ist, dass sich die konstatierte Verlegenheit der menschlichen Vernunft nicht am Ende des Buches als Ergebnis einer kritischen Untersuchung findet, sondern als Ausgangspunkt dient. Das „Bewußtsein meiner Unwissenheit“ (A 758/B 786), formuliert Kant in der Transzendentalen Methodenlehre diesen Aspekt erläuternd, ist, „statt daß es meine Untersuchungen endigen sollte, […] vielmehr die eigentliche Ursache, sie zu erwecken.“ (A 758/B 786) Die Feststellung am Anfang der Kritik der reinen Vernunft weist damit dem „natürlichen Hang“ (A 642/B 670=1.1.) der Vernunft, über das Feld möglicher Erfahrung hinauszugehen, und dem dadurch entstehenden transzendentalen Schein eine immanente Funktion im System der Kritik der reinen Vernunft zu. Dabei ist es für Kant eine denknotwendige Voraussetzung, alles, was in der Natur unserer Kräfte gründet – und damit auch den durch die unbeantwortbaren Fragen hervorgerufenen Schein –, als zweckmäßig (vgl. A 642/B 670=1.2.) aufzufassen. Die Ideen der reinen Vernunft können „nimmermehr an sich selbst dialektisch sein“ (A 669/B 697=2.1.), da sie „uns durch die Natur unserer Vernunft aufgegeben [sind], und dieser oberste Gerichtshof aller Rechte und Ansprüche unserer Speculation kann unmöglich selbst ursprüngliche Täuschungen und Blendwerke enthalten.“ (A 669/B 697=2.1.) Aus diesem Grund haben auch die Vernunftbegriffe „ihre gute und zweckmäßige Bestimmung in der Naturanlage unserer Vernunft“ (A 669/B 697=2.1.).
Dieser doppelte Anspruch im Aufweis der unbeantwortbaren Fragen und der zweckmäßigen Funktion des dadurch entstehenden Scheins erlaubt es Kant, die Vernunft von ihren dogmatischen Ansprüchen der metaphysica specialis zu befreien und gleichzeitig einen regulativen Vernunftgebrauch zu etablieren, durch den die Vernunft als focus imaginarius zum letzten Prüfstein erhoben wird. Der Anhang zur Transzendentalen Dialektik bildet dabei den locus classicus in der Frage nach der Möglichkeit und Funktion richtig geschlossener Vernunftbegriffe. An dieser Stelle der Kritik der reinen Vernunft finden jene Fragen, welche die menschliche Vernunft beschäftigen, auf die sie aber keine Antwort hat, gerade in ihrer dogmatischen Unbeantwortbarkeit einen spezifischen Platz im Rahmen des Systems.
Mit diesem an subversiver Kraft kaum zu unterschätzenden Spannungsverhältnis zwischen den durch die Natur der Vernunft aufgegebenen, aber unbeantwortbaren Fragen ersetzt Kant jede externe Autorität wie jene von Thron und Altar durch einen kontinuierlichen und reflexiven Prüfungsprozess.
1.1 Forschungsstand
Im Jahre 1958 konstatiert R. Zocher, dass es sich bei der Textpassage des Anhangs zur Transzendentalen Dialektik um eine wenig beachtete Deduktion der Ideen (vgl. Zocher 1958, S. 43) handelt. M. Caimi veröffentlicht im Jahr 2009 in den Kant-Studien unter Anspielung auf Zocher einen Beitrag, der im Titel genau diese Einschätzung bezüglich des Forschungsstandes anführt (vgl. Caimi 1995, S. 308 – 320). In den gut 50 Jahren, die zwischen den Ergebnissen Zochers und Caimis liegen, aber insbesondere in den Jahren nach Caimis Beitrag, ist das Forschungsinteresse an der Textpassage zwar zunehmend gewachsen, damit aber auch die Mehrdeutigkeiten in der Interpretation.
Interpretationsschwierigkeiten bereitet dabei erstens, dass der regulative Vernunftgebrauch im Anhang zur Transzendentalen Dialektik in vielen Aspekten nicht kompatibel mit Grundpositionen der drei Hauptstücke des Zweiten Buchs der Transzendentalen Dialektik zu sein scheint und außerdem zentralen Positionen der Transzendentalen Analytik widerspricht. Außerdem steht das Erste Buch der Transzendentalen Dialektik, das in besonderer Beziehung zum Anhang zu sehen ist, im Vergleich zum Zweiten Buch ebenfalls am Rande des Forschungsinteresses. Zweitens scheinen die einzelnen Abschnitte des Anhangs zur Transzendentalen Dialektik ein bloßes Konglomerat zu bilden, dessen Teile in einem inneren Widerspruch stehen, weshalb es nur schwer möglich ist, eine einheitliche Konzeption herauszustellen. Aus diesem Grund wird die Textpassage mehr als Steinbruch verschiedenster Theorien, denn als einheitliches Lehrstück angesehen. Drittens umfasst der Anhang zur Transzendentalen Dialektik viele, wenngleich rudimentär entwickelte Konzepte, die erst im Zuge der nachfolgenden Arbeiten von Kant konkretisiert und ausgearbeitet werden. Dies führt dazu, dass der Anhang zur Transzendentalen Dialektik zum Teil bloß als erster Entwurf einer späteren Konzeption betrachtet wird.
Diese Interpretationsschwierigkeiten ziehen als Konsequenz nach sich, dass in systematischen Darstellungen zur Kritik der reinen Vernunft bzw. zur Transzendentalen Dialektik die Textpassage des Anhangs trotz ihres 60-seitigen Umfangs nur marginal thematisiert wird. In diesem Sinne wird der Anhang zur Transzendentalen Dialektik im Rahmen der systematischen Kommentare zur Kritik der reinen Vernunft von H. Allison (2004, S. 423 – 448), N. Kemp Smith (1965, S. 553 f.), H. M. Baumgartner (1991a, S. 118 f.), P. F. Strawson (1966, S. 226 – 231), O. Höffe (2003, S. 268 – 276), P. Guyer (1997a, S. 39 – 53), R. Zocher (1959, S. 86), W. Bröcker (1970, S. 133 – 136), H. Tetens (2006, S. 285 – 294), M. Wundt (1924, S. 243 – 264) und P. Natterer (2003, S. 609 – 621) zwar erwähnt, aber nur wenig analysiert und interpretiert. Ganz unerwähnt bleibt die Textpassage u. a. bei H. J. de Vleeschauwer (1934 – 1937). Im Rahmen eines Kommentars zur Transzendentalen Dialektik sind mit Blick auf den Anhang die größer angelegten Studien von H. Heimsoeth (1969, S. 546 – 643), J. Bennett (1974, S. 270 – 280) und W. Lütterfelds (1977, S. 413 ff.) hervorzuheben – unerwähnt bleibt die Textpassage u. a. bei J. Sallis (1983).
Trotz dieser Marginalisierung des Anhangs zur Transzendentalen Dialektik im Kontext größerer Darstellungen wird die Textpassage in den letzten Jahrzehnten zunehmend ausführlicher thematisiert. Dabei zeigt sich aber aufgrund der obig dargestellten Interpretationsschwierigkeiten eine sehr heterogene Forschungssituation, in welcher der Anhang zur Transzendentalen Dialektik vor allem als Bezugspunkt für andere systematische Problemstellungen herangezogen wird. Dies wiederum führt dazu, dass es zum einen wenig Austausch und zum anderen wenig Transparenz über die schon geleisteten Forschungsergebnisse zur Textpassage gibt. Um dem entgegenzuwirken, wird in der Folge ein systematischer Überblick zum aktuellen Stand der Forschung gegeben. Dabei werden einerseits die Spezialstudien zum Anhang zur Transzendentalen Dialektik anhand von Themenschwerpunkten – wie Deduktion und Schematismus der Vernunftbegriffe, Gegenstands- und Systembegriff sowie der Begriff des Transzendentalen – differenziert, andererseits wird die Forschungsliteratur anhand von vier thematischen Zugängen zur Textpassage – ausgehend von der Kritik der reinen Vernunft selbst, der Kritik der Urteilskraft, der Kritik der praktischen Vernunft und den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft – dargestellt:
Der Anhang zur Transzendentalen Dialektik bildet erstens einen Bezugspunkt für verschiedenste Forschungsschwerpunkte der Kritik der reinen Vernunft. Ein besonderes Interesse zieht die Textpassage dabei im Kontext der Untersuchungen zur Transzendentalen Dialektik (I.) auf sich: Im Zentrum steht (I.a) das Verhältnis des Zweiten Buches zum Anhang zur Transzendentalen Dialektik. Dabei wird zumeist die Kompatibilität der Paralogismen der reinen Vernunft, der Antinomie der reinen Vernunft und des Ideals der reinen Vernunft zum Anhang zur Transzendentalen Dialektik, insbesondere zum zweiten Teil, geprüft. Explizite Bezüge zwischen dem ersten Hauptstück und dem Anhang zur Transzendentalen Dialektik werden dabei von A. Goldman (2012, S. 124 – 157), P. Kitcher (1990, S. 218 f., 221, 229), C. Serck-Hanssen (2011, S. 59 – 70) und C. Piché (2011, S. 47 – 58) hergestellt. P. Krausser (1988, S. 375 – 401), W. Malzkorn (1999, S. 30 – 77), P. Baumanns (1988, S. 196 – 200), B. Dörflinger (2011, S. 103 – 116), K. Engelhard (2005, S. 385 – 413), B. Falkenburg (2000, S. 376 – 385), Ch. Iber (2011, S. 71 – 84), L. Schäfer (1971, S. 96 – 120) und J. Schmucker (1990, S. 260 – 273) haben das Verhältnis zwischen dem zweiten Hauptstück und dem Anhang zur Transzendentalen Dialektik explizit thematisiert. Das Verhältnis zwischen dem dritten Hauptstück und dem Anhang zur Transzendentalen Dialektik wird wiederum von V. Bazil (1995), C. Piché (1984, S. 91 – 120), P. Bahr (2004, S. 244 – 254), R. Theis (2004, S. 77 – 110), B. Longuenesse (1995, S. 521 – 537), S. Maly (2012, S. 265 – 277), R. Schneider (2011, S. 138 – 166), S. Andersen (1983, S. 157 – 184), M. Albrecht (1981, S. 475 – 484) und G. Gava (im Ersch.) untersucht. Wesentlich weniger Forschungsinteresse (I.b) zieht der Anhang zur Transzendentalen Dialektik ausgehend von den Untersuchungen des Ersten Buches zur Transzendentalen Dialektik auf sich. Hervorzuheben sind dabei die Arbeiten von T. M. Seebohm (2001, S. 219 – 230), N. F. Klimmek (2005, S. 57 – 116), K. W. Zeidler (2011, S. 297 – 320), U. Santozki (2006, S. 68 – 71, 120 – 127), R. Theis (2010, S. 211 – 214) und A. Renaut (1998, S. 353 – 367). Neben diesen inhaltlichen Fokussierungen auf die metaphysischen Gegenstände Seele, Welt und Gott und ihre regulative Funktion steht der Anhang zur Transzendentalen Dialektik auch im Fokus von Untersuchungen zur logischen Struktur und zum systematischen Aufbau der Transzendentalen Dialektik (I.c). Insbesondere J. Pissis (2012, S. 189 – 216; 2011, S. 209 – 219), M. Grier (2001, S. 263 – 306), K. M. Thiel (2008, S. 170 – 186), N. F. Klimmek (2005, S. 17 – 51), A. Hutter (2003), W. Vossenkuhl (2001, S. 232 – 244), R. Bittner (1970) und D. Henrich (1982, S. 45 – 55) haben dazu in den letzten Jahrzehnten zentrale Beiträge veröffentlicht. Zudem seien die Studien von T. M. Seebohm (2001, S. 204 – 231), M. Reisinger (1988), N. F. Klimmek (2005, S. 17 – 39), K. W. Zeidler (1992, S. 121 – 164) und W. Marx (1981, S. 211 – 235) erwähnt, die die schlusslogische Struktur der Transzendentalen Dialektik und ihre Rolle für den regulativen Vernunftgebrauch im Anhang zur Transzendentalen Dialektik untersuchen. Auch ausgehend von der Transzendentalen Analytik (II.) werden immer wieder Aspekte des Anhangs zur Transzendentalen Dialektik beleuchtet. Insbesondere N. F. Klimmek (2005, S. 40 – 51), aber auch M. L. Miles (1978, S. 288), V. Bazil (1995, S. 39 – 74) und G. Lehmann (1971, S. 12) sind in diesem Sinne zu erwähnen.
Ein reges Forschungsinteresse am Anhang zur Transzendentalen Dialektik besteht zweitens ausgehend von der Kritik der Urteilskraft. Dabei wird der Anhang zur Transzendentalen Dialektik (I.) als eine bestimmte Entwicklungsstufe der Konzeption der reflektierenden Urteilskraft, insbesondere in der teleologischen Urteilskraft, angesehen. Im Zentrum steht dabei zumeist der erste Teil des Anhangs zur Transzendentalen Dialektik. Hervorzuheben sind die Studien von H. Ginsborg (1990, S. 174 – 192), C. La Rocca (2012, S. 13 – 31), G. Zöller (2012, S. 31 – 49), W. Bartuschat (1972, S. 7 – 54), K. W. Zeidler (2006, S. 41 – 57; 1994, S. 25 – 40), M. Liedtke (1964, S. 108 – 157), J. Peter (1992, S. 17 – 51), K. Düsing (1968, S. 24 – 51), A. Stadler (1874, S. 18 – 43), A. Model (1987), K. Kuypers (1972), I. Bauer-Drevermann (1956, S. 497 – 504), G. Schiemann (1992, S. 294 – 303), H. Hoppe (1969, S. 16 – 19), A. Seide (2013, S. 84 – 89), G. Krämling (1985, S. 103 – 120), G. Lehmann (1971, S. 7 – 17), B. Dörflinger (2000, S. 7 – 26) und Ch. Wohlers (2000, S. 199 – 243). Zudem wird (II.) der Zweckbegriff, wie er im Anhang zur Transzendentalen Dialektik anhand des regulativen Vernunftgebrauchs entwickelt wird, mit dem Konzept der Zweckmäßigkeit in der Kritik der Urteilskraft u. a. von S. Klingner (2012, S. 94 – 98), R.-P. Horstmann (1997b, S. 165 – 180), W. Ernst (1909, S. 43 – 66), A. Pfannkuche (1901, S. 51 – 71) und R. Hiltscher (1998, S. 25 – 130) thematisiert.
Drittens ist der Anhang zur Transzendentalen Dialektik auch Untersuchungsgegenstand im Hinblick auf Kants praktische Philosophie. Dabei wird insbesondere die Rolle regulativer Ideen an der Schnittstelle von theoretischer und praktischer Philosophie u. a. von O. O’Neill (2015, S. 13 – 38; 1989, S. 13 – 37; 1996, S. 206 – ...