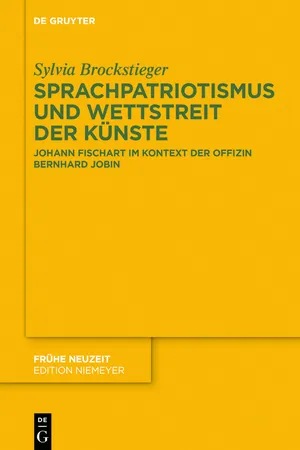1Einleitung
Die vorliegende Studie setzt sich zum Ziel, das Profil der Straßburger Offizin Bernhard Jobins nachzuzeichnen, die am Ende des sechzehnten Jahrhunderts, nicht zuletzt aufgrund der Beteiligung Johann Fischarts als ihres wichtigsten und einflussreichsten Mitarbeiters, die literarische Landschaft Straßburgs entscheidend prägte. Dies soll jedoch nicht, wie im Falle der meisten anderen wissenschaftlichen Studien zu einzelnen Druckerverlegern, in primär buchwissenschaftlicher Perspektive geschehen.1 Vielmehr werden mit einem ausdrücklich literaturwissenschaftlichen Ansatz anhand eines klar umrissenen Korpus, das angesichts der Weite des Straßburger Textuniversums nur auf strenger Auswahl beruhen kann, bestimmte literatur- und kulturhistorische Problemlagen der Zeit aufgearbeitet, die zusammen mit dem Methoden- und Konzeptrahmen in den folgenden Abschnitten dieser Einleitung zu entwickeln und zu begründen sein werden. Der Literaturbegriff, der dabei zugrundegelegt wird, ist im Sinne des Literatursystems der Frühen Neuzeit ein erweiterter: Sachtexte spielen ebenso eine Rolle wie die sogenannte schöne Literatur, wobei die Interferenzen vielfältig sind. Eine Unterscheidung zwischen ‚hoher‘ oder ‚niederer‘, hoch- oder minderwertiger Literatur wird nicht vorgenommen. Zudem arbeitet die Studie, auch wenn sie sich als eine germanistische versteht, nicht ausschließlich mit deutschsprachigen Texten, sondern zieht, sofern es der Argumentation dienlich ist, auch solche anderer Sprachen, vor allem des Lateinischen, heran.2
Im Zentrum des Interesses steht die Frage, wie die Offizin Jobin, ihre Mitarbeiter, ihre Autoren und ihre Texte am literatur- und kulturpolitischen Diskurs des späten sechzehnten Jahrhunderts, also der Jahrzehnte vor Martin Opitz und seinem epochemachenden Buch von der deutschen Poeterey (1624), partizipieren, wie sie über explizite Programmatik oder implizite literarisch-poetische Strategien den Wert der ‚deutschen Nation‘ beweisen und dabei zugleich die Qualität der deutschen Sprache als Literatursprache demonstrieren. Die ‚Arbeit am Deutschen‘ speist sich dabei aus der Auseinandersetzung mit alten Autoritäten, also den klassischen Sprachen, und neuen Autoritäten wie den bereits stärker etablierten romanischen Vernakularsprachen. Deren Vorgaben werden rezipiert, modifiziert, imitiert, weiterentwickelt, mit autochthonen Angeboten abgeglichen und zuweilen auch zurückgewiesen, um so das Deutsche für den Wettstreit, paragone, der Sprachen fit zu machen. Die deutsche Kultur und Nation als Ganzes wird an den Kulturleistungen der Antike und denen der zeitgenössischen Romania gemessen. Dass all diesen theoretischen wie praktischen Bemühungen ein deutlich spürbarer Überbietungsgestus (aemulatio) innewohnt, ist eine der Kernthesen der vorliegenden Studie. Welche Formen und (literarischen, politischen) Funktionen dieser im Einzelnen annehmen kann, ist Gegenstand der Analysen.
Der dabei angenommene Kulturbegriff ist ein historischer, nicht im Sinne der Begriffsgeschichte oder historischen Semantik, sondern von der Sachgeschichte her kommend. Als Kultur werden im Folgenden alle menschlichen Errungenschaften begriffen, die in der frühneuzeitlichen epistemischen Ordnung eine Rolle spielen, seien es die Taxonomien der Wissenschaften und der Künste, seien es die Inhalte des enzyklopädischen Wissens, der Geschichte, der politischen Theorie und der Sittenlehre.3 Sprache und Literatur nehmen dabei eine Sonderstellung ein: Sie sind gleichermaßen „Kulturform[en]“4 sowie deren Medien. Ich gehe weiterhin davon aus, dass sich in der ‚deutschen Nation‘ zwei kulturelle Gefüge mit je unterschiedlichen Bedürfnishorizonten überlappen: die vernakulare Kultur und die Gelehrtenkultur. Wenn also von ersterer die Rede ist, so sind damit die epistemischen Strukturen und sozialen Praktiken einer breiteren, auf Deutsch kommunizierenden ‚Öffentlichkeit‘ gemeint.
Die am Jobin’schen Programm abzulesende Selbstvergewisserung in den Bereichen der Sprache, der Künste, der Sitten, der Politik und des Wissens – der Kultur also – hängt mit dem Gedanken der nationalen Vergemeinschaftung zusammen. (Humanistische) Reflexion über Nation ist am Ende des sechzehnten Jahrhunderts kein neues Phänomen mehr, doch trifft sie sich an diesem Ort der Literatur- und Kulturgeschichte mit dem ebenfalls humanistisch informierten Unternehmen, das Deutsche auf das Niveau einer klassischen Sprache zu heben – dem also, was probehalber als ‚volkssprachiger (Renaissance-)Humanismus‘ bezeichnet sei und was einige Jahre später bei Opitz zur vollen Entfaltung kommen wird. Dabei ist die Frage zentral, ob und inwiefern die Offizin Jobin mit Fischart als ihrem kreativen Zentrum als repräsentativ für ihre Zeit gelten darf oder ob es sich um eine exzeptionelle Konstellation handelt.
1.1Konzeptrahmen: Literaturgeschichtsschreibung im Zeichen von Region und Konstellation
Das sechzehnte Jahrhundert hat es in der Germanistik schwer: Nicht nur fällt es institutionell in eine Lücke zwischen der mediävistischen und der neueren Abteilung und liegt deswegen an der Peripherie der disziplinären Forschungsfelder, auch führen die Wege zu seiner Erforschung über das Minenfeld der durch eine lange literaturhistoriographische Tradition aufgebauten Vorurteile und Schieflagen. Lange hatte man aus der Perspektive der späteren Jahrhunderte vor allem das siebzehnte Jahrhundert im Blick und hierbei Opitz ganz im Sinne seines eigenen Selbstbilds zum Gründervater einer an antiken, italienischen, französischen und niederländischen Vorbildern ausgerichteten Literatur stilisiert, die, so die Großerzählung, ungebrochen auf die große kanonische (und protestantisch geprägte) Literatur des achzehnten Jahrhunderts und schließlich die der Weimarer Klassik zuläuft.5 Dass das sechzehnte Jahrhundert dabei retrospektiv als „wenig attraktive Vorgeschichte der Vorgeschichte“6 erscheint, ist nicht zuletzt auch das Verdienst des siebzehnten Jahrhunderts, das auf vielfältige Weise am Vergessen der literarischen Vätergeneration arbeitete.7 Auch Fischarts Werke ereilte dieses Schicksal: Lediglich bis in die 1620er Jahre blieben seine umfangreicheren Satiren – Aller Praktik Grossmutter, Geschichtklitterung, Podagrammisch Trostbüchlein, Binenkorb und Flöh Hatz – über zahlreiche Neuauflagen präsent8 und wurde sein ‚Stil‘ durch Nachahmer wie Georg Friedrich Messerschmid oder Wolfhart Spangenberg gepflegt, die bei den Nachfolgern Jobins, erst bei dem Sohn Tobias, dann bei Johann Carolus, satirische Schriften im Stile Fischarts herausbrachten.9 Selbst ein Verkaufsschlager wie der Binenkorb, eine Übersetzung Fischarts aus dem Niederländischen mit zwölf Auflagen bis ins erste Viertel des siebzehnten Jahrhunderts,10 fiel mit seinem Autor bald dem Vergessen anheim:
So erschien 1733, also etwa 150 Jahre nach der Erstpublikation des Binenkorb,11 unter dem Titel Gereinigter Bienenkorb eine neue hochdeutsche Übersetzung. Das Urteil des anonymen Verfassers über Fischarts Binenkorb ist vernichtend:
Dass man aber dieses Büchlein von neuem in das Hochteutsche übersetzet, da es doch vorlängst von einem, so sich Jesuwald Pickhart [Pseudonym Fischarts, Anm. S. B.] nennet, geschehen, ist Ursache: weil erstlich der so genannte Pickhart den wahren Auctorem gänzlich verschwiegen, dessen man sich doch gar nicht zu schämen hat. Vors zweyte, weil verschiedenes nicht accurat übersetzet ist, indem der Translateur das Holländische nicht recht verstanden, auch ganz gemeine Wörter nicht einmahl Teutsch zu geben gewusst: Drittens, weil er daher manches gar ausgelassen, und vor sich ander Zeug aus seinem Gehirn hinein geflickt, so in des wahren Auctoris Buch nicht stehet.12
Fischarts Sprachkompetenz wird angezweifelt, seine amplifizierende Schreib- und Übersetzungsweise13 vor dem Hintergrund veränderter Übersetzungsideale des achtzehnten Jahrhunderts kritisiert. Zudem scheint – wenn es sich in diesem Fall nicht um eine Geste der bewussten damnatio memoriae handelt – Anfang des achtzehnten Jahrhunderts das Wissen um die Auflösung des Pseudonyms Fischarts und damit um den Autor des ersten hochdeutschen Bienenkorbs verlorengegangen zu sein. Erst im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts und besonders um 1800 sollte das Interesse an den verschütteten Autoren des sechzehnten Jahrhunderts und ihren Texten aufs Neue erwachen.14
Zwar ist die Bedeutung Opitzʼ und des schlesischen Paradigmas durch die Erschließung zeitgenössischer Alternativangebote – man denke an die oberdeutsche Literatur,15 an Georg Rodolf Weckherlin und andere16 – relativiert worden, zwar hat die jüngere Forschung das sechzehnte Jahrhundert zunehmend wiederentdeckt und zahlreiche Traditionslinien herauspräpariert, die auf Opitz zulaufen und in seiner normativen Poetik verknüpft oder auch umakzentuiert werden.17 Dennoch bleibt das sechzehnte Jahrhundert, besonders seine zweite Hälfte, ein „Stiefkind der Literaturgeschichtsschreibung“18 und ist das Opitz-Narrativ für die Erforschung der frühneuzeitlichen nationalliterarischen Anliegen nach wie vor äußerst wirkmächtig.19
Die Unsicherheit der Forschung spiegelt sich in den zahlreichen terminologischen Angeboten zur näheren Charakterisierung der Zeit um 1600 wider. Vom „Späthumanismus“20 ist zuweilen die Rede, vom „Manierismus“21 oder auch, für die Opitz-Zeit, vom „Vorbarock“22. Dass zumeist ein ‚vor‘, ‚früh‘ oder ‚spät‘ im Begriff aufzufinden ist, hängt mit eben jenem problematischen Versuch zusammen, den in vielerlei Hinsicht sperrigen Zeitraum von etwa der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts bis hin zu Opitz in die Teleologie der gelungenen Literatur- und Literatursprachenentwicklung einzupassen, ihn also an den Maßstäben des ‚davor‘ und ‚danach‘ zu messen und zu bewerten. So kann er nur verlieren. Eine andere, anti-teleologische Herangehensweise ist nötig, um gerade den Eigenwert und die Besonderheiten dieser Zeit herauszuarbeiten und damit auch jene Entwürfe und Experimente auf dem Feld der Literatur- und Spracharbeit sichtbar zu machen, die, schnell vergessen, in der Erfolgsgeschichte der deutschen Literatur keinen Platz gefunden haben.
Dieser alternative Blick auf die Literaturgeschichte wurde im Rahmen der dritten Förderphase des Teilprojekts A3 (Auctoritas und imitatio veterum) des Münchner Sonderforschungsbereichs 573 Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit unter der Leitung von Jan-Dirk Müller erprobt.23 Man ging hier von der Vorstellung aus, dass sich im Laufe des sechzehnten Jahrhunderts abseits der Kernlandschaften der späteren Literatursprachenentwicklung, also besonders im deutschsprachigen Südwesten, sowie „abseits der klassi...