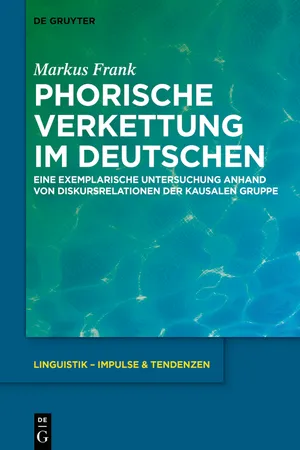1.1Phorische Verkettung unter kognitiver Perspektive
Die menschliche Kommunikation mithilfe von Sprache ist auf den ersten Blick ein Prozess, der den Anschein erweckt, als würde er in allen Facetten vom Menschen bewusst gesteuert. Vom frühkindlichen Spracherwerbsprozess an wird der Mensch darauf trainiert, sich innerhalb der sprachlichen Konventionen zu bewegen, die sich in einer Sprechergemeinschaft etabliert haben. Bei der Wahl der eingesetzten Wörter, beim Satzbau, der Artikulation - um nur einige sprachliche Aspekte zu nennen - ist der Sprecher weitgehend flexibel darin, die zu übermittelnde Information so zu gestalten, wie er es in der konkreten Situation wünscht. Eine Grenze wird lediglich an demjenigen Punkt eingezogen, an dem die Kommunikation mit dem Gegenüber scheitert, da die Flexibilität die von der Sprechergemeinschaft etablierte Norm zu sehr verletzt, um den Kommunikationszweck zu erfüllen. Die freie Wahl vieler Kommunikationsmittel innerhalb dieses Rahmens, also beispielsweise die Benutzung synonymer Substantive, Paraphrasen oder von Pronomina obliegt jedoch dem Sprecher und wird von diesem so gewählt, wie es der konkreten Äußerungssituation angemessen erscheint.
Diese Freiheit in der Gestaltung sprachlicher Kommunikation ist aber eine Illusion: Zwar ist nicht bestreitbar, dass die Syntax, die Grammatik und auch die Lexik einer Sprache in vielen Fällen theoretisch eine hohe Flexibilität beim Einsatz der sprachlichen Mittel und der Ausgestaltung des Kommunikationsprozesses erlauben. Jene Flexibilität wird jedoch im realen Kommunikationsprozess massiv beschränkt durch die Funktionsweise der menschlichen Kognition. Diese limitiert in allen denkbaren Szenarien und Situationen sowohl die Komplexität auch die Möglichkeiten zur Realisierung sprachlicher Äußerungen. Die Kognition beschränkt konkret die Menge an Information, die zu einem gewissen Zeitpunkt verarbeitet werden kann, was sich direkt auf das menschliche Sprachsystem niederschlägt: Alle Ausdrücke einer Sprache (vom Wort bis hin zum Satz und Diskurs) sind so beschaffen, dass sie innerhalb dieser Beschränkungen operieren können. Da diese Beschränkungen physikalisch an die Funktionsweise des menschlichen Gehirns rückgekoppelt sind, besteht für den Menschen keine Möglichkeit, die Beschränkungen zu umgehen. Für das Sprachsystem relevant ist dabei vor allem die Menge an Information, die gleichzeitig in aktiviertem Zustand gehalten werden kann, die Modalitäten zur Aktivierung, Deaktivierung und Reaktivierung von Information und ferner die Fähigkeit, einfachere Informationseinheiten zu komplexeren Einheiten zu verschmelzen.
Aber auch ohne die Möglichkeit, die Grenzen zu erweitern, kann dennoch darauf geachtet werden, die Ressourcen, welche ein derartiges System liefert, mehr oder weniger vorteilhaft zu nutzen: Ein effizientes Sprachsystem wird daher so beschaffen sein, dass es grundlegend die vorhandenen kognitiven Ressourcen optimal nutzt, und weniger effiziente Nutzungsarten im Einklang mit evolutionsbiologischen Basisprinzipien sich sowohl im Individuum als auch in den Konventionen einer Sprechergemeinschaft langfristig nicht durchsetzen. Eine derartige optimale Nutzung besteht darin, den Informationsgehalt einer sprachlichen Aussage so umfangreich zu gestalten, wie für eine konkrete Kommunikationssituation erforderlich, und für deren Verarbeitung so wenige kognitive Ressourcen zu belasten wie notwendig (siehe Kapitel 2.4) - eine klassische Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses zum Erreichen eines fest gesetzten Ziels, welches hier in einem geglückten Kommunikationsakt besteht.
Sprachliche Phänomene, die aus dieser Ressourcen-Effizienz resultieren, sollten theoretisch in allen authentischen sprachlichen Diskursen beobachtbar sein, ohne dass sich die Sprachbenutzer dieser Phänomene tatsächlich bewusst sind und ohne dass sie bewusst eine effizientere Kommunikation einer weniger effizienten Kommunikation vorziehen würden. Es ist davon auszugehen, dass die Parameter menschlicher Kognition sich auch in kompletten Sprachsystemen bzw. Sprachen niederschlagen, wenn diese Systeme als Produkt von Konventionalisierungsprozessen gesehen werden, an denen alle Sprecher der jeweiligen Gemeinschaft beteiligt sind und von denen jeder Einzelne wiederum die oben genannten kognitiven Limitierungen aufweist.
Welche konkreten sprachlichen Phänomene könnten Hinweise geben auf dieses unbewusste Streben nach Effizienz im Diskurs? Grundsätzlich sind hier mehrere verschiedene Ansatzpunkte denkbar, für die hier vorliegende Arbeit jedoch wird sich auf ein Phänomen beschränkt, welches besonders stark von einem Streben nach kognitiver Ökonomie geprägt scheint: Die Verwendung (Ana)phorischer Ausdrücke, mit dem Ziel, verschiedene Teile eines Diskurses referenziell zu verketten. Eine derartige phorische Verkettung bedeutet, dass Diskurssegmente wie Sätze oder Paragraphen durch das Wiederaufgreifen von Diskursgegenständen zu einem zusammenhängenden Ganzen verbunden werden. Phorische Ausdrücke, zumeist Anaphern, operieren hierzu als Verweisstrukturen maßgeblich über die Satzgrenze hinweg und sind immer dann besonders relevant, wenn mehrere Aussagen über ein und denselben Diskursgegenstand getroffen werden, was im authentischen Diskurs den Normalfall darstellt:
| (1) | In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. [...] Dieser Hobbit war ein sehr wohlhabender Hobbit, und er hieß Beutlin. [...] Unsere Geschichte nun handelt von einem Beutlin, der dennoch in Abenteuer hinein geriet und |
| der sich dabei ertappen musste, wie er Dinge sage und tat, die ihm niemand zugetraut hätte. Die Achtung seiner Nachbarn mag er dabei verloren haben,aber er gewann - na, ihr werdet ja sehen, ob er am Ende auch etwas gewann. [...] (John R. R. Tolkien 1937: Der Hobbit) |
In Beispiel (1) ist der Hobbit zunächst lokaler Handlungsträger (das lokale Topik), er wird mehrmals anaphorisch aufgegriffen und verkettet auf diese Wiese die syntaktisch separaten Diskursfragmente zu einer geordneten Abfolge zusammengehöriger Aussagen über eben diesen Handlungsträger, dem übergeordneten Diskurs. Ohne diese Technik der phorischen Verkettung von Aussagen wären zusammenhängende Diskurssegmente oder auch ganze Diskurse in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht realisierbar.
Für die hier vorliegende Arbeit wurde das phorische System als Untersuchungsgegenstand gewählt, da sich anhand dieses Systems die bewussten aber vor allem auch die unbewussten Effekte eines kognitiven Strebens nach Effizienz anschaulich und nachvollziehbar untersuchen lassen. Phorische Ausdrücke werden grundsätzlich so verwendet, dass sie möglichst wenig Information transportieren, und dass der Hörer oder Leser dennoch in der Lage ist, den korrekten Diskursgegenstand unter denjenigen Gegenständen zu identifizieren, die sich zu einem gewissen Zeitpunkt in aktiviertem Zustand in seinem Arbeitsgedächtnis befinden. Zwar kann es in einzelnen Sprachen Konventionen und daraus resultierend Phänomene geben, die dem Prinzip nach Effizienz auf den ersten Blick widersprechen, im Laufe der Arbeit (Kapitel 3.3.1.2) wird jedoch gezeigt, dass selbst derartige Abweichungen als Epiphänomene eines Strebens nach kognitiver Ökonomie im Diskurs gesehen werden können, welches hier aber auf höhere hierarchische Ebenen im Gesamtdiskurs abzielt.
Ziel dieser Arbeit ist es nun, die theoretisch postulierte Ressourceneffizienz konkret empirisch nachzuweisen und damit weitreichende Erkenntnisse zu gewinnen über die kognitiven Mechanismen, welche die Verwendung phorischer Ausdrücke beeinflussen. Dies soll sowohl Aufschluss über die produzentenseitige Verwendung phorischer Ausdrücke als auch über die rezipientenseitige Verarbeitung derselben geben und damit einen Beitrag leisten zum besseren Verständnis der konkreten Gestaltung sprachlicher Systeme in diesem Bereich. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung liegt dabei auf solchen Effekten, welche die beobachtbare Oberflächenstruktur von Texten verändern, ohne dass diese Veränderungen dem Rezipienten oder dem Produzenten eines Textes bewusst werden.
Glücklicherweise kann die hier vorliegende Arbeit auf einem breiten Spektrum an Vorarbeiten zur Thematik der Phorik im Allgemeinen und zur kognitiven Verarbeitung von Anaphern im Speziellen aufbauen, so dass es davon ausgehend möglich ist, ein klassisches zweiteiliges Forschungsdesign anzulegen: Auf Basis der Vorarbeiten und unter Hinzuziehung eigener Überlegungen lässt sich eine Reihe gut operationalisierbarer Hypothesen aufstellen, die im Anschluss mithilfe einer korpuslinguistischen Studie statistisch überprüfbar sind. Die empirische Studie trägt dabei einen exemplarischen Charakter, konzentriert sie sich doch aus Machbarkeitsgründen nur auf ein anaphorisches System, nämlich dasjenige des Deutschen. Ergänzend soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Methode ohne größeren Aufwand jedoch auch auf andere Sprachen wie das Englische übertragbar ist.
Um die Ressourceneffizienz zu empirisch zu erfassen, definiert die vorliegende Arbeit auf Basis von theoretischen Vorüberlegungen und bereits etablierten Klassifizierungssystemen zunächst eine eigene Taxonomie für die Klassifikation von phorischen Ausdrücken des Deutschen (Kapitel 3.3.3 und 3.4.3). Diese Taxonomie wird anschließend angewendet auf ein deutschsprachiges Zeitungskorpus, welches explizit mit dem Ziel zusammengestellt wird, die Auswirkungen des kognitiven Strebens nach maximaler Effizienz im phorischen System messen zu können (Kapitel 5.2). Um dieses Ziel zu erreichen, ist das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Korpus das Ergebnis eines mehrstufigen Extraktionsprozesses. Extrahiert werden nach strengen Vorgaben Textfragmente aus bereits vorhandenen Zeitungskorpora mit mehreren Milliarden Wörtern Umfang. Die Messungen erfolgen somit auf einem Kondensat an authentischen Diskurselementen, welche für die Auswertung optimiert wurden. Mithilfe dieses annotierten Korpus wird es im Anschluss möglich sein, ein relativ umfangreiches Spektrum von unbewusst ablaufenden Effizienzphänomenen des phorischen Systems auf der Textoberfläche zu erfassen und detailliert zu vermessen.
Die Ergebnisse dieser Messungen sowie deren anschließende Interpretation liefern schließlich einen interdisziplinären Beitrag zur Grundlagenforschung in mehreren Bereichen:
–Die Ergebnisse stützen grundlegende Forschungsansätze im kognitiven und neuropsychologischen Bereich, näher die Annahmen zur Kapazität des menschlichen Arbeitsgedächtnisses, zur Aktivierung, Deaktivierung und Reaktivierung von Information sowie zur Konstruktion mentaler Modelle, welche aus rezipierter Information bestehen, die mit zusätzlicher Information aus dem Langzeitgedächtnis angereichert wird. Was in früheren Studien mittels relativ artifizieller Experimentalsituationen nachgewiesen wurde, erweist sich auch in größeren, korpuslinguistisch gewonnenen Datensätzen authentischer Diskurse als gültig, wie sie für die vorliegende Arbeit untersucht wurden.
–Die Studie legt die Gültigkeit sehr allgemein gehaltener linguistischer Metatheorien wie die Relevanztheorie oder die Neo-Grice Theorie nahe. Alle beobachteten Phänomene bewegen sich im vorgegebenen Rahmen einer Maximierung der Effizienz sprachlicher Handlungen, welchen diese Theorien vorgeben.
–Die Studie zeigt ferner, dass sich sprachwissenschaftliche Theorien zu Ausgestaltung und Gebrauch des anaphorischen Systems so operationalisieren lassen, dass ihre Vorhersagen konkret quantitativ messbaren Effekten in einer korpuslinguistischen Studie zugeordnet werden können. Ein einziger Korpus-Datensatz ermöglicht es, in der hier vorliegenden Arbeit Phänomene zu erforschen, die zuvor in verschiedenen Forschungsdesigns mit unterschiedlicher Methodik und mit jeweils wechselnden Blickwinkeln untersucht wurden. Alle Effekte zeigen sich hier konsistent in nur einem Datensatz, was die Aufgabe erleichtert, die Beobachtungen einem einheitlichen theoretischen Rahmen zuzuordnen.
Für weitere Forschungen im Bereich der referenziellen Kohärenz von Texten stellt die vorliegende Arbeit also Folgendes zur Verfügung:
–Einen mehrschichtigen theoretischen Komplex zur Beschreibung der kognitiven Determinanten von phorischen Systemen, welcher nicht nur in sich kohärent aufgebaut ist sondern zusätzlich in seinen Teilen empirisch evaluiert wurde. Der Theoriekomplex vernetzt dabei die Teildisziplinen der (Neuro)Psychologie, der Kognitionswissenschaften sowie der Linguistik zur Erklärung des zentralen Phänomenkomplexes Phorik.
–Eine Taxonomie zur Klassifikation von phorischen Ausdrücken des Deutschen. Diese ist modular aufgebaut, der Austausch der spezifischeren unteren taxonomischen Schichten erlaubt eine flexible Anpassung der Systems an andere Sprachen.
–Ein empirisches Messverfahren zur Operationalisierung von kognitiver Effizienz im phorischen System, welches auf authentische Sprachdaten angewendet werden kann.
Der Datensatz zur statistischen Auswertung sowie die Korpus-Rohdaten zur vorliegenden Studie können unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.vdk.gwi.uni-muenchen.de
1.2Der Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit setzt sich maßgeblich aus zwei Teilen zusammen: Einer Abhandlung über die theoretischen Grundlagen des Forschungsvorhabens im ersten Teil und der konkreten empirischen Durchführung desselben mittels einer korpuslinguistischen Studie im zweiten Teil. Trotz der formalen Abtrennung sind beide Teile eng aufeinander bezogen: Im Verlauf des theoretischen Teils werden nicht nur die Grundlagen für die empirisch zu überprüfenden Hypothesen gelegt, es werden auch die Werkzeuge definiert, die im Rahmen der korpuslinguistischen Studie zum Einsatz kommen. Die Ergebnisse der korpuslinguistischen Studie wiederum werden zur Bestätigung des theoretischen Fundamentes herangezogen sowie zur Anstoßung und Diskussion weiterführender Forschungsfragen.
In den anschließenden Abschnitten wird ein kurzer Abriss über den Aufbau der gesamten Arbeit und die logische Abfolge der einzelnen Kapitel gegeben, welcher dem Leser einerseits die Navigation durch die Arbeit erleichtern und andererseits den übergreifenden Argumentationsbogen der Arbeit verdeutlichen soll.
Die theoretischen Grundlagen teilen sich in zwei aufeinander folgende Oberkapitel, wobei das Erstere (2 Diskurskohärenz und ihre kognitiven Fundamente) als allgemeines theoretisches Fundament im Bereich der kognitiven Textlinguistik anzusehen ist, welches sowohl die Terminologie als auch Überlegungen zu basalen kognitiven Verarbeitungsmechanismen von Texten und deren neurophysiologischen Determinanten liefert, die sich für das zweite Oberkapitel (3 Das anaphorische Referenzsystem) als maßgeblich erweisen. Das erste der beiden Oberkapitel besitzt folgenden Aufbau:
2.1 Kohäsion und Kohärenz: Das erste Kapitel dient zur Hinführung an die für die Arbeit zentralen Beschreibungsebenen der Diskurskohäsion und Diskurskohärenz. Hier werden beide Phänomenbereiche voneinander abgegrenzt und deren Abhängigkeitsverhältnisse diskutiert. Ferner werden grundlegende Phänomenbereiche (relational und referenziell) sowie Beschreibungsdimensionen (lokal und global) von Textkohärenz dargestellt, welche für die weitere Arbeit und das Verständnis des anaphorischen Paradigmas von großer Bedeutung sind.
2.2 Mentale Repräsentationen und Textweltmodelle: Im nächsten Kapitel wendet sich die Arbeit der Beschreibung fundamentaler kognitiver Prozesse zu, welche sich auf lokaler und globaler Ebene verantwortlich zeigen für die Bildung kohärenter mentaler Textrepräsentationen. Besprochen werden sowohl Repräsentationsbausteine wie Frames, Skripte, Schemata und Diskursreferenten, als auch deren holistische Zusammenschlüsse zu größeren textbasierten Informationsclustern, den sogenannten Textweltmodellen. Auch wird an dieser Stelle ein erstes Moment kognitiver Ökonomiebestrebungen in die Arbeit eingebracht mit der Frage, wie holistisch solche Repräsentationen im Rahmen der konkreten Sprachverarbeitung tatsächlich ausfallen können.
2.3 Determinan...