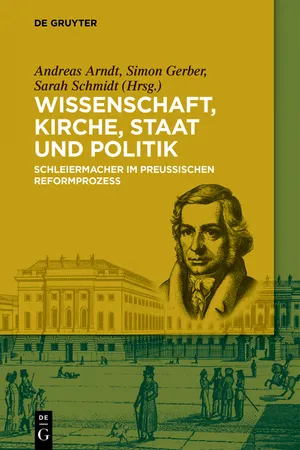Schleiermachers Schreibkalender
Kalender gehören zu den frühesten Druckwerken – schon 1455 erschien Gutenbergs Türken-Kalender. Seitdem bilden Kalender einen erheblichen Teil des Buchmarkts, bis zu den heutigen Wandkalendern, z. B. mit Abbildungen nach Kandinsky oder Raffael. Eine weitere langlebige Gattung sind die Volkskalender oder Bauernkalender: etwa der amerikanische Farmers’ Almanac (von 1818 bis heute) oder der Rheinländische Hausfreund, den Johann Peter Hebel zeitweise herausgegeben und durch seine „Kalendergeschichten“ unsterblich gemacht hat77.
Die besondere Gattung der „Schreibkalender“ ist zunächst ein Phänomen der frühen Neuzeit; das 16. Jahrhundert ist schon recht voll davon; der SchreibKalender D. Sebastiani Röder Physici und Mathematici auff das MDLXV. Jahr z. B. ist in Kopenhagen erhalten; die lange Serie der Kalender Thurneyssers beginnt 1579, und im 17. und 18. Jh. sind solche Kalender durchaus populär, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika. Der beliebte österreichische Krakauer Schreibkalender soll zeitweise in einer Auflage von ca. 250.000 Exemplaren gedruckt worden sein; erst im 20. Jahrhundert wurde er umbenannt in Österreichischer Schreibkalender. Die Frühgeschichte der Schreibkalender bis zum 18. Jahrhundert ist durch Harald Tersch78 und die daran anknüpfenden zahlreichen Publikationen einigermaßen aufgehellt; die breite Überlieferung des 19. Jahrhunderts in Bibliotheken und Archiven allerdings hat bislang kaum Beachtung gefunden.
Bei diesen Schreibkalendern handelt es sich (in der späteren Ausprägung) um vorgedruckte Taschenkalender mit Raum für (meist) tägliche Eintragungen, oft auch mit zusätzlichen Seiten für Briefwechsel, Kassenbuch und dgl. sowie mit mancherlei gedruckten Informationen im Anhang; insgesamt also das was man heutzutage (stark verkleinert) am Jahresende kostenlos in der Apotheke bekommt; damals (in der Goethezeit) wurden die Bändchen in verschiedenster Form von vielen Verlagen im Buchhandel vertrieben.
Inzwischen wurde allerdings seit ca. 1800 der geradezu standardisierte Titel „Schreibkalender“ weitgehend aufgegeben und durch eine unüberschaubare Vielzahl besonderer Titel verdrängt; dies hat den großen Nachteil, dass die Suche in Bibliotheken und Archiven sehr erschwert ist. Schleiermachers Schreibkalender vom Jahre 1809 (im renommierten Verlag Vieweg in Braunscheig) führt zunächst den Titel Erinnerungsbuch für das Jahr 1809, sodann aber als Sonder-Titel für den Hauptteil (das eigentliche Kalendarium) Schreibkalender 1809.
In der Goethezeit und im weiteren 19. Jahrhundert war das (oft jahrzehntelange) Führen eines solchen Kalenders durchaus gebräuchlich. Manches davon ist erhalten und oft auch veröffentlicht (Goethe, Schiller, E.T.A. Hoffmann, Eduard Gaertner, Mendelssohn Bartholdy)79. Nicht publiziert sind etwa die in Weimar verwahrten Kalender Karl Ludwig von Knebels aus dem Zeitraum 1770 –1834; ferner kann man vorläufig nennen Gottfried Schadow, Otto Ludwig (um 1850) und viele andere.
Während das eigentliche Tagebuch (etwa von Samuel Pepys [sprich pieps]; Tolstoi; Kafka; Thomas Mann) meist mehr oder minder reflektierender Natur ist, lädt der Schreibkalender typischerweise zum trockenen Registrieren des Alltags ein. Dieses nur die Fakten benennende Verfahren findet sich schon im 16. Jahrhundert bei dem Florentiner manieristischen Maler Jacopo da Pontormo, der vom 7.1.1554 bis zum August 1556 Buch führte über seine Mahlzeiten (oft mit seinem Kollegen Bronzino), sein Befinden und seine Krankheiten, über das Wetter und besonders über den Fortschritt seines Freskos im Chor der Kirche San Lorenzo; nur einmal schaltet er eine längere diätetische Reflexion ein80.
In diesem Stil hat auch Schleiermacher jahrzehntelang detaillierte Notizen zu seinem Tagesablauf gesammelt und (sofort oder auch erst nach mehreren Tagen) in vorgedruckte Schreibkalender eingetragen. Erhalten sind (im Nachlass im Archiv der BBAW) 19 Jahrgänge, und zwar 1808–1811 und 1820–1834. – Fragt man sich, ob Schleiermacher auch in den Jahren vor 1808 und in der Zwischenzeit (1812–19) Kalender geführt hat, so ist diese Frage nicht entscheidbar: die fehlenden Jahrgänge mögen verloren gegangen sein; andrerseits beginnt der Kalender von 1808 mit auffällig wenigen Eintragungen und füllt sich so recht erst ab Juni. Auch später verliert Schleiermacher immer wieder die Lust zu Eintragungen; so sind im Jahre 1810 die Tage vom 2. April bis zum 8. Mai nahezu ohne Notizen, ebenso die vom 2. Juli bis zum 2. September; ab dem 22. September finden sich keine Eintragungen mehr; der folgende Jahrgang 1811 enthält nur das Kassenbuch (und einige Notizen von der schlesischen Reise). Dies macht es wahrscheinlich, dass Schleiermacher auch in den folgenden Jahren keinen Antrieb verspürt haben mag, sich über seine Zeitverwendung (und seinen Briefwechsel etc.) Rechenschaft zu geben. Und auch, nachdem im Jahr 1820 die Überlieferung der Schreibkalender wieder einsetzt, bleiben bisweilen mehrere Monate ohne Einträge.
In den Kalendern notiert Schleiermacher nichts biografisch Schwergewichtiges, also keine Gedanken, Reflexionen, Werkpläne oder gar Bekenntnisse etc. Es ist mehr ein buchhalterisches Protokoll des Alltagsablaufs mit vielen, auch unerwarteten Details – private Spielverluste; häufige Lotterielose.
Der Januar 1809 ist durchaus typisch; er beginnt mit der Sonntags-Predigt in der Nikolaikirche, es folgt ein Besuch bei Gaß, abendliches Unwohlsein und Lektüre (wohl Vorlesung) zweier Gesänge der Odyssee; am Montag treibt der designierte Professor Studien zu seiner Politik-Vorlesung, besucht dann das Kollegium Karstens über Mineralogie, zu Mittag isst er mit Eichhorn in einem Lokal, besucht dann Schmalz und (vergeblich) Heindorf, empfängt anschließend einen kurzen Besuch des Ehepaars Schede und liest abends zwei weitere Gesänge aus der Odyssee (vor).
Faszinierend ist gerade die Vielfalt der Eintragungen, die in der Summe (und in Verbindung mit dem Briefwechsel) denn doch ein enormes biografisches Gewicht bekommen, zumal da über diese zweite Berliner Zeit (1807–1834) noch immer zu wenig bekannt ist. Mit großer Regelmäßigkeit sind also die an den Sonn- und Festtagen gehaltenen Predigten (meist mit Bibelstelle) notiert (sehr zum Nutzen der inzwischen abgeschlossenen, in Kiel bearbeiteten historisch-kritischen Edition sämtlicher Predigten), ebenso die Stunden der vielen Vorlesungen und auch der Sitzungen des Neutestamentlichen Seminars, ferner die Treffen im Predigerkränzchen oder im altphilologischen Kollegenkreis, der sogenannten „Griechheit“; aber auch in freier Geselligkeit, also besonders in der von Buttmann begründeten (und von Schleiermacher weitergeführten), durch ein Protokollbuch gut dokumentierten „Gesezlosen Gesellschaft“ oder auch der „Spanischen Gesellschaft“ (über die wir so gut wie nichts wissen). Hinzu kommt die Mitarbeit in der Kommission zur Erarbeitung eines neuen – 1829 erschienenen – Gesangbuchs (Gesangbuch-Conferenz), später die regelmäßige Mitarbeit im „Armen-Direktorium“. Der Besuch der Kunstausstellungen ist sorgfältig notiert, ebenso wie der von Opern oder andern musikalischen Veranstaltungen (auch in der Sing-Akademie, deren Mitglied Schleiermacher war). Wenn man solche Musik-Notizen zusammenstellt, so erhält man ein kleines biografisches Kapitel; dasselbe gilt für die private Lektüre (allein oder im Familienkreis) von Homer und Vergil bis zu Goethe oder den englischen Romanen Walter Scotts und den amerikanischen James Fenimore Coopers, meist in deutscher Übersetzung, wobei Schleiermacher oft vorliest und also auf Frau und Kinder Rücksicht nehmen muss81. – Die jährlichen Urlaubsreisen (teils mit Familie) sind ebenso buchhalterisch behandelt: Orte, Abfahrtszeiten, Namen der Hotels, auch Achsbrüche der Kutsche und dgl.
Gesundheitsprobleme der Familie wie auch die eigenen werden penibel notiert – besonders seine quälenden Magenkrämpfe sucht Schleiermacher zu lindern durch das „Baquet“, also die zum damals populären „tierischen Magnetismus“ gehörige Vorrichtung; heute würde man das alternative oder komplementäre Medizin nennen; es wurde wohl empfohlen von Schleiermachers Hausarzt, dem Hochschulkollegen und Naturarzt Christoph Wilhelm Hufeland, der seine schriftstellerische Laufbahn 1785 begonnen hatte mit einem Buch über Mesmer und sein Magnetismus.
Im übrigen sind die vielen Besucher (oft zum Mittag- oder Abendessen) regelmäßig eingetragen ebenso wie eigne (oft vergebliche) Besuche bei Freunden oder wichtigen Persönlichkeiten. Es gab übrigens lange Zeit in Berlin keine Stadtpost; man konnte sich allenfalls durch Boten anmelden, und die Besuche waren darum sehr oft vergeblich. Vom Familienleben ist wenig zu erfahren – allenfalls hin und wieder ein Spaziergang oder ein kleiner Ausflug, etwa mit den Kindern „bei den wilden Thieren“.
Meist sind die eingegangenen und ausgegangenen Briefe tabellarisch verzeichnet, was natürlich für die kritische Briefedition von größtem Nutzen ist.
Katechetik
In mehreren Kalendern hat Schleiermacher stichwortartig den Inhalt der jeweiligen Sitzungen des Konfirmandenunterrichts notiert und damit einen wertvollen Beitrag zu einer künftigen Edition dieses jahrzehntelang erteilten Unterrichts geliefert, den er keineswegs in der üblichen Form hielt. Denn gewöhnlich dauerte er ein Jahr und war als ritualisiertes Zwiegespräch üblich – Schleiermacher aber hielt in zwei Jahren eine Art Vorlesung, von der die Kinder (als Anfänger) so wenig verstanden, dass sie erst bei der Wiederholung im zweiten Jahr einigermaßen folgen konnten. Die Dokumente dieses Unterrichts (darunter auch Nachschriften) sind offenbar völlig singulär in der Epoche, zumindest ist nichts dergleichen bislang bekannt geworden. Darum hier ein Auszug:
11.6.1827: „Katechisation – Erklärung des Bösen in der Beziehung um die Entstehung des Glaubens an den Erlöser deutlich zu machen.“
12.6.: „Katechisation – allgemeine Erklärung der Liebe wurde gemacht und soll nun angewendet werden um den Unterschied zwischen der natürlichen und christlichen aufzufinden“
13.6.: „Katechisation – Vergleichung der lezten Erklärung des Bösen mit der früheren dass die Sünde Selbstsucht sei. – Wie nun durch zahme und wilde Sinnlichkeit ein entgegengeseztes Resultat entstehen könne“
Schleiermacher als Hörer
1808–09 besuchte Schleiermacher in Berlin die grundlegende mineralogische Vorlesung von Dietrich Ludwig Gustav Karsten (Professor an der Berliner Bergakademie) und hat fortlaufend Notizen in seinem Schreibkalender eingetragen, die sich freilich noch immer zum großen Teil gegen unsre Entzifferungsversuche sperren.
1809 hörte er die Vorlesung des berühmten Altphilologen Friedrich August Wolf über die Komödie Die Wolken des Aristophanes und hat auf den freien Blättern am Ende des Kalenders mehrere Seiten dazu beschrieben, die noch nicht entziffert werden konnten, zumal keine andere Überlieferung dieses Kollegs bekannt ist.
1827–28 besuchte er die berühmte (und einzige) Universitäts-Vorlesung Alexander von Humboldts über „physische Erdbeschreibung“, woraus später das Kosmos-Werk entstand. Kurze, meist lesbare Notizen dazu finden sich in den beiden entsprechenden Kalendern Schleiermachers.
Kassenbuch
Noch trockner als die täglichen Eintragungen ist das Kassenbuch, das meist auf gesonderten Seiten festgehalten ist; eintönig wirkende Einnahmen und Ausgaben bis h...