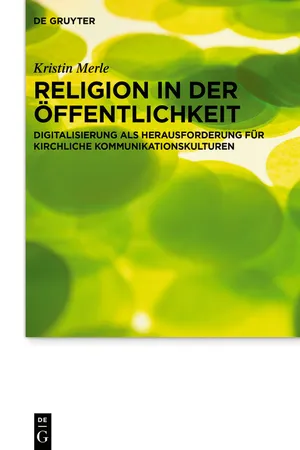
eBook - ePub
Religion in der Öffentlichkeit
Digitalisierung als Herausforderung für kirchliche Kommunikationskulturen
- 534 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Religion in der Öffentlichkeit
Digitalisierung als Herausforderung für kirchliche Kommunikationskulturen
Über dieses Buch
Kirche ist in ihrem Handeln konstitutiv auf Öffentlichkeit bezogen. Was bedeutet das angesichts der gegenwärtig stattfindenden medialen Transformationsprozesse? Als Kulturwandel stellt die Digitalisierung öffentliche religiöse Kommunikation vor neue Herausforderungen. Das zeigen unter anderem die hier vorgelegten Untersuchungen zu Formen und Foren symbolischen Sinndeutungshandelns online anlässlich der Debatte um die gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland. Im Zentrum der Studie steht das Interesse, den Gedanken eines reflexiv gestalteten Pluralismus als Leitidee (volks-)kirchlichen kommunikativen Handelns unter den Bedingungen der Emergenz interaktions- und partizipationsorientierter Öffentlichkeiten neu zu plausibilisieren.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Religion in der Öffentlichkeit von Kristin Merle im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Christliche Kirche. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Einleitung: Digitalität als kybernetische Herausforderung
Religion ist kommunikativ verfasst. Ein Nachdenken über Religion und Religiosität ist insofern auf die Reflexion der Bedingungen von Kommunikation verwiesen. Wer nach Religion und Religiosität in ‚der‘ Öffentlichkeit fragt, fragt nach den Voraussetzungen öffentlicher Kommunikation und nach der Genese von Öffentlichkeiten, innerhalb derer Religion und Religiosität thematisch werden und Gestalt gewinnen. Dabei unterliegt das, was gemeinhin und aus Gründen der Komplexitätsreduktion schlicht als ‚Öffentlichkeit‘ bezeichnet wird, mit der Digitalisierung von Kommunikation einem Strukturwandel. Doch nicht nur die strukturellen Dimensionen von Öffentlichkeit ändern sich, auch die subjektbezogenen Dimensionen sind Veränderungen unterworfen. Denn mit dem Strukturwandel von Öffentlichkeit1 geht, so kann angenommen werden, ein „subjektbezogener Bedeutungswandel von Partizipation“2 einher. Das Transformationspotenzial der Digitalisierung reicht indes über die Dynamisierung von Öffentlichkeit hinaus. Es durchdringt Gesellschaft und Kultur und manifestiert sich jenseits der Unterscheidung von Digitalem und Analogem, Immateriellem und Materiellem, Online und Offline. Um diese gesamtkulturelle Prägekraft der Digitalisierung zu unterstreichen, die nicht an konkrete technisch-mediale Kontexte gebunden ist, wird in dieser Arbeit auch von ‚Digitalität‘3 gesprochen.
An dem kulturellen Wandel, der sich unter anderem in einer Transformation ‚der‘ Öffentlichkeit manifestiert, partizipieren ebenfalls die Verständigungsprozesse von Menschen über ihre Situierung im Leben und in der Welt. Auch religiöse Kommunikation bekommt neue Foren und Formen. Insofern stehen die Kirchen vor kybernetischen Herausforderungen, die zugleich Potenzial bergen: Versteht man zum ersten die Konturierung von Kirche4 als eng verwoben in vielfältige gesellschaftliche Kommunikations- und Vermittlungsprozesse5 und zum zweiten die Konstitution von Kirche als grundgelegt durch religiöse Kommunikation – Kirche ist wesenhaft eine Kommunikationsgemeinschaft –, liegt die Einsicht nahe, dass ein Wandel gesellschaftlicher Kommunikationskulturen Veränderungen für kirchliche Kommunikationskulturen mit ihren kybernetischen Relevanzen mit sich bringt.6 Und das bedeutet wiederum, eingedenk der Digitalisierung als grundlegendes alltagsweltliches Phänomen: Kirche ist – mehr denn je – auf die Reflexion der medialen Bedingungen von Kommunikation angewiesen, um ihrem Öffentlichkeitsauftrag nachzukommen. Damit verbindet sich ein Nachdenken über ein Verständnis von Kirche, das offen ist für informelle, von der Kirche als konkreter Organisationsgestalt auch unabhängige Glaubensäußerungen in christlicher Perspektive.7 Zahlreiche neue, medial vermittelte Interaktionsformen ermöglichen etwa eine Affizierung des religiösen Bewusstseins und stellen religiöse Kommunikation als soziale Praxis dar, ohne dass der Faktor (konfessionell gebundener) ‚Kirchenmitgliedschaft‘ eine nennenswerte Bedeutung für die Konstitution von entsprechenden Kommunikationssituationen hätte.
Reiner Preul und Reinhard Schmidt-Rost heben eben jene kybernetische Relevanz der sich verändernden Kommunikationssituation hervor, wenn sie – bereits im Jahr 2000 und vorwiegend auf die ‚klassischen‘ Massenmedien bezogen – schreiben: „Es liegt auf der Hand, daß die Entstehung der modernen Mediengesellschaft auch die Kirche als Kommunikationsgemeinschaft tiefgreifend beeinflusst. Die Bedingungen der öffentlichen Wirksamkeit der Kirche werden neu bestimmt. […] Der Gestaltwandel der Kirche als Kommunikationsgemeinschaft regt die kybernetische Reflexion auf die Kirche als soziales System im Kontext des Ensembles gesellschaftlicher Institutionen an.“8 Dieser Befund dürfte in Zeiten der Digitalisierung von Kommunikation mit ihrem Transformationspotenzial, das sich nicht zuletzt in einer Neustrukturierung von Öffentlichkeit zeigt, mehr denn je gelten. Insgesamt findet sich die (Praktische) Theologie also herausgefordert, die kulturellen Wandlungsprozesse religionshermeneutisch in den Blick zu nehmen und nach den kirchentheoretischen Implikationen wie den Konsequenzen der Wandlungsprozesse für kirchliche Kommunikationskulturen zu fragen.
1.1Mediale Transformationsprozesse der Gegenwart
Die sich seit einigen Dekaden etablierende Digitalisierung von Kommunikation kann mit Friedrich Krotz als Kulminationspunkt im Metaprozess ‚Mediatisierung‘9 aufgefasst werden. Damit will gesagt sein, dass die Umbrüche, die wir gegenwärtig erleben, erhebliche sind, dass sie aber zugleich beschreibbar und damit kontextualisierbar in dem größeren Zusammenhang des Mediennutzungsverhaltens von Menschen überhaupt sind. Medien können ganz allgemein verstanden werden als „technische Institutionen, über die bzw. mit denen Menschen kommunizieren.“10 Medien sind in ihrer jeweiligen Ausformung dann Teil und Institution einer Kultur, wenn sie in den Alltag der Menschen und ihre Gesellschaft integriert sind und soziale und kulturelle Praktiken auf ihnen aufruhen. Medien können, wie es Andreas Hepp im Anschluss an Raymond Williams formuliert, auch „gleichzeitig als Technologie und kulturelle Form“11 begriffen werden. Menschen haben schon immer Medien gebraucht. Geht man davon aus, dass Medien sich nicht gegenseitig ablösen oder einander ersetzen12, wird der Prozess der Mediatisierung als Ausdifferenzierungsprozess beschreibbar, im Zuge dessen sich neue Kommunikationsformen anreichern, dies mit zunehmender medialer Komplexität, so dass mediale Kommunikation fortschreitend auf immer mehr Lebensbereiche ausgreift.13
Das Aufkommen der „neuen Basistechnologie“14 verändert die Art und Weise, wie Menschen ihren Alltag gestalten, wie sie miteinander ins Gespräch kommen und – vielfach öffentlich – aushandeln, wie sie sich selbst und die Welt verstehen. Medien wirken vor allem dadurch, dass sie von Menschen gebraucht werden, nicht primär schlicht über die Inhalte, die ‚transportiert‘ werden, auch nicht, weil ein Medium an sich spezifische Merkmale besäße.15 Medien und ihre Wirkungen sind nur im Zusammenhang mit menschlichem Handeln erfassbar, und in diesem Zusammenspiel liegt das Handlungspotenzial begründet, das man bestimmten Medien gegebenenfalls als spezifisches zuschreiben kann, das sich sekundär dann auch als Prägekraft eines Mediums entfaltet.16 In diesem Kontext kann von ‚Bedeutungsressourcen‘ gesprochen werden, die sich über technische Kommunikationsmedien vermitteln; der Begriff der ‚Ressource‘ mag noch einmal weiterführend sein, weil er darauf hinweist, dass die Genese von Bedeutung erst in Prozessen der Aneignung erfolgt.17 Kurzum: Das Aufkommen einer Technologie ist das eine Moment, die kulturelle Anverwandlung durch die Praktiken sozialer Akteure das andere Moment; beide zusammen erst bewirken die – kulturell relevante – Innovation.
Im Hintergrund der vorliegenden Studie steht nicht die Auffassung, dass, je zeitspezifisch, ein Leitmedium in besonderer Weise Auswirkungen auf Gesellschaft, Mensch und Kultur hat.18 Viel eher legt sich das Verständnis nahe, dass sich Medienkulturen durch „hochgradig komplexe Arrangements von verschiedenen Formen des medienbasierten, kommunikativen Handelns“19 auszeichnen. Kultureller und sozialer Wandel will insofern einerseits nicht linear, sondern mehrdimensional verstanden werden, und andererseits ist seine Ursache nicht primär lokalisierbar in einer bestimmten isolierbaren technologischen Innovation. Die Komplexität und Mehrdimensionalität der Mediatisierung zeigt sich noch einmal in der begrifflichen Definition von ‚Medienkulturen‘ und ‚Kultur‘ überhaupt, die Andreas Hepp, Marco Höhn und Jeffrey Wimmer vornehmen:
So können wir Medienkulturen als Kulturen definieren, deren primäre Bedeutungsressourcen durch technische Kommunikationsmedien in einem konfliktären Prozess vermittelt bzw. zur Verfügung gestellt werden. Kultur ist dabei eine Verdichtung von Klassifikationssystemen und diskursiven Formationen, auf die die Bedeutungsproduktion in alltäglichen Praktiken Bezug nimmt. Diese Definition berücksichtigt, dass keine Kultur jemals in der Form mediatisiert ist, dass jegliche ihrer Ressourcen exklusiv medial kommuniziert wird. Allerdings lässt sich argumentieren, dass in Medienkulturen ‚das Mediale‘ als Zentrum der Gesellschaft konstruiert wird, ein Prozess, in den neben den Medien verschiedene andere Institutionen einbezogen sind.20
Da der Mensch als animal symbolicum (Ernst Cassirer) in einer notwendig kommunikativ vermittelten symbolisch konstruierten Wirklichkeit existiert, hat die Veränderung von Kommunikation Konsequenzen für den Alltag der Subjekte, ihre Identität, Gesellschaft und Kultur.21 Geht man davon aus, dass Medien eine Grundlage für Kommunikation darstellen, ist anzunehmen, dass der gegenwärtige Medienwandel – als Teilprozess des Metaprozesses der Mediatisierung – beobachtbare Auswirkungen auf Kommunikation überhaupt hat, individuell wie institutionell, gesellschaftlich wie gruppenbezogen.22
* * *
Die bisherigen Anmerkungen zur Digitalisierung von Kommunikation wie zur Theorie der Mediatisierung zeigen die allgemeine kulturelle Relevanz der gegenwärtig stattfindenden Prozesse an. Handelt es sich im alltäglichen Erleben und Prozessieren um „komplexe Arrangements von verschiedenen Formen des medienbasierten, kommunikativen Handelns“23, so weckt insbesondere die internetmediale Kommunikation als neue Kommunikationsmöglichkeit – man müsste richtigerweise von einem Bündel neuer Formen sprechen – hinsichtlich ihrer Ausprägungen und Potenziale das Forschungsinteresse, auch in theologischer Absicht. Wirft man einen Blick allein auf aktuelle Nutzungszahlen ‚des‘ Internets (die in der Regel im Moment der Nennung bereits im wahrsten Sinne des Wortes überholt sind), wird die abstrakte Relevanz dieser Form der Mediennutzung für das Selbstverständnis der Menschen und ihre Sozialität, ihre Kultur, zu einer konkreten. Jährlich werden im Rahmen der ARD/ZDF-Onlinestudie die aktuellen Zahlen für Deutschland erhoben. Auch wenn es in seiner Komplexität nicht leicht zu beschreiben ist – am ehesten noch als globale technologische Infrastruktur, die Kommunikation aller Art ermöglicht, dabei unterschiedliche Medien integriert und sich nicht zuletzt über das ‚Internet der Dinge‘ in die alltägliche Lebenswelt einschreibt – ist ‚das‘ Internet mittlerweile allgegenwärtig: Im Jahr 2017 sind 90% der Bevölkerung in Deutschland Onlinenutzer und -nutzerinnen; täglich sind 72,2% der ab 14-Jährigen online (damit ist, wie in den Jahren davor, ein Zuwachs im Vergleich zur letzten Erhebung im Vorjahr zu verzeichnen).24 Schaut man noch einmal nach der demografischen Verteilung, zeigt sich sogar, dass im Altersspektrum 14–59 Jahre über 90% ‚das‘ Internet nutzen, bei den über 60-Jährigen sind es dann ‚nur‘ noch 74,2%. Erwartungsgemäß sind die Tagesreichweiten der Internetnutzung bei den jüngeren Befragten relativ höher. Die tägliche Nutzungsdauer liegt bei durchschnittlich 149 Minuten, in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen sogar bei 274 Minuten, also viereinhalb Stunden. Man muss selbst bei diesen Ergebnissen noch den Faktor berücksichtigen, dass es bei der Beantwortung der Fragen nach dem eigenen Nutzungsverhalten „zunehmend schwerer wird, einzelne Internettätigkeiten tatsächlich auch dem Netz zuzuschreiben“25, wie etwa Chatten oder Whatsappen. Wie wird das flüchtige, gleichzeitig aber permanente Nachschauen auf dem in der Regel mit ‚dem‘ Internet verbundenen Smartphone erfasst, das das Eingehen oder Ausbleiben neuer Nachrichten kontrollieren soll? Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich soziale Praktiken online und offline mehr und mehr verschränken – mit Konsequenzen für die alltägliche Selbst- und Weltdeutung der Akteure...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- 1 Einleitung: Digitalität als kybernetische Herausforderung
- 2 Öffentlichkeit: strukturelle und funktionale Perspektiven auf ein komplexes Phänomen
- 3 Digitalisierung und religiöse Kommunikation
- 4 Empirische Öffentlichkeiten: Untersuchungen zu Dimensionen des Religiösen in onlinebasierten Kommunikationsgemeinschaften
- 5 Kirche und Öffentlichkeit: die medialen Transformationsprozesse und die Kommunikationskulturen der Kirche
- 6 Epilog
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Sachregister
- Personenregister