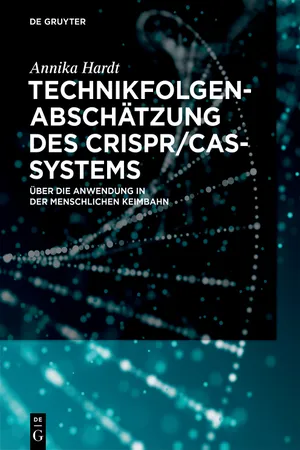1Einleitung
Neue Entdeckungen und Fortschritte in der Gentechnologie geben immer wieder Anlass zu bioethischen Diskussionen über die Chancen und Risiken dieser Methoden und Verfahren der Biotechnologie. Die Entdeckung und Beschreibung des CRISPR/Cas-Systems als potentielles Werkzeug in der Genomeditierung1 2012 hat der Forschung in diversen Bereichen der Molekularbiologie und Gentechnik in den letzten Jahren beträchtlichen Aufschwung verliehen.
Das CRISPR/Cas-System,2 ein in Bakterien gefundenes genetisch basiertes Abwehrsystem gegen Virus-DNA, soll als neue „Genschere“ die Verfahren zur gezielten Veränderung von Erbgut revolutionieren. Diese als Genomeditierung bezeichneten Verfahren beinhalten die Veränderung einzelner Gensequenzen etwa zur Ausschaltung bestimmter Gene, aber auch das Austauschen oder Einfügen von Gensequenzen oder sogar ganzer Gene. Eine präzise programmierbare „Genschere“, wie CRISPR/Cas es zu sein verspricht, ist für die Genomeditierung ein wichtiges Werkzeug. Dass sich die Komponenten des CRISPR/Cas-Systems im Labor als sehr einfach, schnell und kostengünstig zu synthetisieren herausgestellt haben, macht es für diverse Bereiche der Gentechnologie interessant. Die tatsächlichen und antizipierten Vorteile der neuen Technik geben auf unterschiedlichen Gebieten der gezielten Veränderung von Erbgut Anlass zur Erforschung ihres Potentials.
Zum einen verspricht die neue Methode in der grünen Gentechnik, vor allem in der Landwirtschaft, die Herstellung gentechnisch veränderter pflanzlicher Organismen zu revolutionieren. Dies gilt ebenso für die weiße Gentechnik, also für die industrielle Erzeugung und Nutzung gentechnisch veränderter Mikroorganismen, die beispielsweise bestimmte Enzyme für die Lebensmittelindustrie produzieren. Zum anderen wird der CRISPR/Cas-Methode in der roten, der medizinischen Gentechnik ein großes Potential hinsichtlich der Vereinfachung und Beschleunigung molekularbiologischer Eingriffe und Verfahren zugesprochen. Während in der Grundlagenforschung der medizinischen Gentechnologie etwa bei der Herstellung von Modellorganismen für bestimmte Krankheiten bereits von der CRISPR/Cas-Technik profitiert wird, ist die Erforschung ihres Potentials für die Gentherapie in Laboren rund um die Welt in vollem Gange.
Der Einsatz der CRISPR/Cas-Methode ruft jedoch nicht nur Begeisterung hinsichtlich des Potentials der Technik zur Vereinfachung und Verbesserung bestimmter Prozesse und Verfahren in der Gentechnologie hervor. Auf nahezu jedem der Anwendungsgebiete stößt der genetische Eingriff via CRISPR/Cas auch neue und alte kontroverse Diskussionen an. Während auf die Debatte etwa in der grünen Gentechnik um via CRISPR/Cas editierte Pflanzen nur hingewiesen werden kann,3 widmet sich diese Arbeit einem bioethisch besonders umstrittenen Bereich der medizinischen Gentechnologie: Der ethischen Diskussion um den medizinischen Eingriff in die menschliche Keimbahn.
Die Idee einer Keimbahntherapie, also erbbedingte Krankheiten im Genom der Keimzellen bzw. in der Keimbahn des sehr frühen Embryos mit der Einbringung gentherapeutischen Materials zu heilen, ist nicht neu. Der Gedanke, dass auf diese Weise auch allen nachfolgenden Generationen dieser therapeutische Effekt vererbt werden würde, wird schon in frühen Überlegungen zur Keimbahntherapie Ende der 1980er Jahre thematisiert – und ebenso lange schon kontrovers diskutiert. Dies unter anderem, weil auch jede ungewollte Veränderung in der Keimbahn auf jede nachfolgende Generation vererbt würde und nicht zuletzt, da der therapierte Embryo einem Eingriff nicht zustimmen kann. Die Vorstellung einer technisch machbaren Keimbahntherapie wurde jedoch immer wieder als Phantasma zurückgewiesen und lange Zeit schien sich die Wissenschaft einig, dass wegen ungeklärter ethischer Fragen, vor allem aber wegen technischer Risiken, ein Eingriff in die Keimbahn des Menschen nicht zu vertreten sei.
Spätestens seit 2015 der erste Versuch einer therapeutisch motivierten Genomeditierung menschlicher (nicht überlebensfähiger) Embryonen in China veröffentlicht wurde,4 droht jedoch die Schaffung von Tatsachen die Diskussion um die ethische Bewertung von Eingriffen in die menschliche Keimbahn zu überholen. Bis September 2018 sind einige weitere publizierte Experimente aus China,5 eines aus den USA6 und eines aus Großbritannien7 gefolgt, in denen das CRISPR/Cas-System als Methode zur Genomeditierung in menschlichen Keimzellen oder Embryonen eingesetzt wurde.8 Zu keinem Zeitpunkt der Geschichte der Gentherapie waren die Bestrebungen so ambitioniert, die technische Machbarkeit des Keimbahneingriffs beim Menschen zu erforschen, wie seit der Beschreibung des CRISPR/Cas-Systems. Zwar stehen einem klinischen Einsatz in der Keimbahn aus technischer Sicht nach wie vor sowohl Effektivität und Effizienz als auch Spezifität der CRISPR/Cas-Methode betreffende Schwierigkeiten entgegen – ganz abgesehen von allgemeinen Problemfeldern der Gentherapie, wie etwa geeigneter Vektoren. Es kann dennoch zum einen nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Forschung in Zukunft zur Verbesserung der Methode beitragen und ein Einsatz in der menschlichen Keimbahn als hinreichend sicher9 erscheinen könnte. Zum anderen sind viele der Argumente und Aspekte in der Diskussion um die ethische Vertretbarkeit einer solchen Intervention bereits bei der Erforschung der Methode relevant. Versuche wie die bisher veröffentlichten Experimente aus China, den USA oder Großbritannien sind bislang in Deutschland verboten, doch werden auch hierzulande im Rahmen der Debatte um die CRISPR/Cas-Technik erste Forderungen laut, das dem Verbot zugrunde liegende Embryonenschutzgesetz für die Erforschung der Methode an sog. „überzähligen“ Embryonen zu liberalisieren.10 Die Diskussion um die ethische Bewertung eines medizinischen Eingriffs in die menschliche Keimbahn muss der Entwicklung des Verfahrens unbedingt vorangehen. In Anbetracht der Aktualität der Problemstellung ist es das Ziel, mit diesem vorliegenden Buch hierzu einen Beitrag zu leisten, indem in Form einer Technikfolgenabschätzung folgender Leitfrage (F) nachgegangen wird:
Wie ist die Anwendung der CRISPR/Cas-Methode zur Therapie von Erbkrankheiten in der menschlichen Keimbahn unter medizinischen, rechtlichen, ethischen und sozialgesellschaftlichen Aspekten zu bewerten?
Die Untersuchung dieser Leitfrage findet unter der zentralen Hypothese (H) statt, dass eine Technikfolgenabschätzung des Eingriffs in die menschliche Keimbahn unter Berücksichtigung medizinischer, rechtlicher, ethischer und sozialer Implikationen zu dem Ergebnis führt, dass eine Zulassung allenfalls in einem therapeutischen Szenario, möglicherweise sogar gar nicht vertreten werden kann.
Hierzu wird sich zunächst der Fragestellung (F1) gewidmet, welche medizinischnaturwissenschaftlichen Voraussetzungen einem Keimbahneingriff zu therapeutischen Zwecken zugrunde gelegt werden müssten. Dies erfordert zum einen eine Ausarbeitung zum Stand der Technik der Gentherapie allgemein sowie eine detaillierte Darstellung des state of the art der CRISPR/Cas-Methode. Ebenso findet in diesem Kontext die Erläuterung einiger der zur Diskussion für eine Keimbahntherapie stehenden Erkrankungen statt. Zum anderen werden auch Überlegungen zur Möglichkeit des Einschätzens des Sicherheitsrisikos angestellt; dies insbesondere in Hinblick auf die immer wieder betonte hinreichende technische Sicherheit des Verfahrens, die Voraussetzung für einen Eingriff sei. Die Untersuchung dieser Fragestellung findet unter der Nebenhypothese (H1) statt, dass im Sinne einer Abwägung pragmatischer Argumente die unüberschaubaren Risiken den antizipierten Nutzen nicht aufwiegen können.
Zweitens wird der Frage (F2) nachgegangen, wie sich die ethischen Begründungsmuster darstellen, die in der Diskussion um die Intervention angeführt werden. Hierzu werden zum einen kategorische Argumente analysiert und geprüft, die vor allem ein ethisch zu begründendes Verbot von einer übergeordneten Idee oder Eigenschaft ableiten, die sich einer weiteren Abwägung entziehe. In diesem Zusammenhang wird nicht selten die Menschenwürde angeführt, die den Eingriff in die Keimbahn, dem das resultierende Individuum und die ebenso betroffenen, ihm nachfolgenden Generationen nicht zustimmen können, verbiete. Aber auch sog. Natürlichkeitsargumente oder religiös motivierte Argumente, die die Unantastbarkeit der Keimbahn mit deren Naturwüchsigkeit oder göttlichen Ursprung begründen, zählen zu dieser Kategorie. Diese Argumente werden im Hinblick auf die Annahme (H2) untersucht, dass insbesondere weltanschauliche oder religiöse Aspekte in einer säkularisierten Gesellschaft eine absolute Überzeugungskraft nicht geltend machen können. Zum zweiten sollen pragmatische Begründungsversuche untersucht werden, die einen Eingriff etwa als Teil des ärztlichen Auftrages oder im Sinne elterlicher Verantwortung nicht nur als zulässig bewerten, sondern unter Umständen sogar als verpflichtend betrachten. Diesen Positionen stehen weitere pragmatische Aspekte gegenüber, wie die notwendige Forschung an Embryonen sowie risiko- und sicherheitsbezogene Aspekte, die ebenfalls analysiert werden. Besonders interessant sind hier die Gesichtspunkte des sog. ungewussten Nichtwissens in der Wissenschaft, die auch im Hinblick auf die Annahme (H1), dass die Risken der Technik ihren Nutzen überwiegen, von Bedeutung sind.
Die dritte Kategorie der Begründungsmuster in der Debatte um den Keimbahneingriff stellen die gesellschaftspolitischen Argumente dar, die sich zudem auch mit der dritten Fragestellung (F3) auseinandersetzen: Welche sozialen Implikationen würde die Zulassung eines therapeutischen Eingriffs in die Keimbahn mit sich bringen? In diesem Kontext werden Befürchtungen von Dammbruch- oder slippery slope-Argumentationen untersucht, die unter anderem besagen, dass die Zulassung eines Eingriffs zu therapeutischen Zwecken mehr oder weniger zwangsläufig auch zur Zulassung nichtmedizinisch intendierter Interventionen führe. In diesem Rahmen werden ebenso Implikationen hinsichtlich des genetischen Enhancements, also der vermeintlichen Verbesserung des Erbguts, sowie Anklänge bezüglich einer neuen Eugenik thematisiert und nach einer Analyse bewertet. Aber auch Fragen bezüglich einer möglichen Stigmatisierung von Menschen mit Erbkrankheiten oder erbbedingten Behinderungen werden in diesem Zusammenhang untersucht, ebenso wie Implikationen im Hinblick auf einen möglichen sozialen Optimierungs- und Leistungsdruck in Bezug auf genetisch eigene, gesunde Kinder. Nicht zuletzt werden auch die Fragen der Regulation hinsichtlich einer möglichen Zulassung einer Keimbahntherapie unter den gesellschaftspolitischen Aspekten behandelt. Dies auch deshalb, weil insbesondere die in diesem Kontext vorgebrachten Begründungen, wie die der slippery slope-Argumentation, in einem engen Zusammenhang mit Regulationsfragen stehen. Nicht wenige der angestellten Überlegungen innerhalb des Themenkomplexes der gesellschaftspolitischen Argumente sind spekulativer Natur, doch ist es wichtig und notwendig insbesondere für die kritische Prüfung der dritten Nebenhypothese (H3) – dass die sozialen Implikationen darauf hinweisen, dass selbst ein therapeutischer Eingriff unerwünschte negative Folgen für das Individuum und die Gesellschaft hätte – verschiedene Blickwinkel einzunehmen.
Die Methode dieser Technikfolgenabschätzung bestand zunächst in der intensiven Auseinandersetzung mit der geführten Debatte um den Eingriff in die Keimbahn. Für alle weiteren Schritte waren jeweils gründliche systematische Literaturrecherchen, zum einen bezüglich naturwissenschaftlicher Publikationen und Literatur, zum anderen für die sogfältige Darstellung und Analyse der rechtlichen, ethischen und sozialen Aspekte notwendig. Zudem wurden die öffentliche Diskussion sowie Stellungnahmen ausgewählter Institutionen aufmerksam und kritisch verfolgt und begleitet. Eine besondere Herausforderung bestand in der Herausarbeitung neuer Aspekte der nicht wenigen altbekannten Argumente. Worin der antizipierte Unterschied der Debatte um die Keimbahntherapie im Vergleich zu anderen bioethischen Diskussionen besteht, war eine komplexe und umfassende Aufgabe, die eine intensive und gründliche Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Aspekt und darüber hinaus die gewissenhafte Analyse und Prüfung jedes Arguments spezifisch im Kontext eines Eingriffs in die menschliche Keimbahn erforderte.
Dieses Buch beginnt mit einer Einführung in die biologischen Grundlagen und einer detaillierten Darstellung des naturwissenschaftlichen Sachstandes der vorliegenden Thematik und führt über die Konfrontation und Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen – etwa im Hinblick auf den moralischen Status des Embryos, in Bezug auf den Begriff der Menschenwürde oder hinsichtlich der Definition und des Wertes von Gesundheit und Krankheit – in ein facettenreiches und interdisziplinäres Feld von Begründungsmustern. Im Kontext der Intervention in die menschliche Keimbahn stellt sich diese Untersuchung altbekannten bioethischen Streitfragen, die unter anderem auch in Diskussionen um Maßnahmen der Reproduktionsmedizin wie in vitro-Fertilisation und Präimplantationsdiagnostik eine tragende Rolle spielen. Sie setzt sich ebenso intensiv mit der Prüfung der Überzeugungskraft kategorischer Argumente auseinander wie mit der sorgfältigen Untersuchung pragmatischer Aspekte, wie etwa der Reichweite des ärztlichen Auftrages. Insbesondere die Analyse und Einnahme verschiedener Blickwinkel und Perspektiven in der gesellschaftspolitischen Argumentation offenbart nach genauer Prüfung interessante neue Aspekte, vor allem in Bezug auf die in der Diskussion häufig nur randläufig bemerkte Tatsache, dass die Keimbahntherapie nicht die Heilung eines existenten genetisch bedingt kranken Menschen zum Ziel hat, sondern die Therapie eines zukünftigen Menschen. Hieraus ergeben sich spannende weiterführende Fragestellungen11 und das Ergebnis der Analyse, Abwägung und Bewertung aller vorgebrachten und neu entwickelten Aspekte der unterschiedlichen Argumente und Perspektiven lässt bedeutsame Einsichten hinsichtlich der Formulierung der eigentlichen Leitfrage zu.