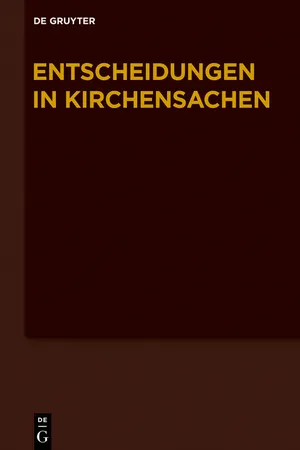
- 487 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
1.1.2015-30.6.2015
Über dieses Buch
Die Sammlung "Entscheidungen in Kirchensachen seit 1946" (KirchE) veröffentlicht Judikatur staatlicher Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland zum Verhältnis von Kirche und Staat und zu weiteren Problemkreisen, die durch die Relevanz religiöser Belange gekennzeichnet sind. Seit seiner Gründung (1963) erscheint das Werk in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kirchenrecht und Rheinische Kirchenrechtsgeschichte der Universität zu Köln.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
1
Der Begriff der Einrichtung in § 15 Abs. 1 AVR umfasst selbständig geführte Stellen, d.h. alle denkbaren Organisationseinheiten kirchlicher Träger. An den Grad der Selbständigkeit der Organisationsform sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Eine eigene Personalabteilung oder Personalhoheit ist nicht erforderlich. Ausreichend ist, dass die Einrichtung nach Zweck und fachlicher Organisation selbständig ist.
Art./§§ 12 Abs. 1 GG,1 Abs. 2 KSchG, 15 Abs. 1 AVR
LArbG Düsseldorf, Urteil vom 14. Januar 2015 -12 Sa 684/14-1
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer betriebsbedingten Kündigung
Die Klägerin war seit dem 1.10.1997 bei dem Beklagten, der 148 Arbeitnehmer beschäftigte, zunächst als Küchenhilfe und seit dem 1.3.2003 auf der Grundlage des Dienstvertrags vom 2.2.2003 als Küchenleiterin mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden beschäftigt.
Gemäß § 2 des Dienstvertrags galten für das Dienstverhältnis die „Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes“ (AVR). § 7 des Dienstvertrags regelte, dass für die Kündigungsfristen die §§ 14 bis 16 AT AVR galten. Die Arbeitszeit der Klägerin wurde durch einen Nachtrag zum Dienstvertrag befristet bis zum 30.6.2010 auf 38,5 Wochenstunden erhöht. Auch nach dem 30.6.2010 arbeitete die Klägerin weiter 38,5 Stunden. In einem sich anschließenden Rechtsstreit vor dem Arbeitsgericht Mönchengladbach einigten die Parteien sich auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden. Die Klägerin erzielte bei dieser Arbeitszeit zuletzt ein monatliches Gehalt von 2.978,05 € brutto. Sie war mit einem Grad der Behinderung von 40 vom Hundert einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt. Bei dem Beklagten waren eine Mitarbeitervertretung und eine Schwerbehindertenvertretung – letztere seit dem 14.10.2013 – gebildet. Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen war Frau T. Die Klägerin war stellvertretendes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung.
Bei dem Beklagten handelte es sich um einen gemeinnützigen Verein. Dessen Zweck war die Förderung und Begleitung von Mädchen, Frauen, Kindern, Jugendlichen und Familien in belasteten Situationen. Er betrieb zur Verfolgung dieses Zwecks als Betreuungsträger vier Kindertagesstätten und zwei offene Ganztagsschulen (OGS). Daneben betrieb er weitere soziale Eichrichtungen wie z.B. ein Frauenhaus. In den Kindestagesstätten und der OGS wurden die Kinder mit Essen versorgt. Für die Produktion der Essen betrieb der Beklagte im Familienzentrum X. in den dort vorhandenen eigenen Räumlichkeiten eine eigene Küche. Die Klägerin war dort als Küchenleitung eingesetzt. Neben der Klägerin waren in der Küche eine Köchin mit zuletzt bis zum 31.7.2014 befristetem Arbeitsvertrag und eine Küchenhilfe, O. E. mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt. Es wurden dort täglich jedenfalls ca. 260 Essen und monatlich 20 bis 30 Erwachsenenessen gekocht. Diese wurden im Wesentlichen an zwei Kindertagesstätten und eine OGS des Beklagten sowie teilweise an Dritte geliefert. Die anderen Kindertagesstätten und die andere OGS wurden von externen Caterern beliefert. Außerhalb der Küche im Familienzentrum X. beschäftigte der Beklagte in den sozialen Einrichtungen pädagogische Mitarbeiter sowie Ergänzungskräfte für die Essensausgabe.
Organisatorisch war die Küche dem Familienzentrum X. bis in das Jahr 2013 zugeordnet. Danach wurde sie unmittelbar der Verwaltung des Beklagten zugeordnet. Im Familienzentrum X. selbst wurden ca. 75 Vorschulkinder in drei bis vier Gruppen betreut und mit Mittagessen verpflegt. Tätig waren dort der Leiter des Familienzentrums, dessen Stellvertretung und jedenfalls 13 Erzieherinnen und Erzieher. Hinzu kamen die Klägerin als Küchenleitung sowie die Köchin und die Küchenhilfe, sowie ein Fahrdienst, der zum Teil für die Küche tätig war. Als Küchenleitung leitete die Klägerin die Küche fachlich. Sie erstellte die Essenspläne und kaufte selbständig ein. In letzter Zeit wurden die Essenspläne seitens des Beklagten kontrolliert, um bestimmte Standards einzuspielen. Die Personalhoheit lag allerdings bei der zentralen Personalabteilung des Beklagten. Die Klägerin stellte z.B. keine Mitarbeiter für die Küche ein. Anschaffungen für die Küche oder notwendige Reparaturen musste sie mit der Verwaltung des Beklagten absprechen.
Mit der Klägerin wurden von August 2013 bis November 2013 verschiedene Gespräche zur Änderung ihres Arbeitszeitumfangs geführt. Der Beklagte bot ihr an, die Tätigkeit mit 25 Wochenstunden Küchenleitung fortzusetzen. Alternativ sollten der Klägerin 25 Stunden Küchenleitung verbleiben und eine Küchenhilfe mit 7,5 Wochenstunden beschäftigt werden, was sodann für die Küchenhilfe auf 14 Wochenstunden aufgestockt wurde. Zuletzt wurden der Klägerin 30 Wochenstunden Küchenleitung angeboten. Die Klägerin teilte am 11.11.2013 mit, dass sie diese Angebote nicht annehme.
Mit Schreiben vom 14.11.2013 beantragte der Beklagte die Zustimmung zur ordentlichen Kündigung der Klägerin. Zu diesem Zeitpunkt war Frau T. seit Oktober 2013 arbeitsunfähig erkrankt. Die Klägerin als stellvertretendes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung informierte der Beklagte nicht von dem Zustimmungsantrag. Beantragt wurde eine ordentliche Kündigung gemäß § 15 Abs. 1 AVR. Diese wurde damit begründet, dass die Küche in X. geschlossen werden sollte, weil diese defizitär arbeite und die Klägerin die verschiedenen Angebote zur einvernehmlichen Regelung abgelehnt habe. Die Arbeitsunfähigkeit von Frau T. endete am 17.11.2013. Ab dem 18.11.2013 war sie wieder, zunächst im Rahmen einer Wiedereingliederung, tätig. Als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gab sie im Verfahren vor dem Integrationsamt mit Schriftsatz vom 30.11.2013 eine Stellungnahme ab. Am 17.12.2013 fand vor dem Integrationsamt eine Kündigungsverhandlung statt, an welchem die Parteien nebst den Prozessvertretern im vorliegenden Verfahren, die Vertrauensperson T. der schwerbehinderten Menschen, für die Mitarbeitervertretung deren Vorsitzende Frau O. und für die Fürsorgestelle O. Herr K. teilnahmen. In der Verhandlung wurde erneut über eine Verringerung der Arbeitszeit der Klägerin gesprochen. Der Beklagte konnte sich eine Verringerung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden Küchenleitung vorstellen. Damit war die Klägerin nur unter der Bedingung, dass zum Ausgleich eine Einmalzahlung der Beklagten gezahlt wurde, einverstanden. Eine Einigung wurde nicht erzielt. Es existierte ein von der Vorstandsvorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied des Beklagten unterzeichnetes Protokoll über eine Vorstandssitzung vom 17.12.2013. In diesem hieß es:
„Beschluss vom 11.07.2013
Der Vorstand des SkF O. e.V. hat am 11.07.2013 in seiner Sitzung beschlossen, die Küche im Familienzentrum X. zum 31.07.2014 zu schließen, wenn die Wirtschaftlichkeit bis zum 31.12.2013 nicht gegeben ist.
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 festgestellt, dass die Wirtschaftlichkeit der Küche im Familienzentrum X. nicht erreicht wurde.
Der Wirtschaftsrat stellt ebenfalls fest, dass die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist und stimmt dem Schließungsbeschluss zu.“
Mit Bescheid vom 17.1.2014 stimmte das Integrationsamt der ordentlichen Kündigung der Klägerin zu. Mit Schreiben vom 23.1.2014 kündigte der Beklagte das Arbeitsverhältnis zum 30.9.2014. Im Januar 2014 war Frau T. ebenfalls gesund. Auch nach dem 31.7.2014 waren die Räumlichkeiten der Küche ebenso wie die darin befindlichen Maschinen und Gerätschaften im Familienzentrum X. nach wie vor vorhanden.
Die Klägerin hat behauptet, eine abschließende Entscheidung zur Schließung der Küche habe der Beklagte noch nicht getroffen. Einen Beschluss des Vorstandes vom 11.7.2013 gebe es nicht. Es fehle auch nach dem 17.12.2013 an einer ernsthaften und endgültigen unternehmerischen Entscheidung des Beklagten, für welche greifbare Anhaltspunkte vorliegen. Die Küche könne mit dem vorhandenen Personal wirtschaftlich betrieben werden. Es habe bis zum Jahr 2013 keine eigene Kostenstelle der Küche gegeben. Belastbare Daten zur Wirtschaftlichkeit der Küche lägen nicht vor. Es könne auch nicht sein, dass der wirtschaftliche Betrieb davon abhänge, dass sie ihre Arbeitszeit von 35 auf 25 Wochenstunden reduziere. Die dadurch zu erzielende Einsparung würde nicht ausreichen, um nach den von dem Beklagten behaupteten Zahlen einen wirtschaftlichen Betrieb zu erreichen. Die Begründung zur angeblichen Unternehmerentscheidung des Beklagten sei damit unzutreffend und deshalb unwirksam. Sie hat gemeint, der Beklagte müsse seine Beschäftigungspflicht aus dem Vergleich erfüllen. Der Beklagte sei zudem verpflichtet gewesen, vorrangig eine Änderungskündigung auszusprechen. Es sei unstreitig möglich gewesen, sie als Küchenleitung mit 25 Wochenstunden weiter zu beschäftigen.
Die Klägerin hat die ordnungsgemäße Beteiligung des Integrationsamtes gerügt. Dieses Verfahren sei zu früh eingeleitet worden, weil die Schließung der Küche zu diesem Zeitpunkt noch nicht ernsthaft und endgültig beschlossen gewesen sei. Ihr stehe außerdem der Kündigungsschutz aus § 96 Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 15 KSchG zu. Wegen der Erkrankung von Frau T. hätte sie als stellvertretendes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung bei der Einleitung des Verfahrens vor dem Integrationsamt beteiligt werden müssen.
Im Gütetermin am 7.3.2014 hat der Beklagte ausweislich des Sitzungsprotokolls erklärt: „Wir könnten der Klägerin anbieten, auf Basis einer Stundenzahl von 25 Stunden wöchentlich ihre Tätigkeit weiter auszuüben zur gütlichen Beilegung des Rechtsstreits.“ Anschließend heißt es im Sitzungsprotokoll: „Dies entspricht nicht den Vorstellungen der Klägerin, sie stellt sich vor, dass gegebenenfalls eine Beschäftigung auf Basis von 30 Wochenstunden als Köchin und von 5 Wochenstunden mit Leitungsfunktion erfolgt“.
Eine gütliche Einigung ist nicht zustande gekommen. Die Klägerin hat zuletzt mit der Klage beantragt, 1. festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die schriftliche Kündigung der Beklagten vom 23.1.2014 nicht aufgelöst wird; 2. die Beklagte zu verurteilen, sie als Küchenleitung weiter zu beschäftigen.
Der Beklagte hat behauptet, die Küche sei organisatorisch und buchhalterisch eine eigenständige Einrichtung gewesen. Diese habe seit Beginn ihrer Einrichtung defizitär gearbeitet. Die Küche habe bereits seit dem Jahre 2007 eine eigene Kostenstelle, auf deren Basis eine Wirtschaftlichkeitsanalyse der Hochschule O. erstellt worden sei. Der Vorstand habe auf dieser Basis am 11.7.2013 beschlossen, die Küche zum 31.7.2014 zu schließen, wenn die Wirtschaftlichkeit bis zum 31.12.2013 nicht gegeben sei. Nachfolgend seien mehrere Maßnahmen zur Kostenoptimierung umgesetzt worden, wie z.B. die Reduzierung des Fahrdienstes oder Erhebung einer Nutzungspauschale. Die Reduzierung des Gehalts der Klägerin sei nur ein Baustein der Wirtschaftlichkeitserwägungen gewesen. Die Durchführung der Optimierung der Wirtschaftlichkeit sei aber letztlich an der Weigerung der Klägerin gescheitert, der Reduzierung ihres Gehalts zuzustimmen. Bereits am 11.7.2013 sei die Schließung final beschlossen worden. Man habe nachfolgend lediglich alles versucht, um die Küche und damit die Arbeitsplätze aufrecht zu erhalten. In der Sitzung am 17.12.2013 habe er festgestellt, dass die Wirtschaftlichkeit der Küche nicht erreicht wurde, so dass die Bedingung aus dem Beschluss vom 11.7.2013 eingetreten sei mit der Folge, dass die Schließung der Küche zum 31.7.2014 zu erfolgen habe. Der Arbeitsplatz der Klägerin sei dadurch weggefallen. Ab dem 1.8.2014 bereite ein externer Caterer die Essen für die Kindertagesstätten und die OGS zu und liefere sie an. Es gebe dann nur noch sog. Ausgabeküchen, d.h. das gelieferte Essen werde dort an die Kinder verteilt. Dies erfolge durch ehrenamtliche und Ergänzungskräfte des pädagogischen Personals. Soweit in den Ausgabeküchen Küchenhilfen beschäftigt würden, arbeiteten diese zwischen 11 und 18 Wochenstunden und erledigten ausschließlich die Essensausgabe sowie Reinigungsarbeiten in der Küche. Gekocht werde in den Ausgebeküchen nicht. Es gebe im Kündigungszeitpunkt die erforderlichen greifbaren Anhaltspunkte für die Umsetzung der Schließung. Der befristete Vertrag der Köchin werde nicht über den 31.7.2014 verlängert. Der Küchenhilfe werde gekündigt. Die Verträge mit den belieferten Kindergärten, Kindertagestätten und Schulen würden nicht über den 31.7.2014 verlängert.
Das ArbG Mönchengladbach (Urteil vom 21.5.2014 -7 Ca 417/14- n.v.) hat die Klage abgewiesen und hierzu im Wesentlichen ausgeführt, der Beklagte habe die nicht zu beanstandende unternehmerische Entscheidung getroffen habe, die Küche zu schließen. Weder § 15 KSchG i.V.m. § 96 Abs. 3 SGB IX, noch § 14 Abs. 5 AVR stünden der Kündigung entgegen. Die Mitarbeitervertretung sei ordnungsgemäß angehört. Die entsprechende Rüge habe die Klägerin nicht aufrechterhalten.
Die Klägerin macht mit der Berufung u.a. geltend, die Kündigung sei wegen Verstoßes gegen § 15 KSchG i.V.m. § 96 Abs. 3 Satz 2 SGB IX unwirksam. Der Beklagte hätte sie am 14.11.2013 bzw. 15.11.2013 wegen der Erkrankung von Frau T. als stellvertretendes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung bei der Einleitung des Zustimmungsverfahrens gegenüber dem Integrationsamt beteiligen müssen. Da der Beklagte dies vereitelt habe, müsse sie so behandelt werden, als sei sie als stellvertretendes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung tätig geworden. Das Verfahren vor dem Integrationsamt sei zudem zu früh eingeleitet worden.
Es liege auch keine Auflösung einer Einrichtung oder deren wesentliche Einschränkung i.S.v. § 15 Abs. 1 AVR vor. Eine Auflösung einer Einrichtung liege nicht vor, weil das Familienzentrum selbst die Einrichtung sei. Dieses werde durch die Auflösung der Küche nicht wesentlich eingeschränkt.
Es fehle an einer rechtzeitig getroffenen und nachgewiesenen Unternehmerentscheidung. So sei der Beschluss vom 11.7.2013 bislang nicht selbst in den Prozess eingebracht worden. Aus dem Beschluss vom 17.12.2013 könne nicht auf ihn geschlossen werden. Und selbst zum Zeitpunkt der Kündigung habe die Schließung der Küche nicht hinreichend sicher festgestanden. Die Klägerin behauptet, die angeblich gekündigte Küchenhilfe werde weiterhin bei dem Beklagten in der Küche in X. eingesetzt. Es würden dort außerdem Spenden der „O. Tafeln“ angeliefert, die entgegengenommen, gelagert und verarbeitet werden müssten. Außerdem gebe es dort eine Spülhilfe. Zwar sei die Umstellung auf die Anlieferung des Essens durch einen Caterer erfolgt. Es gebe aber bereits konkrete Pläne, dass in der Kindertagestätte Regenbogen künftig wieder selbst gekocht werde, weil die Umstellung bei den Betroffenen auf Widerstand stoße. Insgesamt sei davon auszugehen, dass der Betrieb der Küche fortgeführt werde.
Ihr sei zu keinem Zeitpunkt ein adäquates Angebot zur Fortführung der Küche gemacht worden. Eine Änderungskündigung sei deshalb nicht entbehrlich gewesen.
Der Beklagte trägt u.a. vor, er habe in der Vorstandssitzung am 11.7.2013 beschlossen, die Küche zu schließen, sofern bis zum 31.12.2013 keine Wirtschaftlichkeit hergestellt werden kann. Bei der weiteren Vorstandssitzung am 17.12.2013 sei zusammen mit dem Wirtschaftsrat festgestellt worden, dass die Wirtschaftlichkeit nicht erreicht werden konnte, mit der Folge, dass die Bedingungen aus dem Beschluss vom 11.7.2013 eingetreten waren und feststand, die Küche zum 31.7.2014 zu schließen. Abgesehen von der Frage der Wirtschaftlichkeit habe der Entschluss schon am 11.7.2013 festgestanden. Die Angebote im Gütetermin seien nur im Hinblick auf die Erwägung gemacht worden, das Arbeitsverhältnis ggfs. doch noch aufrecht zu erhalten. Wäre die Klägerin auf das Angebot eingegangen, wäre er nochmals in die Überprüfung der Weiterführung der Küche eingetreten. Die Voraussetzungen von § 15 Abs. 1 AVR seien gegeben. Die Küche in X. sei eine eigenständige Einrichtung, welche aufgelöst worden sei. Die Küche habe einen eigenen Sach- und Kostenplan gehabt. Jedenfalls sei die Einrichtung, in welcher die Küche untergebracht war, nämlich das Familienzentrum X., wesentlich eingeschränkt worden. Das Leistungsangebot des Familienzentrums habe sich geändert, weil keine Speisen mehr hergestellt wurden. Auch die Belieferung Dritter sei nicht mehr möglich. Es liege auch qualitativ eine wesentliche Einschränkung einer Einrichtung vor. Hierzu behauptet der Beklagte, es seien neben dem Fahrdienst 19 Mitarbeiter im Familienzentrum X. beschäftigt. Durch die Schließung der Küche sei eine wesentliche Anzahl von Mitarbeitern betroffen gewesen. Die Küche werde nicht weiter betrieben. Die Küchenhilfe E. werde bei der Ausgabe des von Drittunternehmen gelieferten Essens tätig. Eine Änderungskündigung mit einer Stundenreduzierung sei mit dem Beschluss der Schließung der Küche nicht vereinbar.
Nach Beweisaufnahme blieb die Berufung ohne Erfolg.
Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Klägerin ist unbegründet.
[40] A. Die Berufung der Klägerin ist unbegründet, weil der mit der Berufung noch verfolgte, rechtzeitig erhobene Feststellungsantrag unbegründet ist. Die Kündigung des Beklagten vom 23.1.2014 hat das Arbeitsverhältnis der Parteien fristgemäß zum 30.9.2014 aufgelöst, weil die Kündigung wirksam ist. Die im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes erklärte Kündigung ist als ordentliche betriebsbedingte Kündigung sozial gerechtfertigt. Die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 AVR sind gegeben und eine ordentliche Kündigung ist nicht gemäß § 52 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. § 19 Abs. 1 der Mitarbeitervertretungsordnung für den Bereich der Erzdiözese Köln (MAVO Köln) ggfs. i.V.m. § 52 Abs. 5 Satz 2 MAVO Köln i.V.m. § 96 Abs. 3 Satz 2 SGB IX ausgeschlossen. Die Mitarbeitervertretung ist ordnungsgemäß beteiligt worden. Die erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes liegt vor.
[41] I. Streitgegenstand des Verfahrens ist die von dem Beklagten ausgesprochene ordentliche betriebsbedingte Kündigung vom 23.1.2014. Eine außerordentliche Kündigung mit sozialer Auslauffrist liegt nicht vor. Anhaltspunkte für eine außerordentliche Kündigung ergeben sich bereits aus dem Kündigungsschreiben vom 23.1.2014 nicht. Vielmehr wird dort eine betriebsbedingte Kündigung fristgerecht ausgesprochen. Es bestehen auch im übrigen Sachverhalt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin die erklärte Kündigung als außerordentliche Kündigung verstehen durfte. Bereits der Antrag des Beklagten an das Integrationsamt, auf dessen Basis die Kündigungsverhandlung auch mit der Klägerin stattfand, bezieht sich auf eine ordentliche Kündigung. Darauf, dass der Beklagte eine außerordentliche betriebsbedingte Beendigungskündigung und keine außerordentliche betriebsbedingte Kündigung mit sozialer Auslauffrist ausgesprochen hat, sind die Parteien mit Beschluss des Gerichts vom 23.9.2014 hingewiesen worden. Einwände zu diesem Verständnis sind nicht vorgebracht worden. Ohnehin liegt nur eine Zustimmung des Integrationsa...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort und Benutzungshinweise
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Betriebsbedingte Kündigung. LArbG Düsseldorf, Urteil vom 14.1.2015 (12 Sa 684/14)
- 2 Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes im Kirchengemeindeverband. LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.1.2015 (1 Sa 554/14)
- 3 Befreiung von der Schulbesuchspflicht. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 19.1.2015 (19 A 2031/13)
- 4 Kopftuchverbot für Lehrkräfte in öffentlichen Schulen. BVerfG, Beschluss vom 27.1.2015 (1 BvR 471/10, 1181/10)
- 5 Religionsfreiheit einer juristischen Person. VG Würzburg, Urteil vom 29.1.2015 (W 5 K 14.505)
- 6 Anpassung gemeindlicher Kirchenbaulasten. Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg, Urteil vom 2.2.2015 (1 VB 48/14)
- 7 Schutzbereich der Religionsausübungsfreiheit (Art 4 GG) und Anordnung einer Pflichtversicherung in § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI. BayLSG, Urteil vom 11.2.2015 (L 19 R 453/11)
- 8 Löschung eines Taufbucheintrags. BayVGH, Beschluss vom 16.2.2015 (7 ZB 14.357)
- 9 Recht auf ungestörte Religionsausübung. Sächsisches OVG, Beschluss vom 20.2.2015 (3 B 115/15)
- 10 Zusammentreffen von Freiheitsrechten. EGMR, Urteil vom 24.2.2015 -No. 30587/13- (Karaahmed ./. Bulgarien)
- 11 Glaubens- und Gewissensfreiheit als Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund. OLG Hamm, Beschluss vom 26.2.2015 (III-5 RVs 7/15)
- 12 Salafismus und freiheitlich-demokratische Grundordnung. VG Aachen, Urteil vom 26.2.2015 (1 K 1395/14)
- 13 Anspruch auf Kindergeld während einer Tätigkeit in einem von einer Religionsgemeinschaft getragenen Freiwilligendienst (§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 d EStG). FG München, Urteil vom 26.2.2015 (10 K 1463/14)
- 14 Schenkungssteuerrechtliche Unerheblichkeit eines religiös begründeten Zinsverbots. BFH, Urteil vom 4.3.2015 (II R 19/13)
- 15 Äußerungsbefugnis eines kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 10.3.2015 (1 S 2444/14)
- 16 Versorgung für religiös Verfolgte aus der DDR. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 13.3.2015 (OVG 11 M 2.15)
- 17 Verkaufsoffene Sonntage aus besonderem Anlass. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 26.3.2015 (1 S 19.15)
- 18 Werbungskostenabzug für Arbeitszimmer. FG Thüringen, Urteil vom 26.3.2015 (1 K 371/14)
- 19 Begleitende Hilfe nach Schwerbehindertenrecht für Geistliche. VG Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 14.4.2015 (13 K 6000/14)
- 20 Weltlicher oder kirchlicher Status einer Stiftung. VG Karlsruhe, Urteil vom 16.4.2015 (3 K 2544/13)
- 21 Baugenehmigung für russisch-orthodoxe Kirche mit Gemeindezentrum und Kindertagesstätte. VG München, Beschluss vom 20.4.2015 (M 8 SN 15.181)
- 22 Loyalitätsverstoß im kirchl. Arbeitsverhältnis LAG München, Urteil vom 21.4.2015 (6 Sa 944/14)
- 23 Asylbegehren wegen Konversion vom Islam zum Christentum. VG Würzburg, Urteil vom 22.4.2015 (W 6 K 15.30041)
- 24 Außerordentliche Kündigung eines Dombaumeisters. ArbG Köln, Urteil vom 23.4.2105 (8 Ca 4701/14)
- 25 Ruhegehaltfähigkeit einer „persönlichen Zulage“ im kirchl. Lehrerdienstrecht. VG Augsburg, Urteil vom 30.4.2015 (Au 2 K 14.1778)
- 26 Zuschuss zu den Personalkosten einer Kindertagesstätte. VG Mainz, Urteil vom 7.5.2015 (1 K 979/14.MZ)
- 27 Befreiung vom schulischen Sexualkundeunterricht. VG Münster, Urteil vom 8.5.2015 (1 K 1752/13)
- 28 Tarifgerechte Eingruppierung einer Mesnerin. LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 18.5.2015 (1 Sa 3/15)
- 29 Windkraftanlage in der Nähe einer denkmalgeschützten Kirche. BayVGH, Beschluss vom 20.5.2015 (22 ZB 14.2827)
- 30 Rundfunkgebühren und Schutzbereich der Religionsfreiheit. VG Augsburg, Urteil vom 1.6.2015 (Au 7 K 14.363)
- 31 Störung der Religionsausübung (§ 167 Abs. 1 Nr. 1 StGB). LG Köln, Urteil vom 2.6.2015 (156 Ns 23/15)
- 32 Wohngeld- u. einkommensteuerrechtliche Lage eines privaten Arbeitsverhältnisses im kirchl. Bereich. VG München, Urteil vom 10.6.2015 (M 22 K 13.45)
- 33 Entzug des elterlichen Sorgerechts bei religiös beeinflusster Kindeswohlgefährdung. OLG Nürnberg, Beschluss vom 11.6.2015 (9 UF 1430/14)
- 34 Totenfürsorgerecht. AG München, Urteil vom 11.6.2015 (171 C 12772/15)
- 35 Ordensoberer als Betreuer. AG Altötting, Beschluss vom 16.6.2015 (XVII 59/15)
- 36 Nachweis des Kirchenaustritts im Ausland. Sächsisches Finanzgericht, Urteil vom 17.6.2015 (6 K 605/13)
- 37 Förderung von kirchl. Schwangerschaftskonfliktberatung. BVerwG, Urteil vom 25.6.2015 (3 C 2.14)
- 38 Versicherungsschutz bei Tätigkeit im kirchl. Bereich. SG Hamburg, Urteil vom 26.6.2015 (S 6 U 188/10)
- 39 Verleihung des Körperschaftsstatus an Religionsgemeinschaft. BVerfG, Beschluss vom 30.6.2015 (2 BvR 1282/11)
- Index
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu 1.1.2015-30.6.2015 von Manfred Baldus, Stefan Muckel, Manfred Baldus,Stefan Muckel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Jura & Öffentliches Recht. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.