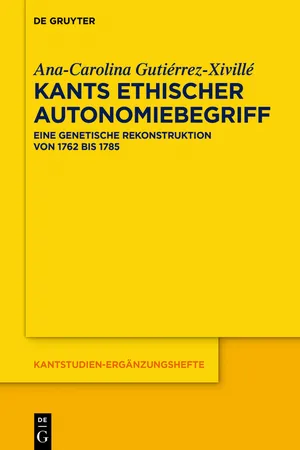
Kants ethischer Autonomiebegriff
Eine genetische Rekonstruktion von 1762 bis 1785
- 488 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Kants ethischer Autonomiebegriff
Eine genetische Rekonstruktion von 1762 bis 1785
Über dieses Buch
Ana?Carolina Gutiérrez?Xivillé präsentiert eine neue Lesart zu Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Während ältere Studien die kantische Ethik als bloße Ausarbeitung von bereits in den 1760er Jahren vorliegenden Begriffen lesen, zeigt diese Studie eine Neubestimmung des Freiheitsbegriffs und bietet eine gewandelte Sicht auf das Verhältnis zwischen "Moralvermögen", "moralischem Gefühl" und "Moralprinzip".
Gutiérrez?Xivillé betrachtet die Texte weder isoliert noch monolithisch. Ihre aus einem analytischen und einem exegetischen Moment bestehende Methode erfasst Kants bekannte Schriften ebenso wie in jüngerer Zeit neu edierte, wenig erforschte Materialien. Dabei offenbaren sich strukturelle Brüche, die wegweisend von einer frühen Moralkonzeption in eine spätere überleiten. Die Ethik Kants erweist sich als Ergebnis eines allmählichen Heranreifens über mehrere Stationen hinweg.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Exzerpt
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelsite
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- Einleitung
- I Das Rezeptionsstadium: Der Standpunkt der Moralkonzeption Kants in der ersten Hälfte der 1760er Jahre
- II Das kritisch-reflexive Stadium: Kants Bruch mit dem moralischen Gefühl und die Suche nach einem reinen moralphilosophischen Fundament
- III Das Stadium der Methode: Kants Propädeutik von 1781
- IV Das Stadium der Metaphysik: Die Genese des ethischen Autonomiebegriffs
- Anhänge zu verschiedenen Zwecken
- Literaturverzeichnis
- Sachregister
- Namensregister
- Exzerpt