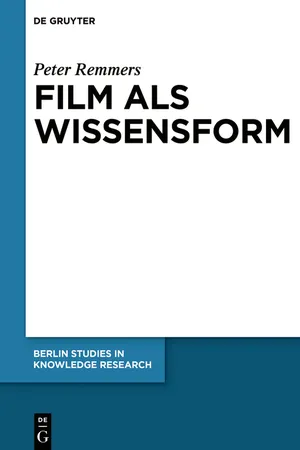1 Einleitung
Erkenntnisprozesse spielen in der Filmerfahrung eine zentrale Rolle – auch wenn Filme typischerweise zum Zweck der Unterhaltung oder mit ästhetischen Ansprüchen angeschaut werden. So werden manche Filme beispielsweise als ‚interessant‘, ‚tiefgründig‘, ‚aufschlussreich‘ oder ‚lehrreich‘ beurteilt. Diese Charakterisierungen weisen darauf hin, dass mit Filmen nicht nur Entdeckungen gemacht werden können, sondern dass Filme auch Einblicke ermöglichen, die zu Einsichten oder sogar zu regelrechten Erkenntnissen beitragen. Abgesehen davon, dass bestimmte Filme über Sachverhalte informieren können, geht der Anspruch in der Zuschauererfahrung häufig tiefer: Man hat den Eindruck, dass das Anschauen eines Films den Zuschauern etwas vermittelt, was sich von bloßem Tatsachenwissen abhebt. Mit der Filmerfahrung werden also spezifische epistemische Leistungen verbunden.1
Für eine erste Annäherung können die Begriffe der Entdeckung, des Einblicks und der Einsicht als Leitfaden dienen. Die Rede davon, dass man in einem Film etwas entdeckt, also etwas erstmals wahrnimmt und kennenlernt, ist in einer bestimmten Hinsicht trivial. Denn man kann in Filmen – und allgemein in Bildern – Dinge wahrnehmen, die man sonst nie gesehen hat und unabhängig von der bildlichen Darstellung wohl auch nie sehen würde oder könnte, seien es historische Aufnahmen, einmalige Ereignisse, Bilder aus fremden und unzugänglichen Gegenden oder auch aus einer Nähe, die kaum ein Betrachter tatsächlich einnehmen könnte. Doch über die Entdeckung von Neuem und dem Zuschauer bisher Unbekanntem hinaus gibt es auch gewissermaßen ‚tiefere‘ Erkenntnisse, die Filmen ähnlich wie der Literatur oder dem Theater zugeschrieben werden: Von Darstellungen und Reflexionen schwieriger Probleme bis hin zur Vermittlung ‚neuer Perspektiven‘ findet man in Filmen eine große Vielfalt an Auseinandersetzungen, die Ansprüche auf eine besondere Erkenntnisweise erheben. Damit ist sicherlich nicht (oder zumindest nicht nur) die Vermittlung von Informationen gemeint, sondern vielmehr eine umfassendere Erfahrung, die durch eine ‚Vertiefung‘ in bestimmte Darstellungen die Zuschauer sinnlich affiziert. Was Filme hier versprechen sind Einblicke, Einsichten oder auch eine Art ‚Enthüllung der Wirklichkeit‘ – Vorgänge, die im Rahmen einer Konzeption filmischen Zeigens erfasst werden können.
Dabei geht es nicht in erster Linie um Filme, die ganz offensichtlich und ausdrücklich mit dem Ziel der Kommunikation von Wissensbeständen produziert und gezeigt werden, etwa indem eine Dozentin bei ihrer Vorlesung gefilmt wird, sondern vielmehr um ein weites Spektrum filmischer Darstellungen, von Fiktionen über Dokumentarfilme bis hin zum Kunstfilm. In diesen Darstellungen ist die Filmerfahrung nicht nur als Informationsübermittlung, als Unterhaltung, als Meinungsäußerung, als politischer oder sozialer Appell zu betrachten. Mit der Filmwahrnehmung werden offenbar epistemische Qualitäten verbunden, die allerdings nicht unmittelbar als solche deutlich hervortreten. Während der konkreten Wahrnehmung von Filmen, also in der vertrauten Zuschauersituation im Kino, vor dem Fernseher oder dem Computerbildschirm, werden die epistemischen Qualitäten wohl nur selten als solche erfasst und reflektiert. Epistemische Aspekte verbleiben insofern im Impliziten, sie sind (noch) unverstanden, wenn sie nicht sogar angesichts der vorherrschenden Zwecke der Unterhaltung oder des künstlerischen Ausdrucks geleugnet werden. Denn die umfassenden Charakterisierungen von Filmen als Kunstwerke, Kommunikationsmedien oder Lehrmittel verdecken häufig die Frage nach Art und Status einer allgemeinen Wissensform der Filmerfahrung. Explizit beschrieben finden sich filmische ‚Erkenntnisse‘ dagegen häufig in der anspruchsvollen Filmkritik, besonders deutlich aber in philosophischen Interpretationen von Filmen, mit denen sich inzwischen ein selbständiger und vielfältiger Zweig der philosophischen Literatur herausgebildet hat. In einigen dieser Beiträge zur anspruchsvollen Filminterpretation und -reflexion zeigt sich übrigens, dass prinzipiell auch Filme, die auf den ersten Blick nur ‚unterhalten wollen‘, in philosophisch-epistemischer Hinsicht interessant und wertvoll sein können.2
Auch in der Theorie finden sich kaum Antworten auf die Frage, von welcher Art die epistemischen Leistungen des Films sind. Insbesondere der epistemologische Status der Wahrnehmung von Filmen ist bisher weitgehend ungeklärt. Es gibt noch keine systematisch orientierte Beschreibung und Begründung der Wissensform der Filmerfahrung. Zwar wird Filmen (als Bildern) durchaus gelegentlich die Möglichkeit von Evidenzerfahrungen und entsprechenden Wahrheitsansprüchen eingeräumt;3 es gibt aber noch keine umfangreiche epistemologische Untersuchung, die diese Möglichkeit begründet und erklärt. In der vorliegenden Arbeit soll ein erster Schritt in diese Richtung unternommen werden, indem nach spezifischen Eigenschaften der Filmwahrnehmung gefragt und ihr epistemologischer Status untersucht wird.
Ausgangspunkt der epistemologischen Untersuchung ist die Wissensform der Bekanntschaft. Sie steht in einem engen Zusammenhang zur Wahrnehmung, denn Wahrnehmung stiftet Bekanntschaft. Zugleich ist Bekanntschaft immer Bekanntschaft mit etwas, sie ist also immer auf Objekte bezogen. Dagegen wird Bekanntschaft nicht von der Übereinstimmung einer Darstellung mit den bestehenden Sachverhalten her gedacht: Denn ob das, womit man durch die Wahrnehmung bekannt wird, in einer Repräsentations- oder Abbildungsbeziehung zu etwas anderem steht, ist zunächst nicht entscheidend. Das gilt insbesondere für die Filmerfahrung, in der die Beziehung des Wahrgenommenen zu etwas Anderem (wie einer ‚außerfilmischen Realität‘) entweder nachgeordnet oder vorausgesetzt ist – ersteres ist charakteristisch für fiktionale Filme, letzteres für nicht-fiktionale Filme. Ich vertrete in dieser Hinsicht die These, dass das epistemische Interesse an der Filmerfahrung nicht unmittelbar auf das Verhältnis zwischen dem Film und etwas von ihm Abgebildeten gerichtet ist, sondern zuerst darauf, was in einem Film gegenwärtig ist. Bei der Untersuchung der Bekanntschaft mit Filmen kommt es daher in erster Linie auf die Objekte der Wahrnehmung selbst an, und erst daran anschließend auf die Handlungen, Verhaltensweisen und Aussagen, die an die Bekanntschaft mit diesen Objekten anknüpfen. Diese Zusammenhänge und das Verständnis der damit verbundenen epistemologischen Phänomene sind leitend für die vorliegende Untersuchung.
Mit der Konzentration auf den Film wird der Gegenstandsbereich der Untersuchung auf eine spezifische Art der Bilder eingeschränkt, womit an eine breite theoretische Debatte angeknüpft werden kann: Denn Filme sind Bilder, und die Bekanntschaft mit Bildern erklärt sich daraus, was Bilder sind, welche Art der Wahrnehmung mit ihnen verbunden ist und wie sie schließlich in Beziehung zu etwas Anderem gesetzt werden. Diese Fragen verdienen daher besondere Aufmerksamkeit. Es zeigt sich allerdings, dass der bildliche Status des Films in verschiedenen Hinsichten theoretisch noch ungeklärt ist, was sich nicht zuletzt an einigen Paradoxien zeigt, die geradezu hypnotisierend auf Filmtheorie und Filmphilosophie gewirkt haben. Insbesondere Fragen nach dem Illusionscharakter, nach der Rolle des Filmtons und nach dem Status der Fotografie müssen daher geklärt und eindeutig beantwortet werden.
Getragen wird die Untersuchung filmischen Wissens also von einer übergeordneten Konzeption bildlichen Wissens, die sich auf Beiträge zur Bildtheorie sowie zur Epistemologie ästhetischer und künstlerischer Darstellungen beruft.4 Nelson Goodman beispielsweise betont nicht nur einen kreativen „Verstehensfortschritt“ in der Kunst,5 sondern sieht im Wissen sogar den höchsten Zweck aller Kunst: „Der primäre Zweck“ liegt in der „Erkenntnis an und für sich“ („cognition in and for itself“) (Goodman 1976, S. 258). Im Anschluss an diese Position Goodmans und unter Einbezug von Günter Abels Philosophie der Wissensformen6 möchte ich für die weiterführende These argumentieren, dass mit filmischen Bewegungsbildern bestimmte epistemische Praktiken verbunden sind. Diese Praktiken sind uns vertraut und erscheinen uns ganz selbstverständlich, aber ihre Strukturen und Wechselspiele sind noch nicht explizit beschrieben und begründet. Ich werde in diesem Sinne dafür argumentieren, dass sich die spezifisch filmische Bekanntschaft in bestimmten Arten des Zeigens manifestiert.
In den folgenden Kapiteln der Einleitung möchte ich zunächst den Gegenstandsbereich bestimmen, der im weiteren Verlauf der Untersuchung unter dem Begriff des Films gefasst wird (Kapitel 1.1), insbesondere im Hinblick auf dessen Bildcharakter (Kapitel 1.2). In Kapitel 1.3 grenze ich die Idee einer ‚Epistemologie des filmischen Bewegungsbildes‘ von verwandten Ansätzen ab und erläutere die Fragestellung genauer. In diesen Zusammenhang gehören auch einige Bemerkungen zum Verhältnis zwischen der Epistemologe und den Zielen einer philosophischen (Film‐)Ästhetik (Kapitel 1.4). Schließlich wird die in der klassischen Filmtheorie entwickelte Idee einer filmischen Enthüllung diskutiert (Kapitel 1.5). Dies geschieht vor dem Hintergrund einer filmphilosophischen Untersuchung von Malcolm Turvey, der die klassisch-filmtheoretische Idee der Enthüllung klar identifiziert und – mit Argumenten, die sich an Wittgensteins Ausführungen zum Skeptizismus anlehnen – kritisiert hat.
1.1 Was ist Film?
Was meinen wir, wenn wir im Folgenden von ‚Filmen‘ sprechen? Eine Untersuchung mit epistemologischer Ausrichtung könnte sich zunächst an formalen Eigenschaften des Films bzw. des Filmmediums orientieren. Was ist damit gemeint? Man könnte beispielsweise auf die Idee kommen, filmische Phänomene im Sinne der klassischen analytischen Philosophie auf den Begriff des Films zurückführen. Eine derartige Analyse liefe auf die formale Bestimmung von notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das Vorliegen eines Filmphänomens hinaus. Noël Carroll hat den Versuch unternommen, den Film als Medium in diesem Sinne zu definieren, erreicht aber lediglich einige sehr abstrakte Bestimmungen, die für eine epistemologische Untersuchung zu allgemein und nicht weiterführend sind.7 Denn wenn wir danach fragen, was uns als Zuschauern bei der Wahrnehmung von Filmen konkret gegeben ist, dann helfen uns Überlegungen zur begrifflichen Kategorisierung des Films im Vergleich zu anderen Dingen nicht weiter. Eine Alternative zu einer Orientierung an abstrakten Merkmalen des Filmbegriffs bestünde dagegen in einer materialen Kategorisierung, die sich auf konkrete Filmgenres, historische Filminhalte oder einzelne Filmwerke bezieht. Dafür gibt es gerade auch in der philosophisch-filmtheoretischen Literatur einige Beispiele. Doch die theoretischen Ansprüche der Epistemologie können auch in diesem Rahmen nicht erfüllt werden, denn hier fehlt es wiederum an Allgemeinheit. Wir werden von der Betrachtung bestimmter Filmphänomene wohl kaum zu den epistemologischen Merkmalen filmischer Phänomene überhaupt gelangen. Es stellt sich also die Frage: Wie ist die Grenze zwischen Form und Inhalt filmischer Phänomene zu ziehen, um die epistemologischen Aspekte in den Blick zu bekommen?
Im Überblick über den Gegenstandsbereich der Philosophie des Films eröffnen sich grundsätzlich verschiedene Wege für eine Unterscheidung zwischen filmischer Form und filmischem Inhalt. Häufig orientiert sich die Thematisierung des Films am ‚Primat‘ der Narration. Mit dieser Ausrichtung ist zugleich eine implizite Festlegung auf bestimmte vorherrschende Filmtraditionen verbunden. Film wird „als ein narratives Medium verstanden und nicht etwa als Medium der reinen Sichtbarkeit (wie in der Avantgarde), als Medium der piktorialen Darstellung oder als Medium der Bewegung und Zeit auf einer immanenten Ebene.“ (Elsaesser/Hagener 2013, S. 113 f.). Doch man kann sich schnell davon überzeugen, dass eine ausschließliche Orientierung an der Narration viele Filmphänomene ausblendet – nicht nur nicht-narrative Filme, sondern auch diejenigen Momente und Szenen in narrativen Filmen, die nicht unmittelbar im Dienste der Erzählung stehen.8 Das Primat der Narration erweist sich somit als Engführung. Die anderen beiden im obigen Zitat genannten Auffassungen – von Film als Medium der piktorialen Darstellung oder als Medium der Bewegung und Zeit – sind beispielsweise in den Ansätzen von Gregory Currie9 und Gilles Deleuze10 zu finden. Sie beanspruchen, die Phänomene des Films auf einer allgemeineren und weniger selektiven Ebene zu fassen. Die narrativen Ausgestaltungen von Filmen können dann als Spezialfälle bestimmt werden, genauer als bildliche Narrationen (Currie) oder als Realisierungen von (metaphysischen) Bewegungs- und Zeitformen (Deleuze). Die Möglichkeit und Ausgestaltung filmischer Narrationen wird in diesen Ansätzen also aus den allgemeineren Eigenschaften der Bildlichkeit und der zeitlichen Form des Films abgeleitet. An eine gleichartige Ordnung möchte ich auch im Folgenden anknüpfen, ohne allerdings die spezifische Bestimmung filmischer Narration eigens zu thematisieren.11 Es wird sich schließlich zeigen, dass die Orientierung an Merkmalen wie dem Bildcharakter, der Konzeption einer zeitlichen Form und bestimmten filmisch-epistemischen Praktiken einen zwar zunächst sehr allgemein gehaltenen, aber zugleich inhaltlich reichhaltigen Untersuchungsansatz ermöglicht.
Im Folgenden wird daher unter dem Begriff des Films eine bestimmte Bildart verstanden, die eine zeitliche Form aufweist und kraft dieser Form einen Wahrnehmungsprozess mit bestimmten Eigenschaften veranlasst. Unter dem Begriff der zeitlichen Form können Eigenschaften wie Bewegung und Dauer gefasst werden – offenbar wesentliche Merkmale des Films. Es gibt zwar auch seltene Beispiele für Filme, in denen sich nichts bewegt (etwa Filme, die nur aus einem oder mehreren Standbildern bestehen), wodurch Bewegung als notwendige Bedingung für Film ausgeschlossen ist; dennoch haben auch diese Filme eine Dauer, und Bewegung spielt zumindest noch als erwartete eine Rolle.12 Doch auch vor dem Hintergrund dieser näheren Bestimmungen findet sich heute eine nahezu unüberschaubare Vielfalt an Filmphänomenen, die in ihren epistemologischen Funktionen stark variieren können. Ein zu abstrakter Filmbegriff, wie er sich aus einer begrifflichen Analyse ergibt, kann hier (wie gesagt) keine Orientierung schaffen; Bestimmungen der bildlichen und zeitlichen Form des Films können dagegen als erste Ausgangspunkte dienen. Weitere Hinweise ergeben sich aus der folgenden Ordnung geläufiger Filmphänomene. Die Einteilung folgt Kriterien, die zumindest auf den ersten Blick epistemologisch relevant erscheinen. Selbstverständlich erlaubt die kaum zu überblickende Mannigfaltigkeit der Filmphänomene keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber eine klare Einteilung erlaubt trotz aller Vorläufigkeit einen ersten systematischen Zugriff.
- ‒ Gegenständliche und nichtgegenständliche Filme Filme sind überwiegend gegenständliche Bilder, d. h. sie präsentieren hinreichend deutlich erkennbare Objekte. Ausnahmen finden sich in einigen Experimentalfilmen sowie im Kontext einzelner Szenen in ansonsten gegenständlich abbildenden Filmen, in denen zeitweise unklar oder unbestimmt sein mag, ob etwas und was genau zu sehen ist.
- ‒ Fotografische und nichtfotografische Filme Für viele Filme ist es charakteristisch, dass sie fotografisch erzeugt sind. Ihnen kommen daher all diejenigen besonderen Eigenschaften zu, die die Fotografie als spezifische Abbildungstechnik auszeichnen. Dokumentarische Filme sind notwendig fotografisch. Mit der Fotografie sind in der Film- und Bildtheorie seit ihrer Entstehung starke epistemologische Ansprüche verbunden worden, auf die ich auch im Verlauf der vorliegenden Arbeit näher eingehen werde (vgl. Kapitel 5.2 und 5.3).
- ‒ Zeitlich lineare und zeitlich nicht-lineare Bewegungsbilder (z. B. interaktive Filme) Normalerweise besteht die Einheit eines Films in einer fest umgrenzten Dauer mit Anfang und Ende. Daneben besteht aber auch die technische Möglichkeit, den Film zu unterbrechen, beliebig zu wiederholen oder gezielt an andere Stellen zu springen. Insbesondere interaktive Szenarien sind als zeitlich nicht-lineare Bewegungsbilder anzusprechen. Größere filmische Einheiten sind also nicht notwendig auf eine sukzessive Struktu...