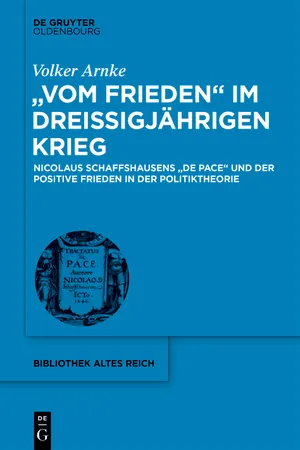
eBook - ePub
"Vom Frieden" im Dreißigjährigen Krieg
Nicolaus Schaffshausens "De Pace" und der positive Frieden in der Politiktheorie
- 307 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
"Vom Frieden" im Dreißigjährigen Krieg
Nicolaus Schaffshausens "De Pace" und der positive Frieden in der Politiktheorie
Über dieses Buch
In der Politiktheorie zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges dominierte ein negatives Friedensverständnis. Krieg prägte die prominenten Werke wie etwa Hugo Grotius' De iure belli ac pacis. Dass es aber auch Schriften gab, die den Frieden aktiv fokussierten, wie z.B. Nicolaus Schaffshausens De pace, ist der Forschung bislang entgangen. Hier setzt die Studie an und fragt danach, welche positiven Friedensvorstellungen und -konzepte damals existierten.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu "Vom Frieden" im Dreißigjährigen Krieg von Volker Arnke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Deutsche Geschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
1.1 Gegenstand und Fragestellung
Der Edler Fried ist außgejagt
Daß höchste Guht auff Erden /
Wie greülich wirst du nun geplagt
O Sichers Teütschland werden!
Ja Friede / du recht güldner Schatz /
Daß man Dir günnet keinen platz /
Daß wird nach weing Tagen
Selbst Teütschland sehr beklagen.1
Daß höchste Guht auff Erden /
Wie greülich wirst du nun geplagt
O Sichers Teütschland werden!
Ja Friede / du recht güldner Schatz /
Daß man Dir günnet keinen platz /
Daß wird nach weing Tagen
Selbst Teütschland sehr beklagen.1
Der Dichter Johann Rist (1607 – 1667) drückte in diesen Versen des erstmals 1647 veröffentlichten Schauspiels Das friedewünschende Teütschland jene Friedenssehnsucht aus, die damals weite Teile des Heiligen Römischen Reiches ergriffen hatte. Der Grund für diesen ausgeprägten Friedenswunsch war der Dreißigjährige Krieg (1618 – 1648)2, der mit seiner hohen Intensität und langen Dauer Europa und vor allem „Teütschland“ belastete. Rist, ein Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft, räumte dem Frieden als „höchste[s] Guht auff Erden“ in seiner künstlerischen Arbeit einen wichtigen Platz ein. Darin wurde die Friedenssehnsucht nicht nur literarisch ausgedrückt, sondern wirkte durch mehrere Angehörige dieser Sprachgesellschaft auch in die politische Praxis hinein.3
Tatsächlich sind nicht nur die zeitgenössische Literatur, sondern auch die zahlreichen politischen und diplomatischen Bemühungen während des Dreißigjährigen Krieges Ausdruck einer raumgreifenden Friedenssehnsucht.4 In der damaligen Politiktheorie, die die Themen Krieg und Frieden behandelte, konnte die Forschung bislang allerdings keine solche Friedenssehnsucht ausmachen.5 Dieser Befund folgt der Tatsache, dass in den seit etwa 1600 aufkommenden akademischen Disziplinen des ius publicum6 (Öffentliches Recht) und der politica7 (Politikwissenschaft), die beide gleichermaßen die respublica (Gemeinwesen8) behandelten und bei Zeitgenossen als „praktisch identisch galten“9, eindeutig der Krieg dominierte. So führt zwar beispielsweise eine Zentralschrift des Völkerrechts, Hugo Grotius‘ (1583 – 1645) De iure belli ac pacis10, den Frieden im Titel, doch lag der Schwerpunkt der Ausführungen zweifellos auf dem Krieg. Auch der Reichspublizist Christoph Besold (1577 – 1638) behandelte in zwei verschiedenen Ausgaben desselben Werkes das ius belli ac pacis (Recht des Krieges und des Friedens) zunächst unter der Kapitelüberschrift „de bello et pace“11 und später inhaltlich treffender unter „de bello“.12 Lediglich in der letzten von 40 Thesen widmete er sich dem Frieden.13 Damit blieb dieser trotz der zweifellos bestehenden Friedenssehnsucht auch in einem von Besolds Hauptwerken eine Marginalie14, wie in den meisten anderen Schriften des ius publicum.15 Dieser Kriegsausrichtung des überwiegenden Teils der Politiktheorie folgend, hat auch die Forschung Frieden bis dato vornehmlich als Antagonismus des Krieges und damit ex negativo wahrgenommen.
Umso bemerkenswerter ist es, dass der Rechtsgelehrte Nicolaus Schaffshausen (1599 – 1657) ein zeitgenössisches politiktheoretisches Werk schuf, das dezidiert den Frieden ins Zentrum rückte. Wie in keiner anderen Schrift der Reichspublizistik beziehungsweise des ius publicum imperii16 der damaligen Zeit wurden in seinem Werk, De pace, Frieden und Krieg vom Frieden ausgehend in den Blick genommen und ein aktives Friedenskonzept entwickelt. Die Schrift17, die zwischen 1629 und 1640 in drei Ausgaben erschien, blieb in der Forschung allerdings bislang nahezu unbeachtet.18
Angesichts dessen stellen sich die Fragen, warum Nicolaus Schaffshausen entgegen dem dominierenden Trend der politica den Frieden in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte, wie er ihn ausdeutete und welche Rolle er ihm beimaß. Damit ist es ein wesentliches Ziel dieser Studie, die Forschung zum ius publicum um die Perspektive des Friedens zu erweitern, die bislang vernachlässigt worden ist. Weiterhin soll unter Rückgriff auf die Untersuchungskategorien des negativen und des positiven Friedens in Verbindung mit dem Ansatz der politischen Kommunikation gezeigt werden, dass nicht nur der Krieg die Politiktheorie prägte, sondern auch positive Friedensvorstellungen eine Rolle spielten.
1.2 Forschungsstand: Frieden in der Frühen Neuzeit
Die Forschung zum frühneuzeitlichen Frieden ist, abgesehen von einigen Lexikonartikeln und themenübergreifend angelegten Sammelbänden, die einen allgemeinen Überblick vermitteln19, im Wesentlichen von zwei Feldern geprägt:
- ‒ Frieden als ethischer Grundwert und als Utopie
- ‒ Frieden in Politik und Recht
Der erste Bereich, Frieden im Sinne eines ethischen Grundwerts und einer Utopie, ist breit aufgestellt und umfasst verschiedene Metiers, in denen Frieden als ein Leitmotiv menschlichen Denkens fungiert und unter spezifischen Blickwinkeln beleuchtet wird. Dabei wird Frieden oft als Sehnsuchtsort und irreales Wunschbild verstanden. Dennoch wird er nicht nur in den eng mit dem Feld der Ethik verbundenen Fächern Theologie und Philosophie thematisiert, sondern auch in Studien, die rechts- und politikwissenschaftliche Friedenslesarten untersuchen.20 In diesem Segment häufig auftauchende Schlagworte sind Humanismus, Irenik und konfessionelle Toleranz, politische Ethik sowie Utopie.
Arbeiten wie die Sammelbände Norbert Brieskorns und Markus Riedenauers21 demonstrieren die breite Fächerung der Erforschung des Friedens als Grundwert beziehungsweise als Zielvorstellung menschlichen Zusammenlebens, indem sie Gelehrte unterschiedlicher Professionen in den Blick nehmen und ihre Schriften analysieren.22 Hier werden nicht nur eindeutige Friedensschriften wie zum Beispiel solche der Humanisten Erasmus von Rotterdam23 (um 1467 – 1536) und Juan Luis Vives24 (1493 – 1540), von Geistlichen wie dem Abbé de Saint-Pierre25 (1658 – 1743) oder von Philosophen wie Immanuel Kant26 (1724 – 1804), sondern auch Werke von Politiktheoretikern in Aussage und Wirkung untersucht, die Frieden nicht explizit ins Zentrum ihres Oeuvres stellten. Zu Letzteren zählen etwa Jean Bodin (1529/1530 – 1596) und Thomas Hobbes (1588 – 1679), aber auch Völkerrechtler wie Hugo Grotius.27
Auch die Erforschung der Repräsentation und Gestalt des Friedens in der bildenden Kunst, in der Literatur und in der Musik fällt in das erste Forschungsfeld. Hier stehen Fragen nach den Wurzeln der künstlerischen Friedensästhetik sowie nach deren Wirkungen im Vordergrund. In diesem Bereich hat es ebenfalls einige themenübergreifende Publikationen gegeben.28 Besonders umfassend ist der zweite Textband zur Europaratsausstellung von 1998 zum Westfälischen Frieden, der dieses klassische Feld der Kulturgeschichte des Friedens raumgreifend wiedergibt.29
Einzelaspekte betreffen die Analyse von frühneuzeitlichen Friedensallegorien, die stark von der Antike beeinflusst waren30, und Bildkompositionen samt ihren politischen und theologischen Essenzen.31 Die Schnittstelle von künstlerischer Ästhetik und praktischer Politik untersuchen ebenfalls Studien zu Sprachgesellschaften der Frühen Neuzeit, insbesondere zur Fruchtbringenden Gesellschaft, die während des Dreißigjährigen Krieges gegründet wurde und zu dieser Zeit auch eine erste Blüte erfuhr. Hier liegt der Fokus auf der literarisch formulierten Friedenssehnsucht sowie auf der konkreten Friedensarbeit der Gesellschafter.32 Dieser Ansatz lässt sich auch in anderen Studien zur Literatur der damaligen Zeit verfolgen.33
Musikgeschichtliche Beiträge zum frühneuzeitlichen Frieden fragen nach Gattungsspezifika und Anlässen von Friedenskompositionen, die oftmals Auftragswerke waren. Sie erörtern dabei ebenfalls die politischen Dimensionen von Friedensmusiken34 und stehen damit in enger Verbindung zu Forschungen über Friedensfeste und Jubiläen, die wiederum Aspekte der Memorialkultur in den Vordergrund stellen.35
Das zweite Forschungsfeld nähert sich Frieden in der Frühen Neuzeit aus politik- und rechtsgeschichtlicher Perspektive. Obwohl das heute als selbstverständlich erscheinende zweidimensionale Politik- und Rechtssystem, das eine Unterscheidung von zwischenstaatlichem und innergesellschaftlichem Frieden kennt, für weite Teile der Frühen Neuzeit nicht oder nur bedingt anwendbar ist36, teilt sich die Frühneuzeitforschung bei einer gewissen Themenschnittmenge in einen diplomatie- und völkerrechtsgeschichtlichen sowie in einen innergesellschaftlichen, verfassungsgeschichtlichen Zweig.
Es lassen sich allerdings auch solche Themenfelder finden, in denen beide Forschungssegmente zugleich berücksichtigt werden. Bei einem gewissen Übergewicht auf der Untersuchung von Außenbeziehungen zählt hierzu klassischerweise der Westfälische Friedenskongress, der für die Beziehungen und Strukturen sowohl außerhalb als auch innerhalb des Heiligen Römischen Reiches von Belang war.37 Auch der aktuelle Trend, die Themen Sicherheit und Friedenssicherung zu erforschen, wird mitunter übergreifend verfolgt.38
Im ersten Teilbereich, der Diplomatie- und Völkerrechtsgeschichte, der die politischen Beziehungen zwischen den europäischen Gemeinwesen und das Völkerrecht in den Blick nimmt, wird Frieden vor allem als Zielpunkt einer sich im Lauf der Frühen Neuzeit professionalisierenden Kongresspraxis untersucht.39 Aktuelle Trends der Diplomatiegeschichte sind die Erforschung der Kongressorte, der Verhandlungstechniken, des Medieneinsatzes und der Kommunikation.40 Dabei wird die Perspektive insgesamt zunehmend auf die Akteure gelenkt. Zu diesem Komplex zählen auch die spezifische diplomatische Sprache und damit verbundene Probleme wie Missverständnisse und Übersetzungsfehler, die unlängst untersucht worden sind.41
Auch werden Friedensprozesse vermehrt über längere Zeiträume hinweg untersucht und damit diplomatische Bemühungen einbezogen, die nicht unmittelbar zu einem Kriegsende führten.42 Daneben fällt in diesen wohl traditionsreichsten Bereich der Friedensgeschichtsschreibung die Geschichte des Völkerrechts43, das zum Beispiel im Kontext der Analyse ausgewählter Friedenskongresse und ‐verträge untersucht wird.44 Hierbei ist die normierende Wirkung des Völkerrechts sowohl hinsichtlich des Ablaufs von Friedensverhandlungen als auch bezüglich der Geltung und Dauerhaftigkeit von Friedensschlüssen ein stetes Forschungsthema.
Ist also in der Geschichtsschreibung zum Völkerrecht das Thema Frieden dauerhaft präsent, erscheint demgegenüber bei einem Blick auf Konzepte und Vorstellungen von Frieden in der Reichspublizistik und damit auf die ...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort
- Inhalt
- 1 Einleitung
- 2 Kontexte von De pace
- 3 De pace
- 4 Abgleich: Christoph Besold, De pace pacisque iure (1624) und Franz David Bonbra, Ars belli et pacis (1643)
- 5 Zusammenfassung und Ergebnisse
- 6 Anhang
- Namensregister
- Ortsregister