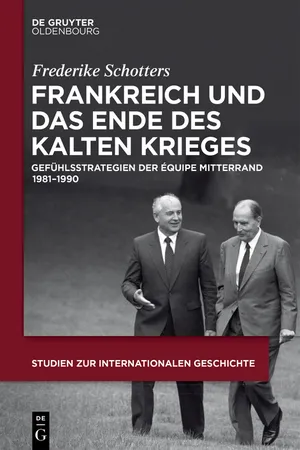1.1 Vorüberlegungen
Vor einer Analyse der politischen Impulse von François Mitterrand und seiner équipe gilt es, einige Vorbedingungen dieser Politik zu erklären. Möchte man sie verstehen, kommt man nicht umhin, nach den Wahrnehmungen und Deutungsmustern der handelnden Personen zu fragen, deren Ursprung und Genese ihrerseits selbst einer Erklärung bedürfen. Die Regierungsübernahme der Sozialisten markierte keineswegs den Ausgangspunkt ihrer außenpolitischen Konzeptionen. Diese hatten sich vielmehr in langwierigen Prozessen herausgebildet und wurden von verschiedenen Seiten beeinflusst. Daher müssen ihre Vorstellungen, Ideen und Handlungsimpulse in den Kontext verschiedener Bedingungsfaktoren von Politik eingebettet werden. Das erste Kapitel steht damit unter der leitenden Fragestellung, ob François Mitterrand das Amt des Präsidenten 1981 mit einer klaren politischen Konzeption antrat und welche Zukunftserwartungen, Überzeugungen und Kompetenzen aus vergangenen Erfahrungen abgeleitet wurden. Wie Georges Saunier herausgearbeitet hat, präsentierte sich François Mitterrand bei öffentlichen Auftritten ebenso wie bei Gesprächen mit politischen Verhandlungspartnern gerne als ein Europäer der ersten Stunde, indem er seine Teilnahme am Europäischen Kongress in Den Haag im Jahr 1948 hervorhob.181 Die Selbstinszenierung als überzeugter Europäer soll in diesem Kapitel kritisch hinterfragt werden. In einem ersten Schritt werden dafür Mitterrands Vorstellungen von Europa und die aus seiner Sicht notwendigen Bedingungen für eine stabile Friedensordnung analysiert und auf seine Wahrnehmungen der internationalen Situation im Jahr 1981 bezogen. Diese Vorstellungen und Wahrnehmungen müssen dabei in ein Netz aus verschiedenen Faktoren eingebettet werden, die Einfluss auf die Erkenntnisgewinnung bei François Mitterrand nahmen. Dafür wird in einem zweiten Schritt nach konzeptionellen Ursprüngen und Einflüssen auf seine politischen Vorstellungen gefragt. Hierbei spielen erstens Kontinuitäten und Brüche zu politischen Konzeptionen der Vergangenheit eine Rolle. Maßgeblich für Mitterrands Realitätsperzeptionen sind zweitens seine persönliche und politische Sozialisation. Wurden beispielsweise in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit Unsicherheit gemacht und welche Handlungskompetenzen wurden dadurch erworben? Drittens hatte sein personelles Umfeld Einfluss auf die Definition und Umsetzung seiner Politik. Es gilt also zu klären welche Akteure zur équipe Mitterrand zählten und welche Sozialisationsprozesse diese ihrerseits durchliefen. Aufgrund der Kombination von Persönlichkeiten, die durch spezifische Arbeitspraktiken und soziale Ressourcen verbunden waren, wird dieses Akteursgeflecht im weiteren Verlauf auch als équipe Mitterrand bezeichnet. Neben diesen drei Grundbedingungen für die Ausbildung von Vorstellungen und konzeptionellen Überlegungen kamen noch äußere Einflussfaktoren für die Führung von Außenpolitik hinzu. Dafür müssen vorab sowohl die Spezifika des französischen politischen Systems erklärt werden als auch die Rahmenbedingungen für Außenpolitik um 1981. Die Globalisierung und Multilateralisierung von Außenpolitik stellen beispielsweise ebensolche Rahmenbedingungen von Politik am Ausgang des 20. Jahrhunderts dar. Zugleich wurde die Souveränität der Exekutiven von verschiedenen Seiten wie einer kritischen Öffentlichkeit, Nichtregierungsorganisationen oder politischen Verhandlungspartnern anderer Staaten eingeschränkt. In diesem Netz aus unterschiedlichen Interessenvertretern galt es, den politischen Kurs auszuhandeln.
Zwei theoretische Konzepte bieten sich als Grundlage der Analyse an: Zum einen helfen zwei analytische Kategorien weiter, die Reinhart Koselleck als „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ bezeichnet hat.182 Vor allem für den Abschnitt, der sich mit der sozialisatorischen Prägung von Mitterrand und seinen Weggefährten auseinandersetzt, erweisen sich Kosellecks Überlegungen zu Erfahrungsraum und Erwartungshorizont als weiterführend. Diese vermitteln für sich keine historische Wirklichkeit, sondern sind vielmehr als „Bedingungen möglicher Geschichte“ und „Erkenntniskategorien“ zu verstehen, „die die Möglichkeit einer Geschichte begründen helfen.“183 Unter „Erfahrung“ versteht Koselleck gegenwärtige Vergangenheit, „deren Ereignisse einverleibt worden sind und erinnert werden können.“184 Erwartung dagegen sei ihm zufolge vergegenwärtigte Zukunft und ziele auf das noch nicht Erfahrene und „nur Erschließbare“185. Diese beiden Begriffe sind insofern aufeinander bezogen, als sie nicht ohne einander existieren können: „Keine Erwartung ohne Erfahrung, keine Erfahrung ohne Erwartung.“186 Geschichte werde durch die Erfahrungen und Erwartungen der handelnden Personen konstruiert, indem sie in einer Gegenwart den Zusammenhang von Vergangenheit und Zukunft herstellen. Da sie Zeitebenen gewissermaßen ineinander verschränken, seien diese beiden Begriffe also geeignet, historische Zeit zu thematisieren. Sie bieten sich gerade deswegen für die empirische Forschung an, weil sie „inhaltlich angereichert, die konkreten Handlungseinheiten im Vollzug sozialer oder politischer Bewegungen leiten.“187 Bezogen auf das vorliegende Forschungsprojekt lässt sich also festhalten, dass Erfahrungen von Akteuren – sowohl kollektive als auch individuelle – entscheidend zur Konstruktion ihrer Zukunftserwartungen beitrugen. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten für Akteure, sich in ein Verhältnis zum Ungewissen des Zukünftigen zu setzten: Wie im methodischen Teil der Einleitung bereits angedeutet wurde, handeln Akteure nicht rein rational. Emotionen gehen in die Erwartungen der Zukunft und damit auch in das Handeln der politischen Akteure in der Gegenwart ein. Allerdings irrt, wer davon ausgeht, dass es sich bei Erfahrungen oder Erwartungen um statische Entitäten handelt. Obwohl freilich die Ereignisse der Vergangenheit nicht veränderbar sind, so unterliegt doch die Erfahrung, die davon abgeleitet wird, einem Wandel und kann sich durch neu gemachte Erfahrungen verändern. Überraschungen, bei denen das Erwartete nicht beziehungsweise anders eintritt, durchbrechen laut Koselleck den Erwartungshorizont und „stifte[n] also neue Erfahrung“188. Die Begriffe Erfahrung(‐sraum) und Erwartung(‐shorizont) sind insofern geeignete Instrumentarien, um historischen Wandel zu erklären und die Faktoren von individuellem Handeln und strukturellen Prozessen in der Analyse zu verknüpfen. Diese theoretischen Grundlagen eignen sich als Instrumente, um politisches Handeln beziehungsweise den Umgang von Akteuren mit spezifischen Herausforderungen zu untersuchen und die Entstehung neuer Handlungsstrategien und Verhaltensmuster zu erklären. Bezogen auf François Mitterrand und seine équipe ist davon auszugehen, dass sowohl kollektive Erinnerungsbestände als auch individuelle Erfahrungen der Vergangenheit – verstanden als Sozialisation – Einfluss sowohl auf die Wahrnehmung gegenwärtiger Realität als auch die Erwartungen an die Zukunft hatten.
Zum anderen lassen sich Mitterrands Vorstellungen von Europa, die einen elementaren Bestandteil seiner Zukunftserwartungen darstellten, besser verstehen, wenn man sich an dem Theoriemodell der vier Antriebskräfte europäischer Integration von Wilfried Loth orientiert. Die europäischen Bewegungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zielten darauf, die Funktionsdefizite der Nationalstaaten zu überwinden. Das Scheitern der Versailler Ordnung, die Erfolge der Revisionspolitik und schnellen Siege der Nationalsozialisten steigerten als schmerzhafte Erfahrungen der Unsicherheit das Verlangen nach kollektiver Sicherheit. Die Defizite des nationalen Ordnungssystems in Europa wiederum schlüsselt Loth in vier unterschiedliche Kategorien auf: Erstens galt es, das Problem zwischenstaatlicher Anarchie einzuhegen, die in den beiden Weltkriegen zu verheerender Gewaltentfesselung geführt hatte. Damit verbunden war zweitens die Friedenssicherung in Europa durch die Einbettung der deutschen Frage, die als potentielles Risiko für den Frieden gesehen wurde. Drittens zielte eine wirtschaftliche Integration der europäischen Staaten auf die Entwicklung von Produktivkräften im industriellen Zeitalter, da eine wechselseitige Abschottung langfristig zu einem Verlust an Produktivität führte. Viertens motivierte das Aufstreben neuer Supermächte die Europäer dazu, durch gemeinsames Auftreten nach Selbstbehauptung zu streben. Im Verlauf der Geschichte europäischer Integration waren diese Antriebskräfte nicht immer gleich stark, standen aber in Interaktion zueinander und sind daher als Erklärung geeignet, warum zu bestimmten Zeitpunkten Fortschritte in der Integration bestimmter Bereiche erzielt wurden. Dieses Modell ist insofern auch geeignet, die Motive von François Mitterrand und seiner Mannschaft zu untersuchen und thematisch zu systematisieren. Gleichzeitig vermag es Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen europäischen Interessenvertretern zu erklären, wenn diese im gleichen Moment durch unterschiedliche Antriebskräfte motiviert wurden, europäische Integration in verschiedenen Bereichen voranzutreiben.189
Europäische Bewegungen waren während des Zweiten Weltkrieges und unmittelbar danach keineswegs nur ein westeuropäisches Phänomen; allerdings unterdrückte Stalin im Osten Europas jedwede Pläne für zwischenstaatliche Zusammenschlüsse. Die Einigung Westeuropas drohte im aufziehenden Kalten Krieg die Spaltung Europas zu vertiefen. Insofern war die Idee für einen europäischen Zusammenschluss unter Ausschluss Osteuropas im Winter 1946/1947 noch wenig populär. Insbesondere die französischen Europaanhänger schreckten davor zurück, die Blockbildung zu fördern. Populärer hingegen war die Konzeption eines Europas der Dritten Kraft, das vermittelnd auf die beiden neuen Weltmächte hätte einwirken können. Diese Konzeption wird im Folgenden noch näher erläutert, wenn strukturelle Einflüsse auf Mitterrands Vorstellungen untersucht werden. Sie zielte auf ein unabhängiges Europa, in dem weder Osteuropa zum sowjetischen Einflussbereich noch Westeuropa zum westlichen Block unter amerikanischer Führung zählen sollten. Letztlich führte aber die sowjetische Ablehnung des Marshall-Plans weitestgehend zu der Überzeugung, dass die europäische Einigung realpolitisch im Westen beginnen musste.190 Die Ursprünge des europäischen Integrationsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg beruhten zu Beginn also durchaus auf paneuropäischen Perspektiven, die durch die sich vertiefende Teilung in Ost und West blockiert beziehungsweise nicht weiterverfolgt wurden. Von Bedeutung sind diese Ursprünge des europäischen Integrationsprozesses insofern, als François Mitterrand als französischer Abgeordneter und Minister in der unmittelbaren Nachkriegszeit und Delegierter beim Kongress von Den Haag 1948 nicht nur Zeitgenosse, sondern bereits politischer Akteur im Ringen um den Aufbau paneuropäischer Solidarität war. Wie in den folgenden Unterkapiteln noch gezeigt wird, spielten diese frühen Perspektiven paneuropäischer Einigung gewissermaßen verdichtet als Erfahrungsraum für seine Europavorstellungen eine wichtige Rolle.
Mitterrands europäisches Engagement wurde in der Forschung bisher keiner systematischen Untersuchung unterzogen. Gleichwohl gibt es einige kleinere Beiträge oder Teilkapitel, die sich seinen europäischen Vorstellungen und seiner Europapolitik zuwenden,191 die aber selten in den Zusammenhang mit anderen politischen Bereichen gestellt werden. Die Interaktion zwischen den Faktoren von transatlantischen Konflikten, europäischem Sicherheitsbedürfnis, europäischer Produktivität im Angesicht wirtschaftlicher Stagnation und Arbeitslosigkeit wurde in der Analyse von Mitterrands Europavorstellungen und -politik bislang kaum bedacht, an seine politische Konzeption rückgebunden oder auf die Überwindung des Ost-West-Konfliktes und die Suche nach einer alternativen Staatenordnung bezogen.