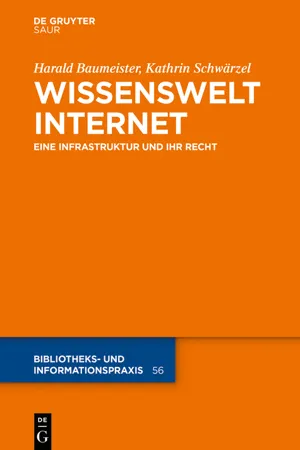Geschichte und Gegenwart: eine Bestandsaufnahme
Ein L und ein O sind die ersten Buchstaben, die über das Arpanet, den Vorläufer und „Urvater“ des Internets, in Kalifornien zwischen zwei mehr als 500 Kilometer voneinander entfernten Rechnern übertragen werden. Dann stürzt das System ab.
Von „Login“ kommt nur „Lo“ beim Empfänger an, aber rückblickend betrachtet ist das Experiment, das eine Stunde später doch noch gelingt, ein durchschlagender Erfolg. Der Versuch, zwei Computer miteinander zu vernetzen, erscheint den beteiligten Wissenschaftlern um Leonard Kleinrock in Los Angeles und Stanford jedoch so wenig herausragend, dass er nicht einmal auf einem Foto festgehalten wird. Nur eine handschriftliche Notiz im Logbuch, das an der University of California in Los Angeles geführt wurde, dokumentiert die erste Nachrichtenübertragung über den Vorläufer des Internets. Dennoch markiert diese geglückte Vernetzung zweier wissenschaftlicher Großrechner die Geburtsstunde der kulturell wohl bedeutsamsten Entwicklung seit der Erfindung des Buchdrucks: Wir schreiben den 29. Oktober 1969.
Die Vernetzung als ein gemeinschaftliches Projekt von Wissenschaft und Politik
Gut zwölf Jahre zuvor, am 4. Oktober 1957, hatte ein kugelförmiges Objekt mit einem Durchmesser von 58 cm zu einer wahrhaftigen Schockstarre in den USA geführt. Der Sowjetunion war es unerwartet früh gelungen, mit Sputnik 1 einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen.
Von nun an schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die USA mit Interkontinentalraketen bedroht würden. Als Reaktion auf den technologischen Vorsprung, wie ihn die Sowjetunion in diesem Herbst demonstrieren konnte, beschloss der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Dwight D. Eisenhower, eine Bildungs- und Forschungsoffensive, die das Land in die Lage versetzen sollte, alsbald wieder zur UdSSR aufzuschließen und über kurz oder lang die technologische Überlegenheit zurückzugewinnen.
Die Gründung der ARPA
Im Zuge dieser Bildungs- und Forschungsoffensive wurde zu Beginn des Jahres 1958 die Advanced Research Projects Agency, kurz ARPA, gegründet. Sie erhielt den Auftrag, Forschungsvorhaben an der Speerspitze der Wissenschaft voranzubringen. Zu den Koordinationsaufgaben der „Forschungsfabrik“ ARPA gehörten die Vergabe von Forschungsaufträgen und die Arbeit an Projekten in der Technologieentwicklung, denen ein hoher Nutzen zugeschrieben wurde, deren Realisierung aber unsicher erschien. Obwohl die ARPA zum US-Verteidigungsministerium gehörte und von dort ihre Gelder bezog, arbeiteten für sie damals auf ausdrücklichen Wunsch von Präsident Eisenhower zivile Wissenschaftler an vielfach nicht militärischen Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Grundlagenforschung.
Die Idee eines Computernetzwerkes
Eine Gruppe von Computerwissenschaftlern in den USA sah Computer nicht nur – wie in dieser Zeit allgemein üblich – als bloße Rechenmaschinen, sondern vielmehr als interaktive Helfer bei Entscheidungsprozessen und Instrumente zur Erweiterung menschlicher Fähigkeiten an. Von unschätzbarem Einfluss waren in diesem Forschungskontext das Interesse und die wissenschaftlichen Anstrengungen Joseph Lickliders, die der künstlichen Intelligenz galten:
The hope is that, in not too many years, human brains and computing machines will be coupled together very tightly, and that the resulting partnership will think as no human brain has ever thought and process data in a way not approached by the information-handling machines we know today. (Licklider 1960, S. 4)
Das 1962 neu gegründete und in der Entwicklung des Arpanets maßgebliche Information Processing Techniques Office (IPTO) innerhalb der ARPA verfolgte diesen Forschungsansatz weiter und führte in den 1960er Jahren verschiedene Angehörige der neuen Forschergeneration unter dem Dach der kurz zuvor gegründeten ARPA zusammen.
Um die Ressourcen der bereits vorhandenen Großrechner in den USA im Sinne eines „dynamic resource sharing“ (Kleinrock 2010, S. 26 f.) effizienter nutzen und die Zahl der zu betreibenden Computer aus Kostengründen so gering wie möglich halten zu können, entschieden sich die Computerforscher für ein Netzwerkexperiment, dessen Schlüsselszene vom 21. Oktober 1969 am Anfang dieses Buches steht.
Eine Anekdote veranschaulicht die damalige Aufgeschlossenheit der ARPA und mit ihr der staatlichen Forschungsfinanzierung in den Vereinigten Staaten für Experimente aus dem Bereich der Grundlagenforschung: Der Leiter des IPTO, Robert Taylor, brauchte nur rund 20 Minuten, um den Leiter der ARPA, Charlie Herzfeld, von der Idee eines kleinen experimentellen Computernetzwerks, eben dem Arpanet, in einem informellen Gespräch zu überzeugen und dafür ein zusätzliches Budget von nicht weniger als einer Million US-Dollar einzutreiben. Anders als der Privatsektor, der noch eingangs der 1960er Jahre sowohl von Leonard Kleinrock als auch dessen Forschungskollegen Paul Baran vergeblich um Unterstützung im Aufbau eines Rechnernetzwerkes und in der Weiterentwicklung der Paketvermittlung als Verfahren der Datenübertragung gebeten worden war, zeigte sich die öffentliche Hand überaus aufgeschlossen und förderwillig. Sie legte damit den Grundstein für eine offene, kooperationsorientierte Forschung unter dem Dach der ARPA.
Dennoch wurde von Beginn an die Beteiligung des amerikanischen Telekomanbieters American Telephone and Telegraph (AT&T) am Projekt verfolgt. Dessen Leitungen sollten auch wider die Vorbehalte im Unternehmen selbst gegen die Nachrichtenübermittlung im Netz genutzt werden. Anders als bei einer während des Telefonats stets aufrechterhaltenen Telefonverbindung wurde nach einem kostengünstigen Verfahren für die diskontinuierliche Datenübertragung zwischen den Computern gesucht, die die Leitungen und damit die Netzkapazität nur im Moment des tatsächlichen Datenflusses in Anspruch nehmen würde.
Die Paketvermittlungstechnik und das Maschennetz als zentrale Prinzipien des Arpanets
Zwei Wissenschaftler, Paul Baran in den USA und Donald Watt Davies in Großbritannien, entwarfen dazu unabhängig voneinander Lösungen, die die Aufspaltung von Dateien in kleine Dateneinheiten und deren separate Versendung über die Datenleitungen ermöglichten. Eine mathematische Grundlage dafür hatte Leonard Kleinrock in seiner Dissertation zu Computernetzwerken, die Anfang der 1960er Jahre am Massachusetts Institute of Technology entstanden war, geschaffen. Wie man sich diese Lösung vorstellt, hieß sie auch: die Paketvermittlungstechnik.
Während sich Baran, der zu dieser Zeit für die Research and Development (RAND) Corporation, eine Organisation zur Beratung der amerikanischen Streitkräfte, tätig war, jedoch die Ausarbeitung eines auch für den Fall eines nuklearen Angriffs ausfallsicheren Netzkonzepts für die Kommando- und Kommunikationsstrukturen des Militärs zum Ziel gesetzt hatte, suchte der Physiker Davies am britischen National Physical Laboratory nach einer hocheffizienten Infrastruktur, die über große Entfernungen eine interaktive Datenverarbeitung zulassen würde.
Zur Paketvermittlungstechnik trat ein zweites grundlegendes Prinzip des Netzbetriebs, das ursprünglich in der Sicherung von Nachrichtennetzen vor atomaren Angriffen Bewährung finden sollte: das Maschennetz. Es zeichnete sich durch seine dezentrale Organisation und Flexibilität aus. Anstelle von zentralen, aber verwundbaren Vermittlungs- und Verbindungsstellen, denen die Schaltung der Verbindungen oblegen und deren Läsion unausweichlich zu einem Verbindungsabbruch im Netz geführt hätte, sollte eine möglichst große Auswahl an alternativen, redundanten Verbindungswegen zu verschiedenen Punkten im Netz eröffnet werden, die je nach der konkreten Situation genutzt werden konnten. Drei bis vier redundante Verbindungen sollten nach Einschätzung der Wissenschaftler bereits die gewünschte Versorgungssicherheit herstellen können (siehe Braun 2010, S. 202).
Die Paketvermittlungstechnik und das Maschennetz waren die zentralen Prinzipien zum Aufbau des Rechnernetzes, des Arpanets.
Der Aufbau des Arpanets
Das Arpanet startete zunächst mit vier Teilnehmern von der amerikanischen Westküste bis Utah: dem Stanford Research Institute (SRI), der University of Utah (UTAH), der University of California, Los Angeles (UCLA) und der University of California, Santa Barbara (UCSB). Diese vier Einrichtungen waren zur Teilnahme ausgewählt worden, weil sie sich durch ihre Systemvoraussetzungen und ihr technisches Know-how in besonderer Weise als geeignet zeigten, den Aufbau und die Dienstleistungen des geplanten Computernetzwerkes zu unterstützen.
Im Juli 1969 veröffentlichte die University of California in Los Angeles eine Pressemitteilung, in der sie den Aufbau des Arpanets ankündigte und Leonard Kleinrock dessen Ausgestaltung sowie Anwendungsszenarien aufzeigte. Mit einer Vision, die Wirklichkeit werden sollte, schloss er:
As of now, computer networks are still in their infancy, but as they grow up and become more sophisticated, we will probably see the spread of ‘computer utilities’, which, like present electric and telephone utilities, will service individual homes and offices across the country. (Kleinrock, zitiert nach: Tugend 1969, S. 2)
Eine besondere Herausforderung dabei war, Computer verschiedener Hersteller trotz inkompatibler Hard- und Software miteinander kommunizieren zu lassen. Zur damaligen Zeit waren Rechner ausschließlich proprietäre Systeme, die auf „hauseigenen“ Betriebssystemen liefen und nicht zur Kommunikation untereinander eingerichtet waren.
Als Lösung für dieses Kompatibilitätsproblem wurden den über Telefonleitungen zu koppelnden Großrechnern auf Vorschlag von Wesley Clark, Wegbegleiter von Kleinrock und Baran, relativ kleine Computer vorgeschaltet, die sogenannten Interface Message Processors (IMPs). Sie dienten dem gegenseitigen Austausch von Daten zwischen den über das Netz verbundenen Standorten. Dafür wurden die IMPs von der ARPA vorkonfiguriert. Aufgrund ihrer gleichen Bauart konnten sie untereinander kommunizieren. Die jeweilige Forschungseinrichtung musste vor Ort lediglich die Kommunikation zwischen den eigenen Rechnern, den sogenannten Hosts, und dem IMP herstellen. Durch diesen Aufbau sicherte sich die ARPA zugleich in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht die Kontrolle über das Netz. Der IMP ist übrigens eine Vorform dessen, was heute als Router3 bezeichnet wird.
Mit der Einrichtung des IMP-IMP-Subnetzes wurde kurz vor Weihnachten 1968 das Unternehmen Bolt, Benarek and Newman (BBN), eine Ausgründung des Massachusetts Institute of Technology, beauftragt, das sich in der Ausschreibung um die Leistungsvergabe durchsetzen und dadurch eine zentrale Position in Aufbau und Verwaltung des Netzes sichern konnte.
Es sollte sich bald zeigen, dass BBN – auch durch das Verdienst von Robert Kahn, der zu dieser Zeit bei BBN tätig war und in der weiteren Entwicklung des Arpanets noch zu erwähnen sein wird – über die Zeit neben der ARPA zum „Kontroll- und Diagnosezentrum des Netzes“ (Kirpal und Vogel 2006, S. 140) avancierte.
Nach weniger als neun Monaten lieferte das Unternehmen Ende August 1969 bereits den ersten IMP an die University of California in Los Angeles aus, der dort als erster des im Aufbau befindlichen Computernetzwerkes am 02. September 1969 an den Hostcomputer der Universität, einen Rechner der Serie SDS Sigma, erfolgreich angeschlossen wurde. Diese Verbindung markierte einen Meilenstein auf dem Weg zu einem gemeinsamen Computernetzwerk, das wenige Wochen später, am 29. Oktober 1969, seine Geburtsstunde feierte. Weitere IMPs für das Standford Research Institute, die University of California in Santa Barbara und die University of Utah wurden im September und Oktober 1969 bereitgestellt.
Den späteren Nutzern des Netzes, den Hostbetreibern, kam die Aufgabe zu, durch Entwicklung eines „Host-to-Host Protocol“ (Kleinrock 2010, S. 32) die Kommunikation zwischen den Hosts sowie die Kommunikation zwischen den IMPs und den Hosts zu gewährleisten. Dazu fand sich bei ihrem ersten Treffen in Standford im Sommer 1968 auf Einladung von Elmer Shapiro eine Gruppe aus Mitarbeitern der beteiligten Einrichtungen, die sogenannte Network Working Group (NWG), zusammen. In ihrer selbst organisierten Kooperation, die Shapiro koordinierte, prägte diese Gruppe aus hochqualifizierten und -motivierten Studienabsolventen eine Form des gleichberechtigten Miteinanders, die für eine offene, diskurs- und konsensorientierte, kooperative Netzkultur wegweisend war.
Die Entwicklung eines neuen Datenübertragungsprotokolls
Nur wenige Monate nach der ersten Vernetzung zweier Großrechner entschied sich die ARPA für die Ausweitung des Projekts mit dem Ziel, das Netz einer größeren Zahl an Hosts zugänglich zu machen. Im März 1970 reichte das Arpanet bereits bis an die Ostküste der USA. Auf der Spring Joint Computer Conference der American Federation of Information Processing Societies (AFIPS) im Mai 1970 wurde die Arpanettechnologie in einer viel beachteten Session vorgestellt.
Der Durst der ARPA-Forscher war noch lang nicht gestillt. Sie verfolgten alsbald die Idee, über Terminals auch Einrichtungen ohne leistungsfähige Großrechner den Zugang zum Netz zu verschaffen. In Vorbereitung auf diese Erweiterungen mussten die Möglichkeiten zur Kommunikation zwischen den vernetzten Computern, insbesondere zur Übertragung großer Dateien, verbessert werden. Es war damit an der Zeit, einen neuen Standard für den Dateitransfer zu erarbeiten. Im Juli 1972 war das neue Datenübertragungsprotokoll, das File Transfer Protocol (FTP), schließlich entwickelt und wurde 1973 implementiert.
Die E-Mail als Gegenstand des Interesses
Anlässlich einer Präsentation des Arpanets und der darüber zugänglichen Ressourcen der Netzteilnehmer auf der International Conference on Computer Communications (ICCC) in Washington, D.C. im Oktober 1972, mit der die ARPA nach Optimierung der Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den vernetzten Computern nun um weitere Mitstreiter im Forschungskontext des Pentagons warb, fand zum Erstaunen der Einladenden allerdings eine Anwendung das Interesse der Gäste, die anfänglich gar nicht im Mittelpunkt der Veranstaltung stand: die E-Mail.
Die erste ihrer Art hatte der Ingenieur Ray Tomlinson 1971 über das Arpanet verschickt. Als Einzelanwendung auf ein und demselben Computer in einem unabhängigen Computersystem war die E-Mail bereits in den 1960er Jahren bekannt. Noch zum Ausgang des Jahrzehnts hatte Lawrence Roberts jedoch, der 1966 als Programmleiter zur IPTO gekommen war, bezweifelt, dass die Übermittlung von Nachrichten zwischen Netzwerkteilnehmern eine hinreichende Motivation zum Aufbau eines entsprechenden Rechnernetzwerkes darstellen würde. Als es Ray Tomlinson Ende 1971 gelang, eine E-Mail über das Arpanet zu versenden, und er nach einigen Testmails an sich selbst es wagte, seinen Kollegen bei BBN die neue Anwendung per Mail vorzustellen, wurde Roberts schnell eines Besseren belehrt.
Tomlinson entschied sich damals für das @-Symbol als Trennungszeichen zwischen dem Benutzer- und dem Rechnernamen, da das bereits seit dem Mittelalter existierende Zeichen sonst kaum verwendet wurde, in dem damals relevanten Schriftsatz der US-Fernschreiber, American Standard Code for Information Interchange, kurz ASCII, jedoch vorhanden war. Im Juli des Folgejahre...