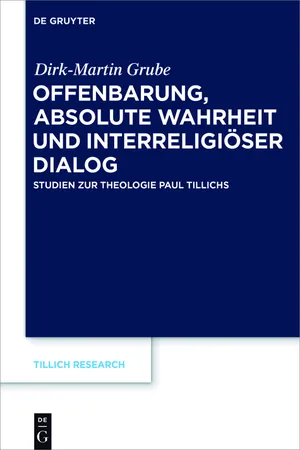Der erste Teil der Religionsphilosophie vom Sommersemester 1920 ist überschrieben „Das Wesen der Religion (die Religion als Princip.) Erstens: Die Religion als Funktion“.73 Unter Punkt a.) verhandelt Tillich die Frage, welche Methode adäquat ist zur Bestimmung des Gegenstandes ‚Religion‘.Es sei hier schon darauf hingewiesen, dass es Tillich dabei nicht bloß um eine Definition oder zumindest Charakterisierung des Begriffes der Religion geht, wie die Überschrift nahelegt. Sondern seine ganz spezifischen Ausgangsprämissen führen dazu, dass die Frage der Gewinnung des Phänomenbestands von Religion zugleich deren Rechtfertigung impliziert. Das ist auch der Grund, warum diese Frage als Ausgangspunkt der systematischen Diskussion im dritten Abschnitt dient: Ein Ansatz, bei dem die Bestimmung des Wesens von Religion zugleich deren Legitimation beinhaltet, wirkt im anglo-amerikanischen Bereich so fremdartig, dass er der Diskussion bedarf. Doch zunächst zu den drei Hauptmethoden Tillichs. Zum Zweck der Gewinnung des Begriffs der Religion kommen grundsätzlich drei Methoden in Frage. Das sind a. die supranaturalistische, b. die empiristische und c. die kritische Methode.74
b) Die empiristische Methode
Diese unterteilt sich in drei Unterarten, die naturalistisch-abstrahierende, die genetische und die phänomenologische. Zunächst zur naturalistisch-abstrahierenden Methode:
Diese ist durch den Versuch gekennzeichnet, das bei allen Religionen Gemeinsame zusammenzufassen und das Unterscheidende auszuschließen. Dagegen macht Tillich zu Recht geltend, dass es zunächst normativer Prinzipien bedarf, um bestimmte Phänomene überhaupt als Religionen zu identifizieren, bevor man zu deren Vergleich übergehen kann. Es setzt also schon einen Maßstab des Religiösen voraus, der aus anderen Quellen als der empiristischen Methode kommen muss.77
Dieser Punkt ist auch für die heutige Diskussion um die Frage der Definition des Religionsbegriffs relevant. Zwar scheint sich der Versuch, den Begriff der Religion so zu definieren, dass nach dem gemeinsamen Nenner aller Religionen gesucht und dieser dann als Definition von Religion verwendet wird,78 auch heutzutage zunächst einmal nahezulegen. Derartige, um es in Tillichs Nomenklatur zu sagen, naturalistisch-abstrahierende Verfahren scheinen weniger problematische Voraussetzungen zu machen, als ‚stipulative‘ Verfahren, die den Begriff der Religion durch bestimmte, zuvor definierte inhaltliche Charakterisierungen des Religiösen gewinnen wollen. Sie kommen mit weniger problematischen Voraussetzungen aus als stipulative Verfahren, da sie deskriptiv vorzugehen und keine bestimmten normativen Vorgaben zu machen scheinen. Sie scheinen also weitgehend wertfrei zu sein.
Doch abgesehen davon, dass derartige Verfahren zumeist an der Vielfalt der religiösen Phänomene scheitern,79 ergibt sich dabei auch ein prinzipielles Problem. Denn so wertfrei, wie es den Anschein haben mag, sind auch derartige Verfahren nicht. Tillich weist mit Recht darauf hin, dass auch derartige Verfahren ein bestimmtes Vorverständnis von Religion voraussetzen, das dann normative Funktionen bei der Definition des Religionsbegriffs ausübt. Man muss zunächst einmal einen Bestand an Phänomenen als religiös klassifiziert haben, um danach deren gemeinsamen Nenner suchen zu können. Dabei stellen sich natürlich Wertprobleme ein wie etwa das, ob man Phänomene, die (weitgehend) ohne einen Gottesbegriff auskommen, etwa den Theravada Buddhismus oder den Taoismus, auch zum Kreis der Religionen rechnen will oder nicht. Die dabei implizierten Bewertungen bedürfen der Begründung und diese Begründungslast übersteigt die Ressourcen, die ein naturalistisch-abstrahierendes Verfahren bieten kann.
Dasselbe lässt sich auch gegenüber dem, wenn man es so nennen will, ‚Nachfolgemodell‘ naturalistisch-abstrahierender Verfahren anführen, dem vor allem im anglo-amerikanischen Bereich heutzutage verbreiteten Versuch, den Religionsbegriff mit Hilfe Wittgensteinscher Familienähnlichkeiten definieren zu wollen:80 Zwar kann dieser Versuch dem Problem entgehen, dass das Phänomen der Religion so vielfältig ist, dass es sich dem Versuch entzieht, es mit Hilfe eines einzigen Kriteriums (oder einer Klasse zusammenhängender Kriterien) zu definieren. Doch bleibt dabei das Begründungsproblem bestehen: Es bedarf nach wie vor eines normativ wirksamen Vorverständnisses von Religion, mit dessen Hilfe bestimmte Phänomene als Religionen ausgemacht werden können, um anschließend Familienähnlichkeiten zwischen ihnen feststellen zu können. Das Problem der Begründung der dabei implizierten Werturteile wird auch durch den Ansatz bei Wittgenstein nicht gelöst.
Dass dieses an sich auf der Hand liegende Problem im anglo-amerikanischen Bereich oftmals unterschätzt wird, hat damit zu tun, dass philosophische Ansätze im Gefolge des späten Wittgenstein bisweilen zu unkritisch auf die Umgangssprache rekurrieren. Es wird nicht genügend reflektiert, dass die Wertungen, die in der Umgangssprache impliziert sind, ja nicht selbstverständlich sind, sondern auch wiederum der Begründung bedürfen. In Anlehnung an G.E. Moores berühmtes ‚open question‘-Argument formuliert: Die Frage nach der Begründung bestimmter, in der Umgangssprache implizierter Wertungen, ist prinzipiell ‚offen‘. Es ist also immer legitim, zurück zu fragen, ob etwa das, was in der Umgangssprache als ‚gut‘ bezeichnet wird, auch wirklich gut ist. Ebenso ist es legitim, zurück zu fragen, ob das, was in der Umgangssprache als ‚Religion‘ bezeichnet wird, auch wirklich religiös ist. Wenn etwa die Umgangssprache Phänomene wie den Taoismus als ‚Religion‘ bezeichnet, so kann legitimerweise zurückgefragt werden, ob der Taoismus auch wirklich eine Religion ist. Zur Beantwortung dieser Frage genügt der Verweis auf die Umgangssprache nicht, sondern dazu bedarf es anderer, weiter reichender Ressourcen.
Gegenüber allen derartigen Ansätzen, klassisch naturalistisch-abstrahierenden oder modern Wittgensteinschen, ist Tillichs Hinweis nützlich, dass dabei immer schon auf die eine oder andere Weise ein normatives Vorverständnis wirksam ist. Er kann zur Explikation der bisweilen verschwiegenen normativen Vorgaben beitragen.81
Doch zurück zu Tillichs Diskussion der empiristischen Methode: Deren zweite Erscheinungsform ist die genetische. Sie ist durch den Versuch charakterisiert, das Wesen des Religionsbegriffs aus seinen Ursprüngen festzustellen. Die genetische Methode kann auch als psychologische auftreten. Dann wird aus der Entstehung von Religion deren Definition abgeleitet.82
Gegenüber der genetischen Methode macht Tillich allgemein geltend, dass nicht einzusehen ist, warum einer Erscheinung in ihren Anfängen eine höhere Dignität zukommen soll als in ihren entwickelteren Formen.83 Und gegen die psychologische Variante macht er vor allem geltend, dass sie auf einer Verwechslung von Wesen und Entstehungsursache beruht. Wenn, wie zumeist der Fall, diese psychologische Variante im Dienst religionskritischer Annahmen steht, dann ist immer schon aus anderen Gründen vorausgesetzt, dass Religion unwahr oder illegitim ist.84
Auch dieser Punkt, dass Resultate kausaler Erklärungen des Entstehens von Religion nicht so einfach auf die Geltungsebene übertragen werden können, ist meines Erachtens für die heutige Diskussion relevant. Man muss sich bewusst sein, dass der Transfer kausaler Erklärungen auf die Geltungsebene immer einen besonderen Schritt erfordert, der eine eigene Begründung verlangt. Wenn, wie zumeist auch heute noch der Fall, kausale Erklärungen religionskritisch eingesetzt werden, dann wird zumeist die Illegitimität von Religion heimlich schon vorausgesetzt, statt erst durch die Kausalerklärung legitimiert. Die Kausalerklärung liefert sozusagen die nachträgliche Begründung dessen, was man immer schon gewusst hat. Aus heutiger Perspektive sind als Vertreter eines unreflektierten Übergangs von kausalen Erklärungen zu Geltungsfragen neben der Psychologie auch noch die Soziologie zu nennen.85
Zur dritten Unterart der empiristischen Methode, der phänomenologischen:86 Tillich macht ihr gegenüber geltend, dass der Versuch, durch ein exemplarisches Vorbild den Sinn eines Begriffs zu erfassen, an der Gegenfrage scheitert, welches Vorbild denn nun exemplarisch ist. Unten (Abschnitt 2) wird gezeigt, dass diese Frage auch für Tillichs weiteres Nachdenken an dieser Stelle maßgeblich geblieben ist.
Nun zur dritten Hauptmethode zur Gewinnung des Religionsbegriffs, die Tillich selbst vertritt.
c) Die kritische Methode
Schon in der Einleitung zur Religionsphilosophie hatte Tillich bei seiner Besprechung des Gegensatzes zwischen Empirismus und Rationalismus gegenüber ersterem geltend gemacht, dass es Vernunftwahrheiten gebe, „die vor aller Erfahrung Gültigkeit haben, weil jede Erfahrung sie schon voraussetzt, weil ohne sie überhaupt nichts erfahren werden kann.“87 Diese dürfen allerdings nicht abgelöst werden von der Erfahrung, sondern müssen rekonstruiert werden als „Einheitsformen des Bewußtseins, unter denen das Bewußtsein die Mannichfaltigkeit erfaßt, [als] seine Funktionsgesetze, die es konstituieren“.88 Das „Grundgesetz des Bewußtseins aber ist die Einheit in der Mannichfaltigkeit“,89 der auch die Kategorien und Raum und Zeit untergeordnet sind.
Damit ist auch die Aufgabe der Religionsphilosophie beschrieben: Sie hat aufzuweisen, dass Religion eine notwendige Funktion des Geistes ist und soll ihre „konstitutive Bedeutung für das Bewußtsein zeigen.“90
Hier zeigt sich Tillichs grundsätzliche Strategie zur Beantwortung von Geltungsfragen im religiösen Bereich: Die Legitimation von Religion erfolgt nicht über die dabei implizierten Erkenntnisgegenstände,91 sondern über das erkennende Subjekt. Er argumentiert, dass es nicht angehe, die Legitimität von Religion etwa über den Gottesbegriff und dessen Plausibilitätsnachweis sichern zu wollen. Abgesehen von den Schwierigkeiten eines derartigen Nachweises kann nicht gezeigt werden, dass derartige Begriffe „identisch sind mit dem, was die Religion in ihren Vorstellungen meint.“92 Vorher hatte Tillich derartige Versuche sogar als „im tiefsten Grund unfrommer Gedanke“ bezeichnet, da dabei „dem Zufall intellektueller Fähigkeiten die Entscheidung über das schlechthin Entscheidende im menschlichen Leben“93 anheimgestellt wird.
Tillichs kritische Methode94 macht in der Religionsphilosophie von 1920 das Proprium seiner apologetischen Bemühungen aus. Ich zitiere darum die einschlägige Passage im Folgenden wortwörtlich: „Die erkenntnistheoretische Entwicklung führt zu dem Absoluten in irgendeiner Fassung. Das Absolute aber nimmt für das Bewußtsein eine Reihe von Formen an, unter denen auch die Religion vorkommt. Für die Religion wird dann das Absolute zum Gott.“95 Dieses Absolute ist dabei kein metaphysischer Gegenstand, sondern eine Funktion, genauer, „das absolute Bewußtsein, von dem die Welt getragen ist.“96
Die Struktur der Argumentation ist also folgende: Das Absolute wird vermittels einer transzendentalen Argumentation als Funktional-Notwendiges erwiesen; von dort führt der Weg zur Religion, als möglicher Bewusstseinsform; von dort her, also unter Voraussetzung der grundsätzlichen Legitimität von Religion, wird Gott erfasst.97 Oder, wie Tillich es etwas zweideutig formulieren kann: „[E]s ist das Bewußtsein, das gewissermaßen Gott als Gott schafft.“98
Tillich kommt über eine kritische Analyse des Begriffs ‚Ding an sich‘ zum gesuchten Absoluten, oder, wie er es hier nennt, zum Unbedingtheitserlebnis. Dieses besteht im Seins-Erlebnis, das, in Unterscheidung zu allem Seienden, dem Denken quasi autonom gegenübertritt und a...