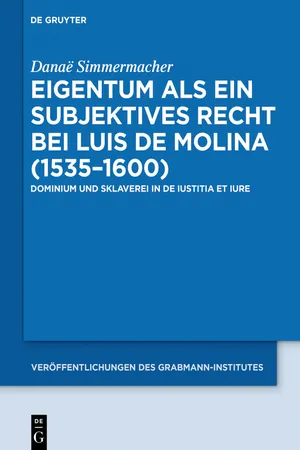1 Einleitung
Im Juli 2015 bittet der aus Argentinien stammende Papst Franziskus bei seinem Besuch in Bolivien um Vergebung für die Verbrechen der Kirche gegen die indigene Bevölkerung während der sogenannten ‚Entdeckung Amerikas‘ durch die Europäer. Ohne Zweifel tragen nicht nur die europäischen Siedler und weltlichen Herrscher die Verantwortung für den Genozid an der indigenen Bevölkerung und die Versklavung von ca. 15 Millionen Afrikanern, die als Arbeitskräfte in die ‚Neue Welt‘ gebracht wurden. Auch die Missionare, die von der katholischen Kirche nach Nord-, Mittel- und Südamerika entsandt wurden, haben dazu beigetragen, dass die europäische Kolonisierung Amerikas als ein Zeugnis menschlicher Grausamkeit, grenzenloser Habgier und furchtbaren Machtmissbrauchs in die Geschichte eingegangen ist.
Auf der anderen Seite entwickelte sich im 16. Jahrhundert in Spanien und Portugal eine christliche Rechts- und Staatsphilosophie, die als politische Philosophie im eigentlichen Sinne1 Einfluss auf die Politik der spanischen Krone nahm und unter anderem einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Völkerrechts beigesteuert hat. Die Theologen der Schule von Salamanca setzten sich in ihren Schriften, ihrer akademischen Lehrtätigkeit sowie ihrer Tätigkeit als Beichtväter und Berater der spanischen Herrscher auch mit der Rechtswissenschaft, der Ökonomie und der Moralphilosophie auseinander. Sie stellten sich so den Herausforderungen, vor die sich durch die Entdeckung einer ‚Neuen Welt‘ nicht nur die Politik, sondern auch die Theologie im Europa der Frühen Neuzeit gestellt sah, die durch die Reformation auch mit innereuropäischen Glaubensdebatten zu kämpfen hatte. Aus der interdisziplinären Beschäftigung mit Problemen, die sich unter anderem daraus ergaben, dass der orbis christianus nicht länger als gleichbedeutend mit der Welt angesehen werden konnte,2 entwickelten die Autoren der Schule von Salamanca innovative Konzepte, die zum Beispiel den Grundstein für eine liberale Ökonomie, das moderne Völkerrecht bis hin zu den Menschenrechten, für eine neue Sicht auf das Verhältnis von göttlicher Vorsehung und menschlicher Willensfreiheit oder den politischen Liberalismus legten.
Da das theoretische Fundament ihrer Disputationen das Naturrecht der mittelalterlichen Scholastik bildet, wird die Denkrichtung der Schule von Salamanca auch als Spanische Scholastik oder Spätscholastik bezeichnet. Jede dieser Benennungen hat Anlass zur Kritik geboten:3 Letzterer kann vorgeworfen werden, das Präfix ‚spät‘ könne den Eindruck erwecken, diese Autoren seien intellektuelle Nachzügler der mittelalterlichen Hochscholastik. ‚Spanische Scholastik‘ kann insofern als unvollständig angesehen werden, als dass die portugiesischen Autoren hier nicht berücksichtigt werden, weshalb in der Forschung auch die Bezeichnung ‚iberischer Humanismus‘ verwendet wird. Zwar ist auch die Bezeichnung Schule von Salamanca nicht unproblematisch, da nicht alle ihr zugeordneten Theologen an der Universität von Salamanca lehrten. Doch gilt Francisco de Vitoria als Begründer dieser Denkrichtung, der an der Universität von Salamanca wirkte und ein großer Teil der Autoren studierte oder lehrte in Salamanca. Daher wird im Folgenden diese Bezeichnung verwendet, wenngleich Luis de Molina, dessen Werk De Iustitia et Iure die Grundlage der Analyse bildet, selbst zu den Gelehrten gehört, die nicht in Salamanca lehrten. Im Folgenden werden Fragestellung und Gliederung der vorliegenden Untersuchung vorgestellt und ein kurzer Überblick über den Stand der wissenschaftlichen Forschung gegeben. Im Anschluss wird das Leben von Luis de Molina kurz beschrieben.
1.1 Fragestellung und Gliederung der Untersuchung
Die vorliegende Untersuchung analysiert erstmalig den Zusammenhang von rechtsmetaphyischen und rechtspraktischen Fragestellungen im Werk von Luis de Molina. Durch die Verknüpfung seiner Willensmetaphysik aus der Concordia und der Rechtslehre aus De Iustitia et Iure wird anhand der Sklavenproblematik die Interpretation des subjektiven Rechts avant la lettre begründet. Der Fokus liegt auf den rechtsphilosophischen Grundbegriffen ius (Recht) und dominium (Eigentum, Herrschaft). Molina benennt in De Iustitia et Iure explizit ein ius qua homo et qua proximo, ein Recht, das jemandem als Mensch und als Nächster zukommt und spricht auch Sklaven dominium zu, da sie durch die Sklaverei nicht ihre Willensfreiheit verlieren. Sklaven nehmen in Molinas Konzept damit einen sensiblen Sonderstatus zwischen Rechtssubjekt und Rechtsobjekt ein.
Die Bestimmung des ius als subjektives Recht und Molinas Unterscheidung des Sklaven als qua homo et proximo und qua servo begründen die These dieser Untersuchung, dass Molinas Rechtslehre einen wichtigen Grundstein für die Frage bildet, welche Rechte zugestanden werden, wenn jemandem die Eigenschaft zukommt, Träger von Rechten sein zu können. Diese Frage ist für spätere Theorien von Grundrechten und auch Menschenrechten von großer Bedeutung. Dennoch kann Molinas Entwurf der iura qua homo nur als Rohbau einer Theorie von Grundrechten betrachtet werden und nicht etwa als frühe Theorie von Grundrechten, da der Sklave seine Rechte nicht vor Gericht einfordern kann, sodass ein wesentliches Merkmal der Grundrechte4 in Molinas Rechtslehre nicht gegeben ist. Die Rechte qua homo dürfen dabei nicht mit den Menschenrechten verwechselt werden, da Molina Sklaven einen rechtlichen Sonderstatus zwischen Rechtssubjekt und Rechtsobjekt zuschreibt, der sich mit Menschenrechten nicht vereinbaren lässt. Doch begründet er so, welche Elementarrechte jemandem zukommen, der grundsätzlich als Träger von Rechten anerkannt wird. Die vorliegende Untersuchung stellt somit einen Beitrag für die Grundlagenforschung zu Grund- und Menschenrechten dar.
Im Kontext der These werden weiterführende Fragen herausgearbeitet, die vor allem im Hinblick auf das sensible Beispiel des dominium über Menschen, die in Sklaverei geraten sind, relevant sind. Wichtig ist zunächst die Verortung des als subjektives Recht avant la lettre bestimmten ius in Molinas Rechtslehre und damit die Frage, welche Funktion es erfüllt. Aus der Analyse der Grundbegriffe ius und dominium geht hervor, dass Molinas Bestimmung von ius als „Vermögen, etwas zu tun […], sodass dem Inhaber Unrecht geschieht, wenn [diesem Vermögen] ohne rechtmäßigem Grund entgegengewirkt wird“5 als subjektives Recht zu deuten ist und dass dominium ein Paradigma, das heißt ein musterhaftes Beispiel für ein subjektives Recht ist, das als Anspruchsrecht bestimmt wird. Dominium wird dabei auf zwei verschiedenen Ebenen untersucht: zum einen rechtsmetaphysisch als Vermögen, Träger von Rechten sein zu können und zum anderen rechtspraktisch als dominium proprietatis (Eigentum) und dominium iurisdictionis (Herrschaft). Daran schließen sich Überlegungen an, ob sich dominium bei Molina als rechtliche Freiheit interpretieren lässt und in welchem Verhältnis rechtliche Freiheit, Handlungsfreiheit und Willensfreiheit zueinander stehen. Molina erklärt die Vernunft und die Willensfreiheit zur Voraussetzung zum dominium, sodass das beschriebene Verhältnis vor allem im Hinblick auf dominium über und von Sklaven bedeutsam ist. Vor dem Hintergrund des christlichen Naturrechts kann dominium dem Menschen nur von Gott gegeben sein und laut Molina hat der Mensch dominium ex natura rei. Daher muss erläutert werden, ob dominium als natürliche rechtliche Freiheit aufgefasst werden kann und welche Bedingungen an seine Ausübung geknüpft sind bzw. ob dominium als dem Menschen von Gott gegeben eine moralische Komponente enthält. Für die politische Philosophie ergibt sich daraus die Frage nach dem Verhältnis zwischen subjektivem Recht des Einzelnen und dem Wohl des Gemeinwesens (bonum commune), das durch objektives Recht bzw. die Gesetzgebung festgelegt ist. Die Klärung dieser Fragen ermöglicht schließlich die Bestimmung des rechtlichen und anthropologischen Status von Sklaven innerhalb Molinas Rechtslehre, wobei auch berücksichtigt wird, wie das dominium vor dem Hintergrund dieser Analyse im Falle eines Selbstverkaufs in die Sklaverei zu bewerten ist.
Diesen Fragen kann nicht allein unter Bezug auf De Iustitia et Iure nachgegangen werden, da ihr theoretischer Kern im Zusammenhang von Molinas Willensmetaphysik aus der Concordia und seiner Rechtsphilosophie in De Iustitia et Iure, die auch ethische Aspekte beinhaltet, besteht. Molina verweist in De Iustitia et Iure zwar selten auf die Concordia, doch kann seine Rechtslehre ohne den theoretischen Kontext seines Konzeptes der menschlichen Freiheit in der Concordia nicht angemessen erschlossen werden.6 Der freie Wille des Menschen und seine Selbstbestimmung nehmen nämlich auch in Molinas Rechtslehre eine bedeutsame Rolle ein. Besonders spannungsreich ist diese Verbindung mit Blick auf den rechtlichen und anthropologischen Status von Sklaven, die Molina nicht nur als Eigentumsobjekte ihrer Herren ansieht, sondern sie auch unter dem Kriterium qua homo et qua proximo betrachtet, das heißt als Menschen und als Nächste, die sich im Zustand der Sklaverei befinden. An der Bestimmung des rechtlichen und anthropologischen Status von Sklaven lässt sich schließlich beurteilen, ob die Konzepte des ius und des dominium in Molinas De Iustitia et Iure als Elemantarrechte bzw. Rohbau einer Theorie von Grundrechten angesehen werden können.
Die Untersuchung ist in vier Hauptkapitel gegliedert. Da Molina selbst den Terminus ‚subjektives Recht‘ nicht verwendet, sondern dieser eine Interpretation avant la lettre des ius darstellt, ist der Analyse von Molinas Rechtslehre eine Skizze der historischen Genese des subjektiven Rechts bis ins 16. Jahrhundert bzw. bis zur Schule von Salamanca vorangestellt (Kapitel 2), an deren Ende ein kurzer Ausblick in die Neuzeit gegeben wird. Dort taucht erstmals die Bezeichnung ius subjective sumtum auf und subjektives Recht wird in den Rechtstexten der Neuzeit systematisch behandelt. In diesem Kapitel werden die Konzepte der für die Genese des subjektiven Rechts relevanten Autoren in gebotener Kürze vorgestellt. So werden wichtige Aspekte gewonnen, anhand derer subjektives Recht in Molinas Werk bestimmt werden kann.
Im dritten Kapitel erfolgt die Analyse des ius und des dominium in Molinas De Iustitia et Iure, wobei auch das Verhältnis zwischen ius und dominium beleuchtet wird. Neben den Bestimmungen des dominium proprietatis und des dominium iurisdictionis wird auch erläutert, wodurch sich diese vom Besitz, Nießbrauch und Gebrauch unterscheiden. Am Ende des Kapitels wird in einem Resumee die Bestimmung und die Funktion des subjektiven Rechts in Molinas Rechstheorie festgehalten, wodurch die rechtspraktische Ebene des dominium erschlossen wird.
Das vierte Kapitel lotet die Bedingungen und Grenzen des subjektiven Rechts bei Molina aus und widmet sich der rechtsmetaphysischen Ebene des dominium. Zunächst wird die Willensmetaphysik aus der Concordia erläutert, die die Grundlage der Untersuchung bildet, wodurch jemand nach Molina zum Träger von Rechten w...