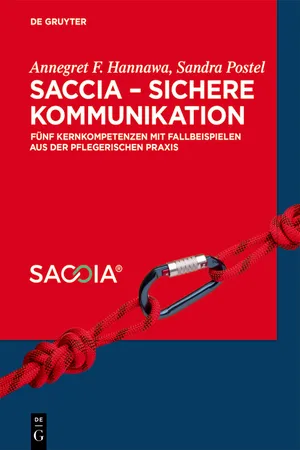
SACCIA - Sichere Kommunikation
Fünf Kernkompetenzen mit Fallbeispielen aus der pflegerischen Praxis
- 348 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
SACCIA - Sichere Kommunikation
Fünf Kernkompetenzen mit Fallbeispielen aus der pflegerischen Praxis
Über dieses Buch
Wie kann eine bessere Patientensicherheit und Versorgungsqualität durch eine kompetentere zwischenmenschliche Kommunikation möglich werden?
Dieses Fallstudienbuch bietet schnellen Zugriff auf praktische Lösungen in kritischen Kommunikationssituationen im Versorgungalltag von Pflegefachkräften in Aus- und Fortbildung. Jeder Falldiskussion folgen pädagogische Fragen und angewandte Übungen, die ein besseres Verständnis der sicherheitsrelevanten Kommunikationsprozesse fördern und den Lernprozess des Lesers unterstützen.
Die Autoren erläutern in ihrem innovativen Werk grundlegende Prinzipien der zwischenmenschlichen Kommunikation, und beziehen diese auf alltägliche Prozesse in der Gesundheitsversorgung, um damit eine wichtige Grundlage für eine bessere Patientensicherheit und Versorgungsqualität zu schaffen. Die Fallstudien basieren auf wahren Begebenheiten und beschreiben sowohl unerwünschte Ereignisse als auch Beinahe-Schadensfälle in nahezu allen Bereichen der Pflege.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Teil III Patientensicherheit und SACCIA Sichere Kommunikation: Fallbeispiele aus sechs Versorgungsphasen
Phase 1: Informationssammlung

Fall 1: Welches Insulin?
Kommunikationsrahmen: Interaktion zwischen Pflegefachperson und Patient
Ereignis: Unsichere Kommunikation, die beinahe zu einer unterlassenen oder falschen Medikation führt
Ergebnis für die Patientensicherheit: Zwischenfall mit Beinaheschaden
Prinzipien der zwischenmenschlichen Kommunikation
1. Inhaltliche Redundanz durch direkte Kanäle fördert die Richtigkeit der kommunizierten Inhalte und deren Verständnis
Der Arzt verordnet die Medikation des Patienten mithilfe unleserlicher Handschrift.
Während der Korrektur des ursprünglichen Klarheitsfehlers vermittelt der Arzt falsche Informationen an die Pflegende: Er benennt das falsche Insulin und sagt fälschlicherweise aus, dass der Patient die Medikation selbstständig einnehme.
Das Personal der Notaufnahme vermittelt falsche Informationen – es gibt an, dass der Patient sich sein Insulin selbstständig spritzt.
2. Kommunikation verfolgt verschiedene Ziele
Der Arzt reagiert genervt auf die sichere Kommunikationspraxis der Pflegenden, anstatt diese Kommunikationsepisode für eine einheitliche Verständnisfindung einzusetzen. Seine Reaktion erfolgt wahrscheinlich aus der Empfindung heraus, dass er sich von einer hierarchisch unterlegenen Pflegefachperson infrage gestellt fühlt. Er decodiert die Kommunikation der Pflegenden also zu sehr im relationalen statt im funktionalen Kontext (d. h. einer sicheren Medikation des Patienten).
3. Kommunikation beruht auf subjektiven Vorannahmen und Wahrnehmungen
Das Personal der Notaufnahme geht davon aus, dass der Patient sich sein Insulin selbstständig spritzt. Diese (Fehl-)Annahme wird nicht mit dem Patienten oder dessen Angehörigen verifiziert.
Diskussion
- 1. In der Notaufnahme wird davon ausgegangen, dass der Patient sich das Insulin selbstständig spritzt; diese (Fehl-)Annahme wird jedoch nicht mithilfe einer sicheren Kommunikation mit dem Patienten oder dessen Angehörigen verifiziert.
- 2. Der Arzt versteht die erneute Kontaktaufnahme der Pflegenden als zwischenmenschliche Kritik anstatt als Sicherheitsmaßnahme. Man kann nur hoffen, dass die unangemessene Reaktion des Arztes die Pflegende nicht entmutigt, auch in Zukunft das Wort zu ergreifen, wenn sie ein derartiges Patientensicherheitsrisiko erkennt.
Kommunikationsstrategien nach Hannawa-SACCIA
- – Der Arzt hätte die Medikation des Patienten entweder digital oder mithilfe lesbarer Handschrift vermitteln können.
- – Das Personal der Notaufnahme hätte im Gespräch mit dem Patienten oder dessen Angehörigen validieren können, dass der Patient sich sein Insulin selbstständig spritzt, statt einfach davon auszugehen.
- – Der Arzt hätte während des Telefonats mit der Pflegenden sichergehen können, dass er das Insulin richtig benennt; gegebenenfalls hätte er seine Unsicherheit bezüglich der Bezeichnung des Insulins zum Ausdruck bringen können, damit die Pflegende das Medikament nochmals validiert.
- – Der Arzt hätte seine Reaktion auf die Frage der Pflegenden bezüglich des Insulins am Ende des Falls auf die Patientensicherheit ausrichten können, statt sie als zwischenmenschliche Kritik aufzufassen. Die Pflegende hätte dies weiter unterstützen können, indem sie ihre Frage explizit als patientensichere Kommunikation betitelt und eine zwischenmenschliche Kritik darin explizit ausschließt.
Kommunikationslehren für eine bessere Patientensicherheit und Versorgungsqualität

Fragen zur Diskussion und Übungen
- 1. Wie könnte unterstützt werden, dass die Kommunikation zwischen Pflegenden und Ärzten auf angemessene Art und Weise verläuft?
- 2. Erläutern Sie drei Wege, wie das aufnehmende Team aus Arzt und Pflegefachperson die Aussage des Patienten, er könne das Insulin selbst spritzen, validieren könnte.
- 3. Stellen Sie in einem Rollenspiel das Telefonat zwischen dem Arzt und der Pflegefachperson na...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Grußworte aus den DACH-Ländern
- Vorwort von Hedwig François-Kettner
- Vorwort von Patricia Benner
- Abkürzungsverzeichnis
- Inhalt
- Einleitung
- Teil I Patientensicherheit: Grundlagen, Herausforderungen und Trends
- Teil II SACCIA Sichere Kommunikation: Grundlagen, Herausforderungen und Trends
- Teil III Patientensicherheit und SACCIA Sichere Kommunikation: Fallbeispiele aus sechs Versorgungsphasen
- Zusammenfassung
- Schlusswort von Gerald Gaß: Kommunikation im Krankenhaus: Chancen und Herausforderungen der Spezialisierung
- Schlusswort von Markus Mai und Franz Wagner: Berufspolitische Implikationen zur Frage der Sicherheit für Menschen mit Pflegebedarf
- Literaturverzeichnis
- Stichwortverzeichnis