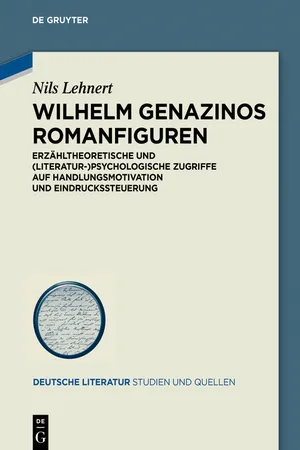
Wilhelm Genazinos Romanfiguren
Erzähltheoretische und (literatur-)psychologische Zugriffe auf Handlungsmotivation und Eindruckssteuerung
- 676 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Wilhelm Genazinos Romanfiguren
Erzähltheoretische und (literatur-)psychologische Zugriffe auf Handlungsmotivation und Eindruckssteuerung
Über dieses Buch
Wilhelm Genazinos Romanfiguren bilden den Schlüssel zum Verständnis seiner 'Figurenromane'. Diese Studie leistet diesbezügliche Pionierarbeit und stellt musterhafte Figurenfacetten und Verhaltensstrategien heraus.
Dabei fundiert die Arbeit künftige Forschungen zunächst durch ein Drei-Schichten-Modell, um die Einschätzung abzufedern, es handele sich bei Genazino um die gleiche Figur in Dauerschleife. Das Rückgrat der multimethodisch und interdisziplinär angelegten Studie bildet die Impression-Management-Theorie, welche im Sinne eines Theorietransfers für literaturwissenschaftliche Textanalysen fruchtbar gemacht wird, um die bestehenden Modelle zur Handlungsmotivation in einen größeren Rahmen zu setzen. Insbesondere für Genazinos postmoderne, multiple und zerrüttete Figuren übernimmt Impression Management als Selbstsicherungsmechanismus wichtige Funktionen.
Die damit angesprochene 'Gretchenfrage' der Figurentheorie – Sollte Figuren 'intern' Motivation und Kalkül, mithin eine 'menschliche' Psyche, unterstellt werden oder sind sie 'extern' nur als funktionale 'Bausteine' im Textgebäude zu werten? – wird im Zuge der Analyse pragmatisch beantwortet, um die in Frontstellung einander gegenüberstehenden Lager zu versöhnen.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information

1Innenwelten – Außenwirkungen
1.1Individuum vs. Gesellschaft, Distinktion vs. Zugehörigkeit
Die strukturalistische Annäherung…

| [1] | „Sie schienen ihre Dumpfheit nicht zu bekämpfen. Sie erlaubte ihnen, als Halbtote durch das Leben zu kommen.“ (Wohnung, S. 22 f.) Im Duktus des altbekannten Unterschieds von ‚Wir haben gewonnen‘ vs. ‚Die haben verloren‘ geht mit der offensiven Herabwürdigung der ‚third party‘ (⇨I.3.3) auch die 3. Person Plural einher, womit zwischen zwei unterscheidbaren Positionen eine Demarkationslinie gezogen wird: „Er glaubte, daß zwischen ihm und den anderen ein grundsätzlicher Unterschied war.“ (Sorgen, S. 160) Mit den abweichenden Überzeugungen (⇨II.1.6) und Lebensstilen (⇨II.1.5) und also dem Status Quo der Distinktion bei gleichzeitiger Wahrnehmung als Individuum sind die Protagonisten durchaus zufrieden, da mit der Geringschätzung der anderen immer eine gleichzeitige Hochstufung des eigenen Selbst verbunden ist. |
| [2] | „Gleichzeitig belastete mich die Unzufriedenheit mit meiner derzeitigen Lage. Ich sehnte mich nach mehr Normalität. Wie die meisten anderen Menschen wollte ich tagsüber arbeiten und nachts schlafen und am Wochenende ins Kino gehen.“ (Regen, S. 20) Was unter der Chiffre der ‚Normalität‘ verborgen wird, ist die implizite Setzung von ‚Viele machen das, also ist es wohl normal‘. Die empfundene Abweichung wird als unangenehm wahrgenommen, sodass ein unzufrieden gelabeltes Einzelschicksal in den Zugehörigkeitswunsch mündet: |
| Zwar darf die Ironie nicht überlesen werden, aber der Wunsch ‚dazuzugehören‘, ist nichtsdestotrotz sinnfällig.663 (⇨I.4 u. ⇨II.1.5) Den Übergang zur nächsten Kategorie bilden Aussagen, die im Grenzbereich der Wahrnehmung zwischen Individuum und Gesellschaft anzusiedeln sind: „Ich betrachte die an mir vorbeigehenden Leute und rede mir ein, daß ich so bin wie sie. Ich zähle auf, was ich mit ihnen gemeinsam habe. Eine Weile geht es ganz gut.“ (Regenschirm, S. 109) Auch hier handelt es sich um den Wunsch, ‚normal‘ zu sein; dass es des Einredens, des Bruders des Selbstbetrugs, bedarf, um sich als Teil der Gesellschaft wahrnehmen zu können, spricht noch für den Zugehörigkeitswunsch. Dass das Herzählen von Gemeinsamkeiten – wenngleich auch nur „eine Weile“ – „ganz gut“ funktioniert, bereits für die tendenziell zufriedene Zugehörigkeit. | |
| [3] | Erzählpraktisch interessant ist – in der eben bereits angesprochenen Unterscheidung der Personalpronomen – das folgende Beispiel für ungetrübtes Einverständnis mit der Zugehörigkeit zur Gesellschaft: „Wir sind alle nur sommerlich bekleidet.“ (Frauen, S. 8) Zwar handelt es sich eher um Einschätzungen, die am äußeren Kreis der Familienähnlichkeit ihren Platz haben, aber sie sind nichtsdestoweniger überindividuell zu belegen: Sei es während eines öffentlichen Essens (vgl. Frauen, S. 61 f.), währenddessen sich der Protagonist mit der Zugehörigkeit zur Gesellschaft durchaus einverstanden und zufrieden erklärt, sei es während einer getätigten Beobachtung anderer Menschen: „Aus der Entdeckung eines Details ging immer nur die innere Gewißheit hervor, irgendwo dazuzugehören“ (Ausschweifung, S. 26; vgl. Ausschweifung, S. 45). |
| Bereits mit einem Fragezeichen zu versehen ist die Zufriedenheit des Protagonisten aus Genazinos Roman Wenn wir Tiere wären: Seine Aussagen, er würde sich „einzelne Individuen suchen, mit denen ich mich an versteckten Orten verabreden würde“ (Tiere, S. 28), sowie: „Du täuschst dich. Ich achte sehr darauf, dass ich Menschen, die nicht zu mir passen, aus dem Weg gehe (Tiere, S. 67), relativieren das Einverständnis, dazuzugehören und verengen den Begriff ‚Gesellschaft‘ auf eine als solche empfundene ‚In-Group‘ Gleichgesinnter. | |
| [4] | Diejenigen Menschen, denen der namenlose Ich-Erzähler lieber ausweicht, kennen alle Figuren Genazinos und nicht selten spielt dabei die Verknüpfung mit dem Komplex ‚Dünkel als Strategie der Distinktion‘ eine wichtige Rolle (⇨II.1.3 u. ⇨II.1.5): „Der Anblick der Touristen machte ihm Lust, sich von allen Menschen zu distanzieren.“ (Ausschweifung, S. 154) Hier im nega... |
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Dedication
- Inhalt
- Teil I: Grundlagen
- Teil II: Schlaglichter
- Teil III: Anhang
- Danksagung