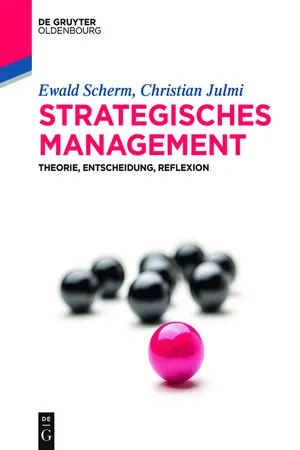
- 319 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Dieses Lehrbuch gibt einen Überblick über die Theorie des strategischen Managements und widmet sich in besonderem Maße den Merkmalen der Entscheidungen, die ihm Rahmen des strategischen Managements zu treffen sind. Das Buch will hierbei nicht nur die Grundlagen des strategischen Managements vermitteln, sondern darüber hinaus den Leser zu einer kritischen Reflexion der im strategischen Management gängigen präskriptiven Empfehlungen anregen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Strategisches Management von Ewald Scherm,Christian Julmi im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Business & Management. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Grundlagen des Managements
Mehr denn je gilt heute, dass die hohe Veränderungsgeschwindigkeit unserer Umwelt Unternehmen dazu zwingt, sich beständig an Gegebenheiten anzupassen, die nicht nur schwer voraussagbar sind, sondern nicht selten nach vollkommen neuen Handlungsweisen verlangen. Auf der anderen Seite sind es gerade Unternehmen, die vielfältige Veränderungsprozesse anstoßen und so die Umwelt mitgestalten, wodurch sich wiederum andere Unternehmen zu Reaktionen gezwungen sehen. In diesem Wechselspiel von Aktion und Reaktion erfolgreich am Markt zu bestehen, stellt für Unternehmen eine der größten Herausforderungen dar. Das strategische Management, eine noch recht junge wissenschaftliche Disziplin, beschäftigt sich ganz allgemein mit der Frage, wie diese Herausforderung erfolgreich bewältigt werden kann.
Ein wesentliches Ziel des strategischen Managements als wissenschaftliche Disziplin besteht darin zu erklären, auf welcher Basis Unternehmen Wettbewerbsvorteile erzielen (können) und weshalb manche Unternehmen erfolgreicher sind als andere. Im Fokus steht dabei nicht nur die Frage, welche Entscheidungen in einem Unternehmen zur Erreichung von Wettbewerbsvorteilen wie zu treffen sind, sondern auch, wie diese Entscheidungen umgesetzt werden sollen und was bei ihrer Reflexion zu beachten ist. Vor diesem Hintergrund soll das in diesem Lehrbuch vermittelte Wissen dem Leser einen Überblick über die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf das Treffen, Umsetzen und Reflektieren strategischer Entscheidungen bieten. Zunächst gilt es, das Verhältnis von Theorie und Praxis zu erläutern, um sich dann verschiedenen Perspektiven zu widmen, aus denen Management betrachtet werden kann. Abschließend werden von der funktionalen Perspektive ausgehend das Handlungsfeld Unternehmen näher betrachtet und Entscheidungen als zentrales Merkmal des (strategischen) Managements herausgestellt.
1.1 Das Verhältnis von Theorie und Praxis
Die Betriebswirtschaftslehre versteht sich überwiegend als anwendungsorientierte Wissenschaft. Nach diesem Verständnis ist Wissenschaft kein Selbstzweck, sondern hat das Ziel, zu einer besseren Daseinsbewältigung beizutragen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass gewonnene wissenschaftliche (d. h. theoretische) Erkenntnisse letztlich zu einer praktischen Umsetzung führen. Als praktisch angewandte Wissenschaft ist die Betriebswirtschaftslehre das, was Eugen Schmalenbach als „Kunstlehre“ bezeichnet (vgl. 1911). Ausgehend vom Leitgedanken der praktischen Verwertbarkeit theoretischer Erkenntnisse stellen sich damit drei grundlegende Fragen (vgl. Julmi 2017a):
- – Was ist Theorie?
- – Was ist Praxis?
- – Wie kommt man von der Theorie in die Praxis?
Diese drei zusammenhängenden Fragen sollen nachfolgend diskutiert werden.
1.1.1 Was ist Theorie?
Theorien bilden den Ausgangspunkt wissenschaftlicher Überlegungen. Allerdings gehen die Vorstellungen darüber, was unter einer Theorie zu verstehen ist, weit auseinander, sodass in der Betriebswirtschaftslehre (und darüber hinaus) keine Einigkeit dahingehend besteht, welche Anforderungen eine Theorie erfüllen muss, um überhaupt als solche zu gelten. Sehr allgemein gesprochen sind Theorien geordnete Systeme von Aussagen, mit denen Erkenntnisse über bestimmte Phänomene der Praxis gewonnen werden sollen. Weil sie nicht auf die Welt als Ganzes blicken, sondern nur auf ein ausgesuchtes Phänomen, das Teil dieser Welt ist, beziehen sie sich immer auf einen spezifischen Weltausschnitt. Für die Betriebswirtschaftslehre sind vor allem diejenigen Ausschnitte relevant, in denen das Unternehmen als Fixpunkt dient. Von diesem ausgehend werden dann die unterschiedlichsten Phänomene untersucht. Theorien sind Abstraktionen der Wirklichkeit, die bestimmte Eigenschaften und Zusammenhänge von Phänomenen hervorheben, andere zwangsläufig ausblenden. Es sind spezifische Perspektiven (oder Brillen), mit denen auf die Wirklichkeit geblickt wird. Dabei besteht zwischen Theorie und Wirklichkeit eine Art Unschärferelation: Je genauer man auf bestimmte Aspekte blickt, desto mehr verschwimmen andere Aspekte und der Blick auf das Ganze wird unscharf.
Welche Perspektive man als relevant erachtet, ist die subjektive, allerdings erheblich durch die wissenschaftliche Sozialisation und das soziale Umfeld beeinflusste Entscheidung jedes Wissenschaftlers. Ob ein Aussagensystem als Theorie allgemein Anerkennung und Akzeptanz findet, hängt von der jeweiligen Forschungsgemeinschaft ab. Wissenschaft ist also nicht zuletzt „das, was anerkannte Wissenschaftler als Wissenschaft anerkennen“ (Marquard 1986, S. 107). Ein Aussagensystem gilt erst dann als Theorie, wenn sich eine hinreichende Zahl von Forschern darauf geeinigt hat. So stehen Wissenschaftler nicht nur für Forschungsrichtungen, sondern auch für Denkstilgemeinschaften, in denen sich Gleichgesinnte zusammenfinden und meist ein gemeinsames – mitunter nur implizites – Theorieverständnis praktizieren. Theorien stellen damit auch soziale Regelsysteme dar, die das Handeln von Forschern beeinflussen, Orientierung stiften und gegebenenfalls einer umfassenden Theoriedynamik unterliegen. Während in der Betriebswirtschaftslehre die Vorstellung davon, was Theorien sind und wie diese gebildet werden, sehr heterogen ist, wird die Theoriebildung innerhalb einer Forschungsgemeinschaft (oder eines Paradigmas) für selbstverständlich erachtet und nicht infrage gestellt. Mit dem Grad der Spezialisierung einer Forschungsgemeinschaft findet eine zunehmende Angleichung des Denkstils in dieser statt. Dies erleichtert zwar die Zusammenarbeit innerhalb der Forschungsgemeinschaften, erschwert jedoch eine gemeinschaftsübergreifende Zusammenarbeit, da andere Forschungsgemeinschaften in der Regel andere Denkstile entwickeln. Auch hier lässt sich eine Variante der genannten Unschärferelation identifizieren: Je höher der Spezialisierungsgrad in einer Forschungsgemeinschaft ist, desto weniger lassen sich ihre Erkenntnisse auf andere Forschungsgemeinschaften übertragen.
Dieses Verständnis der Theorie als spezifischer Denkstil, das auf den Immunologen Ludwig Fleck zurückgeht (vgl. 1935), mag ernüchtern: Theorie erscheint nicht als unabdingbare Wahrheit, sondern eher als Konvention, auf die sich Wissenschaftler unabhängig von haltbaren methodologischen oder anderen Regeln einigen. Jedoch gerade die methodologischen Regeln der Theoriebildung und die Frage, ob vor dem Hintergrund dieser Regeln Aussagensysteme als Theorie gelten können oder nicht, sind in der Wissenschaft immer wieder Gegenstand – mitunter hitziger – wissenschaftstheoretischer Debatten. Neben der Diskussion konstitutiver Theoriemerkmale stehen bei der Suche nach intersubjektiven Maßstäben vor allem die Regeln der Begründung von Theorien im Vordergrund. Die Letztbegründung von Theorien, also deren Rückführung auf letzte, sichere Grundlagen, scheitert jedoch an der grundsätzlichen „Theoriebeladenheit der Erfahrung“ (Rusch 2001, S. 106), d. h. daran, dass es kein theoriefreies Denken gibt, aus dem heraus Theorien ausgewählt oder entwickelt werden. Das menschliche Denken ist immer schon durchtränkt von bestimmten theoretischen Annahmen wie beispielsweise derjenigen, dass alle Menschen faul sind. Solche Annahmen, die als Axiome oder Grundprämissen bezeichnet werden, lassen sich nicht beweisen und müssen geglaubt werden, bilden aber gleichzeitig das Fundament des Denkens und formen dadurch einen spezifischen Denkstil. Wer glaubt, dass alle Menschen faul sind, findet dafür Beweise, weil er aus dieser Perspektive aktiv danach sucht und die beobachteten Sachverhalte entsprechend deutet. Derartige Grundprämissen bestimmen, wie auf die Welt geblickt und welcher Weltausschnitt im Rahmen einer Theorie für relevant erachtet wird. Die Theorie bestimmt die Perspektive auf die Wirklichkeit und diese bestimmt die Auswahl und Entwicklung von Theorien. Der zirkuläre Erkenntnisprozess ohne Möglichkeit der Letztbegründung wird als hermeneutischer Zirkel oder Gestaltkreis der Erkenntnis bezeichnet.
Trotz der Unschärfe des Theoriebegriffs können jedoch grundlegend zwei Methoden der theoretischen Erkenntnisgewinnung unterschieden werden:
- – die naturwissenschaftliche Methode des Erklärens (und des Prognostizierens) und
- – die geisteswissenschaftliche Methode des Verstehens.
Die naturwissenschaftliche Methode des Erklärens nimmt an, dass alle sozialen Phänomene auf linearen Ursache-Wirkungs-Beziehungen beruhen. Aus dieser Sicht sind Theorien kausal determinierte, strukturelle Ablaufgesetze, deren Kenntnis es erlaubt, das zu erklärende Phänomen auch zu prognostizieren, d. h. Aussagen darüber zu treffen, unter welchen Voraussetzungen sich bestimmte Ereignisse herbeiführen lassen. Die geisteswissenschaftliche Methode des Verstehens nimmt dagegen an, dass sich soziale Phänomene im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Phänomenen nicht (allein) auf Ursachen zurückführen lassen und es hier keinen streng deterministischen Kausalzusammenhang gibt. Anstatt von Ursachen wird eher von Gründen gesprochen, die hinter menschlichen Handlungen stehen. Grob gesagt besteht der methodische Unterschied darin, dass die Naturwissenschaften erklären wollen, wie die Welt funktioniert, während die Geisteswissenschaften ihren Sinn verstehen wollen. Beide Arten von Denkstilen haben ihre Berechtigung. In einem Mordfall kann man beispielsweise mit der Logik des Erklärens den Tathergang oder Ablauf relativ exakt rekonstruieren. Sobald die Tat jedoch als intentionale Handlung verstanden wird, müssen die Motive oder Gründe des Täters geklärt werden; erst dann kann man den Mord auch verstehen.
1.1.2 Was ist Praxis?
Geht man nun von der Theorie in die Praxis, ergibt sich ein ähnlich unscharfes Bild. Die Zuordnung der Betriebswirtschaftslehre zu den anwendungsorientierten Wissenschaften sagt zunächst nicht mehr aus, als dass die theoretischen Erkenntnisse (wie auch immer) zur sukzessiven Verbesserung der unternehmerischen Praxis beitragen müssen. Über diese recht allgemeine Postulierung hinaus herrscht jedoch wenig Einigkeit darüber, was unter der Anwendungsorientierung zu verstehen ist. Einige der in der Literatur genannten praktischen Ziele sind
- – die Bewältigung des Knappheitsproblems auf unternehmerischer Ebene,
- – die Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Unternehmen,
- – die Bewältigung der Daseinsprobleme des Menschen sowie
- – die Erhaltung und Verbesserung des gesellschaftlichen Friedens.
Wenn jedoch nicht klar gesagt werden kann, worin die praktische Relevanz der Betriebswirtschaftslehre besteht, kann auch nicht bewertet werden, inwiefern theoretische Erkenntnisse praktisch relevant sind. Um zu Aussagen praktischer Relevanz zu kommen, ist es daher hilfreich, den Erkenntnisgegenstand der Betriebswirtschaftslehre in den Blick zu nehmen, also das, worüber Erkenntnisse generiert werden sollen. Folgt man dem Ansatz von Heinen (vgl. 1976; 1999), ist der Erkenntnisgegenstand der Betriebswirtschaftslehre das Treffen von Entscheidungen, da diese für alle ausführenden Tätigkeiten in Unternehmen bestimmend sind. Heinen betont, dass letztlich alles Geschehen in Unternehmen als Ausfluss menschlicher Entscheidungen angesehen werden kann. Die Anwendungsorientierung besteht aus dieser Sicht darin, die in Unternehmen tätigen Personen bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. Mit anderen Worten lässt sich der praktische Zweck von Theorien an ihrer Funktion als Entscheidungsunterstützung festmachen. Praktisch relevant sind theoretische Erkenntnisse also dann, wenn sie die tatsächlich getroffenen Entscheidungen in Unternehmen beeinflussen.
Mit der Entscheidung als Ausgangspunkt geraten die verschiedenen Phasen des Entscheidungsprozesses in den Blick, für die sich die praktische Relevanz ergeben muss. Ungeachtet zahlreicher Phasenschemata können ganz allgemein zwei Phasen unterschieden werden:
- – Definition der Entscheidungssituation und
- – Auswahl einer Alternative.
Bei der Definition der Entscheidungssituation geht es darum, wie das bestehende theoretische Wissen die Wahrnehmung oder Konstruktion einer Entscheidungssituation beeinflusst (Framing). Je nachdem, welchen theoretischen Denkstil jemand hat, sieht er andere Aspekte, Alternativen, Möglichkeiten, Grenzen, Chancen oder Risiken. In dem Ausmaß, in dem wissenschaftliches Wissen das Verständnis von Entscheidungssituationen in der Praxis modifiziert, besitzt es eine praktische Relevanz. Das Ziel der Theorie besteht hier darin, dem Entscheidungsträger zu einem tieferen Verständnis der praktischen Situationen zu verhelfen. Die Anwendungsorientierung beruht in diesem Fall auf der geisteswissenschaftlichen Methode des Verstehens. Bei der anschließenden Phase der Alternativenauswahl ist praktische Relevanz dann gegeben, wenn das theoretische Wissen die Auswahl einer Alternative innerhalb der definierten Entscheidungssituation beeinflusst. Die Theorie bildet hier die Grundlage für die Entwicklung instrumentellen Wissens, das Aufschluss darüber gibt, mit welchen Mitteln welche Zwecke erreicht werden können. Eine solche Anwendungsorientierung basiert auf der naturwissenschaftlichen Methode des Erklärens. Die theoretische Erklärung ermöglicht die theoretische Prognose, die Aufschluss darüber gibt, welche Entscheidungen zu treffen sind, um die intendierten Ereignisse praktisch herbeizuführen.
1.1.3 Wie kommt man von der Theorie zur Praxis?
Damit verbleibt die Frage, wie man von der Theorie zur Praxis kommt bzw. auf welche Weise theoretische Erkenntnisse praktisch relevant werden (können). Diese Frage gilt es, getrennt für das Verstehen und das Erklären bzw. für die damit verbundenen Phasen des Entscheidungsprozesses zu beantworten. Die Besonderheit des Verstehens liegt darin, dass es sich um einen subjektiven Prozess handelt,...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort
- Inhalt
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Grundlagen des Managements
- 2 Strategisches Management in Theorie und Praxis: ein Überblick
- 3 Theoretische Strömungen des strategischen Managements
- 4 Verhaltensbezogene Einflüsse strategischer Entscheidungen
- 5 Normatives Management als Ausgangspunkt strategischer Entscheidungen
- 6 Informationsgrundlage strategischer Entscheidungen
- 7 Strategieentscheidungen
- 8 Implementierung der Strategieentscheidungen
- 9 Reflexion strategischer Entscheidungen
- 10 Abschließendes
- Literatur
- Stichwortverzeichnis