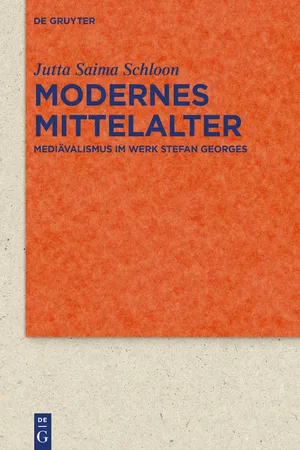1.1 Gegenstand und Fragestellung
Finsteres Zeitalter, romantischer Sehnsuchtsort, überzeitliche Utopie – das Mittelalter hat in der Moderne zahlreiche divergierende Zuschreibungen, Projektionen und Inanspruchnahmen erfahren. In Deutschland waren Mittelalterimaginationen insbesondere von der Romantik bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hoch relevant, indem sich das nationale Selbstverständnis auf Ursprungserzählungen vom Mittelalter gründete.1 Inmitten dieser Zeit, in diesem Klima der nationalen Überhöhung des Mittelalters entstand mit dem Werk Stefan Georges (1868 – 1933) eine der großen Dichtungen der Moderne und zugleich eine der faszinierendsten ästhetischen Verarbeitungen mittelalterlicher Thematik.
In die Literaturgeschichte ist George als deutscher Vertreter des Symbolismus und als charismatisches Zentrum eines elitären Männerbundes eingegangen. Seine Zeitgenossen, vor allem die jüngeren, nahmen hingegen Seiten an ihm wahr, die heute eher in Vergessenheit geraten sind: Walter Benjamin etwa schätzte George als den „Spielmann“, dessen Gedichte der Jugend zu Beginn des 20. Jahrhundert „Trostgesang“ gewesen seien.2 Und Klaus Mann erinnert sich in seiner Autobiographie: „Meine Jugend verehrte in Stefan George den Templer, dessen Sendung und Tat er im Gedicht beschreibt. Da die schwarze Woge des Nihilismus unsere Kultur zu verschlingen droht, […] tritt er auf den Plan – der militante Seher und inspirierte Ritter.“3 Die Stimmen dieser beiden prominenten Intellektuellen illustrieren exemplarisch den Einfluss und die Wirkung, die George zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf weite Kreise der bildungsbürgerlichen Jugend ausgeübt hat.4 Dabei ist es bemerkenswert, dass sowohl Benjamin als auch Mann den Dichter George mit mittelalterlichen Rollenvorbildern assoziierten. Sie griffen damit mediävalisierende Stilisierungen auf, die in Georges Dichtung selbst angelegt waren. Spielmann und Ritter markieren dabei zugleich zwei Extrempole, zwischen denen sich Mittelalterbezüge und -imaginationen in Georges Dichtung verorten lassen: das Spielerische und das Militante, das Ästhetische und das Kulturkritische, das Liedhafte und das Prophetische. Darüber hinaus ist die Betrachtung des ‚Mediävalismus‘ geeignet, das vorherrschende Bild Georges als eines ernsthaft-gravitätischen, weitgehend ironiefreien Großmeisters zu differenzieren: Der ‚Spielmann‘ George verfügt über ein erstaunlich breites Spektrum an rhetorischen Wirkungsmitteln, das Komik und Ironie, Formexperiment und Sprachreflexion, autobiographische Anspielung und intertextuelle Referenzen zu sehr unterschiedlichen literarischen Traditionen unbedingt mit einschließt.
Vorliegende Studie untersucht erstmals systematisch und umfassend Formen und Funktionen des ‚Mediävalismus‘ in Georges Werk. Dabei geht sie folgenden Forschungsfragen nach: Welche Spielarten und Phasen des ‚Mediävalismus‘ lassen sich unterscheiden und welche literarischen Verfahrensweisen und ästhetischen Aktualisierungen verbinden sich mit ihnen? Inwiefern nutzte George das Mittelalter als Imaginations- und Projektionsraum? Welche verschiedenen Funktionen übernimmt der ‚Mediävalismus‘ in Georges Werken? Damit verspricht sich diese Arbeit Erkenntnisse zu Georges Umgang mit nationalen Geschichtskulturen und literarischen Traditionen sowie und insbesondere Einsichten in seine poetischen Strategien der ‚Mediävalisierung‘. Die Analyse konzentriert sich daher nicht auf Mittelalterrezeption im klassischen literaturwissenschaftlichen Verständnis, sondern auf Konzeptionen und Imaginationen von ‚Mittelalter‘. Der Terminus ‚Mediävalismus‘ dient dabei als heuristischer Oberbegriff und operationale Kategorie. Im Folgenden soll zunächst das Forschungsfeld umrissen werden, in dem sich vorliegende Studie positioniert (1.2). Daran anschließend werden theoretische (1.3) und methodologische (1.4) Grundlagen der Arbeit erörtert, abschließend wird eine kurze Übersicht über den Verlauf der Studie gegeben (1.5).
1.2 Zum Stand der Forschung
Mit dem Erscheinen des dreibändigen Handbuchs zu Stefan George und seinem Kreis (2012) und des neuen Werkkommentars zu Stefan Georges Dichtung (2017) hat die George-Forschung gegenwärtig einen neuen Höhepunkt erreicht.5 In diesen Publikationen spiegeln sich zwei Forschungstrends der vergangenen zwei Jahrzehnte wider: zum einen die interdisziplinäre Annäherung an Phänomene des George-Kreises, die mit sozial-, mentalitäts- und ideengeschichtlichen Perspektiven beleuchtet wurden;6 zum anderen die Rückbesinnung auf genuin literaturwissenschaftliche Fragestellungen, die im Zuge der Interessenverlagerung auf den Kreis in den Hintergrund geraten waren. Diese Tendenzen betreffen auch die Forschung zu Stefan Georges Mittelalterbildern.
Im Rahmen einer kulturwissenschaftlichen Orientierung haben sowohl Literaturwissenschaftler als auch Historiker die Geschichtsbildproduktion des George-Kreises und dessen Verhältnis zur Wissenschaft in den Blick genommen. Der Sammelband Geschichtsbilder im George-Kreis (2004) macht unter anderem die Beiträge einer interdisziplinären Tagung zu Mittelalterbildern im George-Kreis zugänglich.7 Die meist personenbezogenen Aufsätze vermitteln einen ersten Überblick über die Bandbreite der Mittelalterevokationen im George-Kreis, mit Beiträgen etwa zur gotisierenden Buchkunst Melchior Lechters und zu den Arbeiten des dem George-Kreis nahestehenden Mediävisten Wolfram von den Steinen.8 Vor allem aber sind hier die wegweisenden Studien des Historikers Otto Gerhard Oexle zu nennen,9 in dessen Projekt einer ‚Gedächtnisgeschichte des Mittelalters in der Moderne‘ auch der George-Kreis einen prominenten Platz einnimmt, zumeist mit Schwerpunkt auf Ernst Kantorowicz' Biographie Kaiser Friedrich der Zweite (1927) und den durch dieses Buch ausgelösten Historikerstreit. Oexle und die Vertreter der wesentlich von ihm initiierten geschichtswissenschaftlichen Historismus-Forschung nehmen Ernst Troeltschs Diagnose einer ‚Krise des Historismus‘ als Ausgangspunkt und betrachten die Werke des George-Kreises als Zeugnisse dieser Krise sowie als Versuche, sie zu überwinden.10 Diese Studien haben das Verdienst, die großen geistesgeschichtlichen Linien von ‚Mediävalismus‘ und ‚Renaissancismus‘ in der Moderne aufzuzeigen. Literarische Texte werden dabei tendenziell wie historische Quellen gelesen: Inhaltliche oder ideologische Aussagen stehen im Vordergrund des Interesses, sprachlich-ästhetische Phänomene werden vor allem als Ausdruck oder Funktion historischer Zusammenhänge betrachtet.
An Oexles Arbeiten anknüpfend hat Bastian Schlüter aus germanistischer Perspektive Imaginationen vom Mittelalter zwischen den Weltkriegen in literarischen Texten untersucht.11 In dieser breit angelegten ideengeschichtlichen Studie verhandelt Schlüter auch die Mittelalterbilder des George-Kreises.12 Schlüter nimmt schwerpunktmäßig Ernst Kantorowicz' Biographie Kaiser Friedrich der Zweite in den Blick. Einleitend zieht er Beispiele von Mittelalterimaginationen in Georges Dichtung und aus Schriften weiterer Kreismitglieder heran, um aufzuzeigen, wie stark Kantorowicz' Werk in der Ideenwelt des George-Kreises verwurzelt ist. Seine Darstellung folgt dem Leitgedanken einer Ästhetisierung der Geschichte, Georges Sagen und Sänge versieht er mit Dirk Niefangers Begriff des „produktiven Historismus“ und hebt in Georges späterer Dichtung pauschal das kunstreligiöse Moment und das Zeitkonzept des kairos, des erfüllten Augenblicks hervor.13
Mit Bezug auf Stefan Georges Werk gilt jedoch weiterhin Ute Oelmanns Befund aus dem Jahre 2004, die eine „weitgehende Abstinenz“ von Forschungen zum ‚Mittelalter in der Dichtung Stefan Georges‘ konstatiert.14 Im Gegensatz zur Antike-Rezeption, die das Epochenrepertoire des Kreises zu dominieren scheint, ist Georges Verhältnis zur mittelalterlichen Tradition bislang nur partiell erforscht.15 Die meisten Beiträge beschränken sich nach wie vor auf Georges Buch der Sagen und Sänge (1895) und darin insbesondere auf den ersten Zyklus Sagen, der explizit auf mittelalterliche Themen und Motive rekurriert. Mittelalterbezüge in Georges Werk nach den Sagen und Sängen blieben bislang vernachlässigt, so dass bis dato keine systematische, umfassende Studie zu Mittelalterimaginationen in Georges Werk vorliegt.
Nach zwei rein affirmativen, ideologisch belasteten Studien aus den 1930er Jahren,16 die heute allenfalls als wissenschaftshistorische Zeugnisse für die kritiklos verehrende Haltung der ersten Generation von George-Forschern dienen können,17 gerieten Georges Mittelalterbilder erst in den 1980er Jahren im Zuge einer Konjunktur germanistischer Mittelalter-Rezeptionsforschung wieder in den Blick.18 Immer noch grundlegend ist Joachim Storcks Aufsatz Das Bild des Mittelalters in Stefan Georges „Buch der Sagen und Sänge“, in dem Storck vor allem auf die symbolistische Poetik der Gedichte abzielt und deren Distanz zu Mittelalterbildern in den zeitgenössischen, sogenannten Professorenromanen betont.19 Die Veröffentlichung einer Sammelschrift Georges zu den Sagen und Sängen als Faksimile 1996 begleitete Hubert Arbogast mit einem Nachwort, das vor allem die biographischen Entstehungsumstände erläutert und die Sagen und Sänge im Sinne einer Maskierungsstrategie deutet.20 Eine erweiterte Perspektive legte Bernhard Böschenstein in seinem einschlägigen Aufsatz aus dem Jahre 1998 an, indem er die Mittelaltermotivik in Georges Werk vom Buch der Sagen und Sänge bis zum Siebenten Ring (1907) nachzeichnet.21 Kursorisch skizziert er drei mögliche Phasen, die er jeweils einem Gedichtband zuordnet: Die frühen Mittelalterbezüge im Buch der Sagen und Sänge charakterisiert er als „Mischung aus Konventionalität und selbstgewählter Konstellation“ und unterscheidet davon die Funktionalisierung des Mittelalters „als negative Entsprechung zu einer enthistorisierten Antike“ im Teppich des Lebens sowie „als Bestätigung einer rückwärtsgewandten historistischen Prophetie“ im Siebenten Ring.22 Diesem (allerdings oftmals eher intuitiv vorgehenden) Aufsatz verdankt vorliegende Studie entscheidende Anregungen.23
Stärker an Quellen- und Rezeptionsfragen interessiert sind die Beiträge von Stefan Schultz und Ute Oelmann. Schultz interpretiert im Unterkapitel Überlieferung und Ursprünglichkeit seiner Studien zur Dichtung Stefan Georges (1967) ausgewählte Gedichte aus dem Buch der Sagen und Sänge und stellt Bezüge zu möglichen Vorlagen her.24 Auf die Bestände des Stuttgarter Stefan-George-Archivs gestützt, liefert Oelmann in ihrem Aufsatz Das Mittelalter in der Dichtung Georges (2004) eine Übersicht über die primären und sekundären Quellen, aus denen George Anregungen für das Buch der Sagen und Sänge geschöpft haben könnte, und begründet Georges Hinwendung zum Mittelalter lebens- und werkgeschichtlich mit der „Krise des Jahres 1892/93“.25 Diese rezeptionsgeschichtlich ausgerichteten Arbeiten stellen eine wertvolle Grundlage für weiterführende Studien zu Georges Mittelalteraneignung zur Verfügung und liefern ein f...