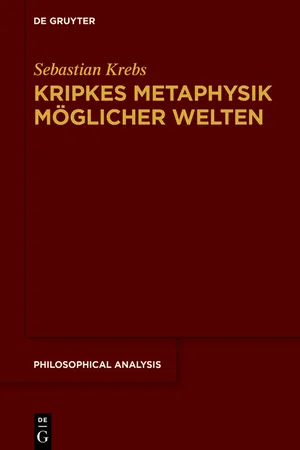1.1Ziele dieses Buches
Dieses Buch entwickelt und verteidigt den modalmetaphysischen Deflationismus. Darunter ist eine Position zu verstehen, die der amerikanische Sprachphilosoph und Logiker Saul Kripke hinsichtlich der Frage nach dem ontologischen Status von Möglichkeit und Notwendigkeit andeutet, aber nicht in systematischer Form entwickelt. Der historische Hintergrund dieser Position ist die seit den 1970er Jahren geführte und bis in die Gegenwart reichende Debatte in der analytischen Philosophie um das im Zusammenhang mit der Entwicklung der formalen Modallogik geprägte Konzept der möglichen Welten, zu dessen Klärung dieses Buch einen Beitrag leistet.
Im nachträglich eingefügten Vorwort seiner in Buchform veröffentlichten und inzwischen als Klassiker der analytischen Philosophie geltenden Vorlesungsreihe Naming and Necessity schreibt Kripke:
I will say something briefly about ‚possible worlds‘. (I hope to elaborate elsewhere.) (Kripke 1980, S. 15)
Kripke hat bis heute keine systematische Ausarbeitung seines Konzepts der möglichen Welten vorgelegt. Außerdem ist nicht zu erwarten, dass er in den nächsten Jahren und Jahrzehnten elsewhere eine solche Ausarbeitung vornimmt, geschweige denn veröffentlicht. Dies hat verschiedene Gründe, die unmittelbar mit seiner ganz eigenen philosophischen Arbeitsweise zusammenhängen, welche sicher die größte Herausforderung einer Systematisierung von Kripkes Philosophie darstellt, wie sie dieses Buch anstrebt und worauf deshalb in Abschnitt 1.2 ausführlich eingegangen wird.
Vorab ist es wichtig zu betonen, dass dieses Buch ein systematisches und kein exegetisches Ziel verfolgt. Dies bedeutet, dass Kripkes Werk hier vor allem als Vorlage dafür dient, eine Position zu entwickeln und zu verteidigen, die in der in der gegenwärtigen analytischen Philosophie geführten Debatte um den ontologischen Status von Möglichkeit und Notwendigkeit eine neue Richtung vorschlägt. Streng genommen präsentiert dieses Buch daher nicht – wie sein Titel es verspricht – Kripkes Metaphysik möglicher Welten, sondern meine eigene Metaphysik möglicher Welten, wobei dies auf den Titel zu schreiben nicht nur viel zu anmaßend gewesen wäre, sondern auch insofern falsch, als ich mir nicht einmal sicher bin, ob meine deflationäre Position überhaupt als Metaphysik bezeichnet werden kann.
Kripkes Metaphysik möglicher Welten finde ich als Titel für dieses Buch dennoch passend, da es von Saul Kripke, der philosophischen Disziplin der Metaphysik und von möglichen Welten handelt. Außerdem würde ich gerne dafür argumentieren, dass auch wissenschaftliche Buchtitel Eigennamen und daher rigid designators sind. Wem dieses sprachphilosophische Konzept bisher noch unbekannt ist, sei an dieser Stelle nur so viel verraten, dass es nicht nur in Kripkes Metaphysik möglicher Welten, sondern auch in Kripkes Metaphysik möglicher Welten einen zentralen Platz einnimmt und ich somit manchen erst durch den Titel erweckten Erwartungen an mein Forschungsziel am Ende doch gerecht werde.
Da bis dato keine deutschsprachige1und kaum englischsprachige monographische Literatur vorliegt, die die Hintergründe der Debatte in einen historischen Zusammenhang stellt und einen systematischen Überblick darüber gibt, worin sich einzelne Positionen im Bereich der modalen Metaphysik überhaupt unterscheiden, beziehungsweise – salopp gesagt – worüber eigentlich genau debattiert wird, ist es ein weiteres wichtiges Forschungsziel, in diesen Fragen Klarheit zu schaffen.
Um diese Klarheit zu erreichen, werden in Kap. 2 zunächst einige wichtige formal-logische und begriffliche Grundlagen gelegt, die für ein Verständnis des zentralen Konzepts der möglichen Welt unabdingbar sind. Darauf aufbauend entwickle ich in Kap. 3.1 eine systematische Landkarte, anhand derer ich die wesentlichen Aspekte der gegenwärtigen Debatte aufzeichne und alle wichtigen modalmetaphysischen Positionen einordne. Dies betrifft insbesondere den von David Lewis in On the Plurality of Worlds (1986) und anderen Werken entwickelten modalen Realismus, der für viele Autoren den wichtigsten historischen Bezugspunkt bietet und für Kripke– und damit auch für den hier vertretenen modalmetaphysischen Deflationismus – die wirkmächtigste Gegenposition darstellt.
In meiner Auseinandersetzung und Zurückweisung von Lewis’ modalem Realismus entwickle ich unter Berufung auf den gesunden Menschenverstand einen Maßstab, an dem sich jede überzeugende modalmetaphysische Position messen lassen muss (vgl. Kap. 3.2 bis 3.4). Während ich diesen Maßstab in Kapitel 3.5 auf einige andere einflussreiche Positionen der jüngeren Debatte anwende, ist es im vierten Kapitel mein Ziel, aufzuzeigen, warum gerade der modalmetaphysische Deflationismus die mit dem Maßstab einhergehenden Ansprüche des gesunden Menschenverstands erfüllt und damit eine überzeugende Position in der Debatte um den ontologischen Status von möglichen Welten darstellt (vgl. Kap. 4.5). Bevor dies geschieht, lege ich zunächst dar, was unter dem modalmetaphysischen Deflationismus genau zu verstehen ist und wie sich dieser auf der modalmetaphysischen Landkarte verorten lässt (vgl. Kap. 4.2 bis 4.4).
Es wird schließlich deutlich, warum sich die ausgiebige Beschäftigung mit den Anmerkungen und Andeutungen Saul Kripkes zu Möglichkeit und Notwendigkeit lohnt. Die auf seiner Philosophie basierende und im Laufe dieses Buches zu entwickelnde Position zum ontologischen Status von möglichen Welten entlarvt nämlich einige Scheinprobleme der gegenwärtigen analytischen Metaphysik, und stellt alleine daher einen gewichtigen Beitrag zur gegenwärtigen Debatte dar. Warum der von mir als modalmetaphysische Deflationismus bezeichnete Ansatz jedoch nicht genau dem entspricht, was Kripke selbst zum Thema beiträgt, hängt vor allem damit zusammen, dass Kripke Theorien und Systematisierungen grundsätzlich ablehnend gegenübersteht. Umdies zu verstehen, ist es wichtig, im Folgenden seine Arbeitsweise genauer zu betrachten.
1.2Kripke als „Sokrates unserer Zeit“
Saul Kripke gehört zu den bedeutendsten Philosophen der Gegenwart. Mit seinen Arbeiten zur Sprachphilosophie, Erkenntnistheorie, Metaphysik und Logik hat er nicht nur zahlreiche Debatten geprägt, sondern philosophische Teildisziplinen geradezu revolutioniert, wofür ihm 2001 der Schock-Preis (der sogenannte Nobelpreis der Philosophie) verliehen wurde. Uwe Voigt bezeichnet Kripke in seinem Nachwort zur deutschen Ausgabe der Philosophical Troubles treffend als „Sokrates unserer Zeit“ (Voigt 2017, S. 337), um seine eigenwillige philosophische Methodik und seinen besonderen Status innerhalb der gegenwärtigen Philosophie zu unterstreichen:
Wie jener [= Sokrates, S. Krebs], so tritt auch Kripke als ein Denker auf, der die einflussreichen Theorien seiner Epoche grundsätzlich erst einmal in Zweifel zieht. Gegen jene häufig eindrucksvoll ausgebauten, von angesehenen Kollegen vertretenen Theorien richten sich dabei häufig einfach anmutende Fragen, die ausgehend von vertrautem Sprachgebrauch, dabei durchaus aber auch mit Sachbezug, auf dem Hintergrund einer unerbittlichen Logik zu oft unerwarteten Problemen führen. Dies dient jeweils nicht dem Zweck, die solchermaßen in die Krise gestürzten Ansichten durch einen eigenen großartigen Entwurf zu ersetzen. Vielmehr geht es in erster Linie darum, akute Probleme (Aporien in der sokratischplatonischen Redeweise, troubles gemäß Kripke) als solche zu erkennen, anzuerkennen und wenn nötig als solche zunächst einmal bestehen zu lassen. (Voigt 2017, S. 337, Hervorh. im Orig.)
Eine weitere Gemeinsamkeit mit Sokrates besteht darin, dass Kripke sich vor allem mündlich äußert. Seine wichtigsten Werke (unter anderem Naming and Necessity und Reference and Existence) basieren auf frei gehaltenen Vorträgen, die in den letzten Jahrzehnten aufgezeichnet, transkribiert und – von nachträglich hinzugefügten Fußnoten und Anmerkungen abgesehen – größtenteils unverändert in Buchform publiziert worden sind. Diese Arbeits- und Publikationsweise dürfte in der gegenwärtigen Philosophie einmalig sein. Sie bringt für die Kripke-Forschung jedoch den großen Nachteil mit sich, dass ein Großteil seiner Arbeiten noch nicht veröffentlicht worden ist. Seit 2007 widmet sich das Saul-Kripke-Center an der City University of New York seinem Werk mit dem Ziel, möglichst viele noch unveröffentlichte Vorträge in den nächsten Jahren zu publizieren – wobei dies aufgrund der schieren Menge an teilweise nur auf Tonbandkassetten gespeicherten Vorträgen eine mühevolle Detailarbeit darstellt.
In meinem Forschungsjahr am Kripke-Center habe ich einige Vortragsmitschriften und Notizen sichten können, die sich mit Kripkes Konzept der möglichen Welten auseinandersetzen. Interessant für dieses Buch wäre vor allem die Seminarreihe „Modal Logic und Possible Worlds“, die Kripke gemeinsam mit David Lewis im akademischen Jahr 1979-80 an der Princeton University unterrichtet hat, die unter anderem Klarheit in Kripkes teilweise ungenaue Lewis-Rezeption (vgl. Kap. 3.5.3) bringen könnte. Jedoch ist diese bisher noch nicht transkribiert worden und bleibt daher auf absehbare Zeit unveröffentlicht.
Wenngleich ich in diesem Buch selbstverständlich nicht aus unveröffentlichtem Material zitiere, ist es nach einer intensiven Recherchearbeit am Kripke-Archiv durchaus nicht zu viel gesagt, dass sich das Bild dessen, was Kripke zu Möglichkeit und Notwendigkeit zu sagen hat, sich auch unter Einbezug des unveröffentlichten Materials nicht wesentlich verändern würde. Eine elaborierte Position zur modalen Metaphysik oder eine systematische Zusammenfassung der gegenwärtigen Debatte wird es von Kripke selbst – wie bereits in Kap. 1.1 gesagt – nicht geben. Dies hängt insbesondere mit zwei wesentlichen Aspekten seines in dem obigen Zitat von Uwe Voigt durchklingenden Philosophieverständnisses zusammen, die ich im Folgenden kurz erläutere, um gleichzeitig die Schwierigkeiten zu beschreiben, denen sich jede systematische Arbeit zu Kripke– und damit auch die hier vorliegende – gegenüber sieht.
Die erste Besonderheit besteht darin, dass Kripke grundsätzlich skeptisch gegenüber philosophischen Theorien eingestellt ist und es sich daher streng exegetisch verbieten würde, eine systematische Position aus seinen Anmerkungen zu Möglichkeit und Notwendigkeit zu entwickeln. Dies wird etwa deutlich, wenn er in Bezug auf die Clustertheorie sprachlicher Referenz (vgl. Kap. 2.5.1) schreibt:
It really is a nice theory. The only defect I think it has is probably commonto all philosophical theories. It’s wrong. You may suspect me of proposing another theory in its place; but I hope not, because I’m sure it’s wrong too if it is a theory. (Kripke 1980, S. 64)
Wenig später in Naming and Necessity greift er genau diese von ihm zuvor geäußerte Ablehnung philosophischer Theorien wie folgt auf:
I think I said the other time that philosophical theories are in danger of being false, and so I wasn’t going to present an alternative theory. Have I just done so?Well, in a way; but my characterization has been far less specific than a real set of necessary and sufficient conditions for reference would be. (Kripke 1980, S. 93)
Während diese beiden Aussagen zwar lediglich die sprachphilosophische Frage nach der Referenz von Eigennamen und Gattungsbegriffen betreffen (vgl. Kap. 2.5), zieht sich Kripkes hier zum Ausdruck gebrachte Theorieskepsis wie ein roter Faden durch sein gesamtes Werk. Fitch beschreibt Kripkes Philosophie entsprechend wie folgt:
Kripke cannot be said to be a system-building philosopher like Kant. His approach to philosophy seems to be to find a puzzle or problem to unravel and then follow the unravelled trail to wherever it leads. (Fitch 2004, S. xiii)
Diese Grundproblematik einer jeden Arbeit, die sich systematisch mit Kripke beschäftigt, umgehe ich dadurch, dass ich seinen unravelled trails so lange folge, bis ich an einer umfassenden modalmetaphysischen Position angelangt bin – wissend, dass Kripke selbst den Weg dorthin aufgrund seiner Theorieskepsis nicht mitgehen würde. Doch wie bereits in Kap. 1.1 deutlich gemacht, ist das Ziel dieses Buches ein systematisches und kein exegetisches, sodass ich mich nicht in Detailfragen der Kripke-Interpretation verlieren muss, sondern fokussiert seinem Konzept der möglichen Welten im Kontext der gegenwärtigen Debatte um deren ontologischen Status nachgehe und daraus einen eigenständigen Forschungsbeitrag entwickle.
Eine zweite Besonderheit in Kripkes Philosophie besteht darin, dass er zwar – wie Uwe Voigt darlegt – „die einflussreichen Theorien seiner Epoche [...] in Zweifel zieht“ (Voigt 2017, S. 337), seine Zuschreibungen einzelner Autoren zu diesen Theorien jedoch häufig historisch ungenau sind. Dies betrifft sowohl seine Rezeption von Frege und Russell im Zuge der sprachphilosophischen Debatte um Referenz als auch seine Rezeption von David Lewis’ modalem Realismus und David Kaplans Jules-Verne-o-skop .Unabhängig davon, dass Kripkes Kritik an einzelnen Positionen zumeist sehr klug formuliert ist, sollte man sich bewusst sein, dass es sich bei Kripkes Rekonstruktion einzelner Positionen häufig um Strohmannpositionen handelt, die von den genannten Autoren nur bedingt vertreten werden, worauf ich in den betreffenden Abschnitten jeweils im Einzelnen hinweise. Es ist jedoch müßig darüber zu spekulieren, ob diese historischen Ungenauigkeiten der spontanen Vortragssituation geschuldet sind oder als gezieltes argumentatives Manöver verstanden werden müssen.
Für den philosophischen Gehalt seiner eigenen Argumentation ist diese Frage ohnehin unerheblich, wenngleich sich eine Arbeit zu Kripkes Philosophie dieser Eigenart durchaus bewusst werden muss. Wieder kann hier jedoch nur betont werden, dass das Ziel dieses Buches systematisch und nicht historisch-exegetisch ist, sodass wie über Kripkes grundsätzliche Theorieskepsis im Folgenden auch über Kripkes historische Ungenauigkeiten hinweggesehen werden kann und ich diese in...