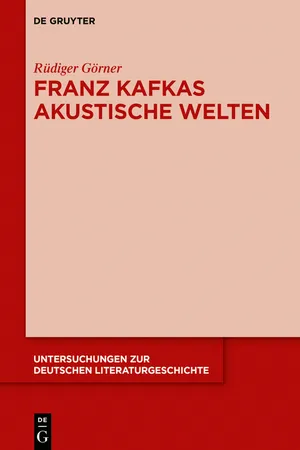Erzählte Geräusche und andere auditive Verwandlungen
So disparat die bisherigen Befunde zu Kafkas Verhältnis zum Akustischen auch sind, soweit sie sich auf die bislang aufgespürten Fundstellen beziehen, bloße Geräuschirritationen registrieren oder spezifische musikalische Eindrücke, zeugen sie von einem überaus empfindsamen Gehör. Mehr noch: Sie erweisen, dass für Kafka das Akustische in seiner ganzen Bandbreite ein existentielles Problem darstellte. Man greift keineswegs zu hoch, wenn man behauptet, das Akustische zeige sich in seinen Briefen und Tagebuchheften als resonante Existentialie. Selbst wenn Kafka in Tagebuchheften späteren Datums versuchte, durch die Verwendung der dritten Person Singular Abstand zu sich selbst zu gewinnen – wie etwa in Teilen des zwölften Heftes –, betont er diese existentielle Dimension im Verhältnis zum Musikalischen. Zentral bleibt dabei die schaffenspsychologische Seite:
Alles was er tut, kommt ihm zwar außerordentlich neu vor, aber auch entsprechend dieser unmöglichen Fülle des Neuen außerordentlich dilettantisch, kaum einmal erträglich, unfähig historisch zu werden, die Kette der Geschlechter sprengend, die bisher immer wenigstens zu ahnende Musik der Welt zum erstenmal bis in alle Tiefen hinunter abbrechend. (T, 848 f.; 13.1.1920)
‚Außerordentlich‘ an dieser Eintragung ist in erster Linie die Annahme einer „zu ahnende[n] Musik der Welt“ und die Vorstellung, dass diese „abbrechen[ ]“ könnte und zwar „in allen Tiefen“ und Verwurzelungen der Kultur. Peter Höfle hat gezeigt, dass sich daraus das Verfahren Kafkas ableiten lasse, durch das Erzählen das Überlieferte auszulöschen;103 eine Vorwegnahme dessen, was Thomas Bernhard durch seine Art des Umgangs mit Überlieferung noch überbieten sollte – von Alte Meister (1985) bis Auslöschung (1986).
Doch wäre noch einmal nachzufragen, was mit diesem ‚Abbrechen‘ der Musik gemeint ist; denn immerhin handelt es sich hier um den drastischsten Ausdruck, mit dem Kafka die Musik belegt hat. Landläufig gilt: Wenn die Musik abbricht, etwa auf dem Dominantseptakkord im klassischen Solokonzert, kann und soll sich daraufhin die Kadenz des Soloinstruments aufbauen. Das Abbrechen schlägt auf diese Weise ins Schöpferische um. Diese Vorstellung negiert Kafka, beziehungsweise er verbietet sie sich. Denn nach solchem ‚Abbrechen‘, wie die Tagebuchaufzeichnung es andeutet, wären eigentlich nur noch die „Lärmtrompeten des Nichts“ (T, 818; 4.8.1917) vorstellbar, um einen weiteren Ausdruck aus dem Tagebuch seinem Zusammenhang leicht zu entfremden. Denn Kafka meinte damit ursprünglich die Diktiergeräte, die Felice Bauer als Messerepräsentantin ihrer Firma anzupreisen hatte.
Wenn die Musik abbricht, dann nehmen wieder die Geräusche überhand, die sich unverhofft aufdrängen, einnisten, das Gehör infizieren. Wenn die Musik abbricht, dann sieht sich die Welt um jede Hoffnung auf Harmonie gebracht. Sie fällt gewissermaßen aus den Sphären heraus.
Die dabei immer wiederkehrenden Grundfragen lauten: Was hörte Kafka? Wie hörte er? Und worin bestand seine transformatorische Leistung, das Gehörte in Erzählung zu verwandeln? Darf man so weit gehen, im Werk Kafkas bestimmte Episoden als regelrechte Hörbilder zu lesen und zu sehen? Versichern wir uns zunächst eines Vergleichstextes. Unter den reizvoll parabelhaften Episoden aus dem Nachlaß zu Lebzeiten (1936) von Robert Musil fällt ein betont akustischer Text auf, der auf analoge Weise zu erklären hilft, welche ästhetischen Probleme dabei in Rede stehen. Gemeint ist ‚Hellhörigkeit‘:
Ich habe mich vorzeitig zu Bett gelegt, ich fühle mich ein wenig erkältet, ja vielleicht habe ich Fieber. Ich sehe die Zimmerdecke an, oder vielleicht ist es der rötliche Vorhang über der Balkontür des Hotelzimmers, was ich sehe; es ist schwer zu unterscheiden.
Als ich gerade damit fertig war, hast auch du angefangen, dich auszukleiden. Ichwarte. Ich höre dich nur.
Unverständliches Auf- und Abgehn; in diesem Teil des Zimmers, in jenem. Du kommst, um etwas auf dein Bett zu legen; ich sehe nicht hin, aber was könnte es sein? Du öffnest inzwischen den Schrank, tust etwas hinein oder nimmst etwas heraus; ich höre ihn wieder schließen. Du legst harte, schwere Gegenstände auf den Tisch, andre auf die Marmorplatte der Kommode. Du bist unablässig in Bewegung. Dann erkenne ich die bekannten Geräusche des Öffnens der Haare und des Bürstens. Dann Wasserschwälle in das Waschbecken. Vorher schon das Abstreifen von Kleidern; jetzt wieder; es ist mir unverständlich, wieviel Kleider du ausziehst. Nun bist du aus den Schuhen geschlüpft. Danach gehen deine Strümpfe auf dem weichen Teppich ebenso unablässig hin und her wie vordem die Schuhe. Du schenkst Wasser in Gläser; drei-, vier- mal hintereinander, ich kann mir gar nicht zurechtlegen, wofür. Ich bin in meiner Vorstellung längst mit allem Vorstellbaren zu Ende, während du offenbar in der Wirklichkeit immer noch etwas Neues zu tun findest. Ich höre dich das Nachthemd anziehn. Aber damit ist noch lange nicht alles vorbei. Wieder gibt es hundert kleine Handlungen. Ich weiß, daß du dich meinethalben beeilst; offenbar ist das alles also notwendig, gehört zu deinem engsten Ich, und wie das stumme Gebaren der Tiere vom Morgen bis zum Abend, ragst du breit, mit unzähligen Griffen, vondenen du nichts weißt, in etwas hinein, wo du nie einen Hauch von mir gehört hast!
Zufällig fühle ich es, weil ich Fieber habe und auf dich warte.104
Zunächst fällt das Wechselspiel von Optischem und Akustischem auf, von wirklich Gehörtem und Vorgestelltem. Der fiebrige Zustand – ein dem Motivarsenal der sogenannten Décadence entnommenes Phänomen – verfeinert die Sinne, hier zunächst den Sehsinn, wobei dessen Differenzierungsvermögen leidet. Erst als das Hören zum dominanten Sinn wird, ausgelöst durch das unscharfe Sehen und das Warten auf den Anderen, gewinnt das Ich seine Unterscheidungsfähigkeit zurück. Die bedeutsame Konstellation in diesem Narrativ stellt sich so dar: Was das Ich nicht sieht, gewinnt akustisch an Kontur. Die Geräusche aus dem Badezimmer werden zum feinsinnigen Vorspiel für irgendetwas – irgendetwas, was auch immer das Warten ablösen wird. Das Hören und die mit ihm verbundene Vorstellung dessen, was das Ich hört, wirken einerseits komplementär, andererseits stehen sie miteinander in Wettbewerb. Die gespannte Erwartung macht hier hellhörig. Die zarten, von der geliebten Frau ausgehenden Geräusche finden umgekehrt keine Entsprechung. Sie hört ihn nicht, da sie weder Fieber hat noch wartet. Das ‚hellhörige‘ Ich hat sein Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögen ganz auf das Auditive verlagert; und das gilt gleichfalls für sein Empfindungsvermögen: Es fühlt, was es hört.
Einer der 1917/18 entstandenen Zürauer Aphorismen Kafkas, der einhundertneunte und letzte, lässt sich in Entsprechung zur ‚Hellhörigkeit‘ Musils lesen, auch wenn dieser Aphorismus eine andere inhaltliche Valenz gewinnt:
Es ist nicht notwendig, daß Du aus dem Haus gehst. Bleib bei Deinem Tisch und horche. Horche nicht einmal, warte nur. Warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbieten wird sich Dir die Welt zur Entlarvung, sie kann nicht anders, verzückt wird sie sich vor Dir winden.105
Auch Kafkas Aphorismus geht von einem Innenraum aus, fordert hellhöriges Horchen, also die intensivste Form des Hörens; nimmt dann sogleich diese Forderung zurück und verlagert sie auf das vom Auditiven entlastete ‚Warten‘. Das geschieht in der Gewissheit, dass die Welt auf den in völliger Stille Wartenden zukommen und sich ihm anbieten, wenn nicht gar anbiedern wird. Die sich vor dem Wartenden ‚verzückt‘ windende Welt harrt hier der Entzauberung. Sie wiederum setzt voraus, dass er nicht selbst ins ‚Winden‘ gerät und die Lügen der Welt ruhig durchschaut.106
Mit diesem zum Warten werdenden Horchen bringt sich Kafka in eine, wenn man so will, antizipatorische Nähe zur Konzeption des deep listening, mit dem sich Explorationen des Akustischen seit Ende der 1980er Jahre beschäftigen. Für ihre kompositorische Umsetzung stehen etwa Pauline Oliveros, Valerie Solanas und Terry Riley mit Stücken wie Sound Meditation, Bye Bye Butterfly oder In the Sea, nebst Geräuschprotokollen etwa aus den Bunkern unter Washington oder dem Polargebiet, wo das Krachen des Eises zum Beispiel für das In-die-Umwelt-Horchen und das Auf-die-Umwelt-Hören wird. Oliveros geht es dabei um etwas, das bereits für Kafkas Art des Hörens konstitutiv gewesen ist, nämlich die Partikel der Geräusche oder Klänge, die sogenannten phonoi. Hinzu kommt, was im Zusammenhang von deep listening die „sonic imagination“ genannt wird sowie „sonic dreams“ als Aspekte des „inner listening“.107
Die Intensität, die bei Kafka das bloße Hören zum Horchen steigerte und damit seine Art des deep listening kennzeichnet, findet im Befund seines zur Illusionszerstörung tendierenden Erzählens ihre negative Entsprechung. Hinzu kommt bei Kafka die bewusste Reduktion der Stimmen auf die eine Stimme, der Geräusche auf das eine dominante Geräusch. Dieses Verfahren Kafkas ist zu unterscheiden etwa von der Stimmenwelt in den Romanen einer Virginia Woolf, die auch das Ergebnis ihrer sie psychisch schwer belastenden Pein des Stimmenhörens gewesen ist, oder dem produktiven Arbeiten mit Stimmen in den voice installations der Kanadierin Janet Cardiff.108
Wenden wir uns nun der entscheidenden Frage zu, wie Kafka mit den von ihm wahrgenommenen akustischen Phänomenen erzählerisch umgegangen ist, und ob sich tatsächlich so etwas wie ein dissonantes Erzählen bei ihm nachweisen lässt. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass jeder Text eine ihm eigene sprachliche Resonanzfläche darstellt. Damit sie zum Raum werden kann, bedarf es der Perspektivierung vor allem durch den Leser. Denn das an den Text herangetragene eigene Klangverständnis führt entweder zu einer harmonischen Einstimmung oder zu Dissonanzen, was sich beides unmittelbar auf das Verstehen des Textes auswirkt. Spüren wir also zunächst die auditiven Momente und Motive in einigen Erzählungen Kafkas auf und gehen ihrer ästhetischen Wirkung im Einzelnen nach.
Geräusche in Betrachtung
Bereits die 1912 in Kafkas erste Buchpublikation Betrachtung aufgenommenen Prosastücke weisen in ihrer Mehrzahl auditive beziehungsweise sonorische Elemente auf. Wie die im Jahr darauf erscheinende, Felice Bauer gewidmete Erzählung Das Urteil setzt auch die Sammlung Betrachtung mit einem solchen Element ein: „Ich hörte die Wagen an dem Gartengitter vorüberfahren, manchmal sah ich sie auch durch die schwach bewegten Lücken im Laub.“ (E, 8; Hervorh. d. Verf.) Das Erzählen beginnt also mit dem Hören und Sehen, und es scheint, als erzählte Kafka – gerade in seiner ersten Schaffensphase – auch sich selbst, damit ihm beides deswegen nicht leicht vergehen konnte, sondern zunehmend verstärkt erhalten blieb. Schon im nächsten Abschnitt des Eröffnungstextes Kinder auf der Landstraße spielt Kafka mit einer Bedeutungswendung im Hören: „Vor dem Gitter hörte es nicht auf.“ (Ebd.) Was da nicht aufhört, ist weiterhin hörbar: „Kinder im Laufschritt“, „Getreidewagen“ und grüßende Mädchen. Nur charakterisiert der Erzähler diese Hörbarkeiten nicht im Einzelnen. Das Spielen mit auditiven Motiven, das Kafka bereits in dieser Erzählung betreibt, sollte auch für seinen späteren Umgang damit konstitutiv bleiben. So formt er etwa die Redewendung ‚sich aufs Ohr legen‘ subtil um: „Wenn man sich auf die rechte Seite drehte, die Hand unters Ohr gab, da wollte man gerne einschlafen.“ (E, 9) Doch eben das geschieht nicht. Denn in die Gruppe der Kinder gerät Bewegung, von außen verursacht durch einen in der Ferne vorbeifahrenden Zug. Mit ihm und seinen (im Text nicht näher benannten) Geräuschen singen die Kinder nun um die Wette, „den fernen Reisenden in die Ohren“. (E, 11) Eines der Kinder stimmt einen Gassenhauer an, alle fallen ein, weil es sie zum Singen drängte als dem eigentlichen Höhepunkt dieses gemeinsam verbrachten Tages: „Wir sangen viel rascher als der Zug fuhr, wir schaukelten die Arme, weil die Stimme nicht genügte, wir kamen mit unseren Stimmen in ein Gedränge, in dem uns wohl war.“ Darauf folgt eine für Kafka schon damals und später bedeutsame, wenngleich überraschende Einsicht: „Wenn man seine Stimme unter andere mischt, ist man wie mit einem Angelhaken gefangen.“ (Ebd.)
Was ist mit dieser paradoxen Feststellung gesagt? Dass man andere Stimmen, einen Chor etwa, meiden soll? Dass die eigene Stimme unweigerlich aus dem Pool der Stimmen doch wieder geangelt wird? Indes suggeriert das Bild vom Angelhaken, dass sich der Vergleich im Bereich des Fischhaften und damit in der Sphäre des Stummen bewegt. Die Stimme, unter andere Stimmen gemischt, kann nur verstummen und bleibt dennoch oder gerade deswegen ‚gefangen‘.
Immer fällt bei Kafka die Segmentierung der akustischen Elemente auf, die zuvor besagten Klangpartikel, aber auch die genau bezeichneten materiellen Teile, die akustisch wirksam werden. So etwa im zweiten Prosastück der Sammlung Betrachtung mit dem Titel Entlarvung eines Bauernfängers, als der Ich-Erzähler von einer ihm nur flüchtig bekannten Person etwas gefragt wird. Die Frage „Gehen Sie gleich hinauf?“ – zu einem Empfang in „herrschaftlichem Hause“ – sieht sich in ihrer Bedeutung sogleich abgeschwächt durch die materiell bedingte Beeinträchtigung ihrer Artikulation: „In seinem Munde hörte ich ein Geräusch wie vom Aneinanderschlagen der Zähne.“ (E, 12) Das durch Frage und Begleitgeräusch irritierte Ich sieht dann sogar „an den Ohren meines Gegenüber“ (ebd.) vorbei. Auf besonders subtile Weise verbinden sich im folgenden Abschnitt Schweigen und Geräusche. Das Ich vermag sich von diesem Fremden nicht zu lösen; vielmehr fühlt es sich mehr und mehr eingebunden in sein Schweigen, das es zunächst lähmt, aber auch hellhörig macht:
Dabei nahmen an diesem Schweigen gleich die Häuser rings herum ihren Anteil, und das Dunkel über ihnen bis zu den Sternen. Und die Schritte unsichtbarer Spaziergänger, deren Wege zu erraten man nicht Lust hatte, der Wind, der immer wieder an die gegenüberliegende Straßenseite drückte, ein Grammophon, das gegen die geschlossenen Fenster irgendeines Zimmers sang, – sie ließen aus diesem Schweigen sich hören, als sei es ihr Eigentum seit jeher und für immer. (E, 12)
Diese Kafka eigentümliche Vorstellung – sie ist in der zeitgenössischen Literatur, soweit bekannt, ohne Beispiel – von einer völlig divergenten Geräuschpalette (von Schritten bis zum Windgeräusch und dem Singen eines Grammophons), die das Schweigen instrumentalisiert und auf ihre Bedürfnisse hin ausrichtet, als Kontrasthintergrund gewissermaßen, diese Vorstellung überrascht deswegen, weil sie sich bei Kafka so früh und so ausgeprägt findet. Die Personalisierung dieser Vorstellung kann skurrile Formen annehmen, etwa wenn im Prosastück Der Ausflug ins Gebirge das Ich „ohne Klang“ in der Stimme laute Zweifel an seinem Vorhaben anmeldet, eben einen solchen Ausflug ins Gebirge „mit einer Gesellschaft von lauter Niemand“ zu unternehmen. Es handelt sich um Niemands „in Frack“. Wiederum wird Wind hörbar, wie er durch bestimmte „Lücken“ fährt, wobei dieser ‚Ausflug‘ zu einer weiter gesteigerten Paradoxie führt: „Die Hälse werden im Gebirge frei! Es ist ein Wunder, daß wir nicht singen.“ (E, 16) Es wäre Niemandes Gesang, der da im Gebirge zu singen wäre und mithin unhörbar, Teil des großen Schweigens, das wieder dem Wind und eben Niemand gehört. Wahrscheinlich ist, dass das klanglos rufende Ich des Anfangs selbst zum Niemand werden muss angesichts der überwältigenden Präsenz von Niemands in diesem Text. Wenn es wirklich zum Gesang der Niemands, zu Niemandes Gesang also käme, dann bedeutete dies für das Ich eine eigentliche Befreiung. Doch verhält sich das nicht immer so, zumindest nicht für jedes Ich in diesen Texten. Der Nachhauseweg zum Beispiel kennt ein Ich, das glaubt, für alles verantwortlich zu sein, unter anderem auch für „alle Schläge gegen Türen, auf die Platten der Tische“. Ansonsten verfügt dieses Ich über keine nennenswerten Gedanken, die das Darübernachdenken lohnten. Dann der entscheidende Zusatz: „Es hilft mir nicht viel, daß ich das Fenster gänzlich öffne und daß in einem Garten die Musik noch spielt.“ (E, 19) Musik verfügt – gerade auch beim frühen Kafka – über kein Erlösungspotential mehr.
Im Laufe dieser Studie begegnete bereits Kafkas oder seiner Ich-Erzähler Faszination für das Ohr. In der Episode Der Fahrgast beobachtet das Ich in der Straßenbahn ein Mädchen. Seine Beschreibung gipfelt im Betrachten des Hörorgans: „Ihr kleines Ohr liegt eng an, doch sehe ich, da ich nahe stehe, den ganzen Rücken der rechten Ohrmuschel und den Schatten an der Wurzel.“ Die Konsequenz aus dieser Beobachtung ist eine absurde Frage: „Wieso kommt es, daß sie nicht über sich verwundert ist, daß sie den Mund geschloßen hält und nichts dergleichen sagt?“ (E, 21) Nicht eindeutig ist, worauf sich „nichts dergleichen sagt“ bezieht...