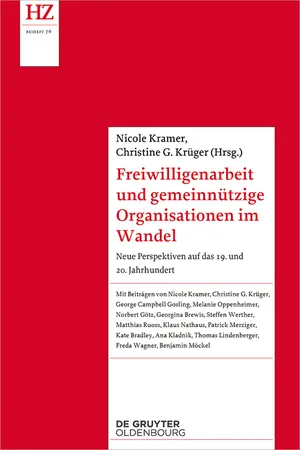
Freiwilligenarbeit und gemeinnützige Organisationen im Wandel
Neue Perspektiven auf das 19. und 20. Jahrhundert
- 336 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Freiwilligenarbeit und gemeinnützige Organisationen im Wandel
Neue Perspektiven auf das 19. und 20. Jahrhundert
Über dieses Buch
Freiwilliges Engagement ist in aller Munde, doch die in Politik und Medien gängigen Vorstellungen zu Funktion und Wirkungsweise freiwilliger Arbeit übersehen zumeist deren Wandelbarkeit, sodass die Geschichtsforschung ein wichtiges Korrektiv zu liefern hat.
Anders als die englischsprachige hat sich die deutschsprachige Historiographie zur Freiwilligenarbeit noch nicht als eigenes Feld etabliert und es fehlt bislang eine systematische Debatte. Um eine solche anzuregen, bringt das Beiheft aktuelle Studien zum Thema zusammen. Es schlägt dafür eine Brücke zwischen der angelsächsischen Voluntary Action History einerseits und den neueren Forschungen zur Freiwilligenarbeit und zum gemeinnützigen Sektor in Deutschland und anderen europäischen Ländern andererseits. Die Beiträge demonstrieren die fruchtbare Spannbreite unterschiedlicher Herangehensweisen an das Thema und diskutieren verschiedene konzeptionelle Ansätze. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Bedeutungswandel freiwilligen Engagements, seinem Verhältnis zu Staat und Markt sowie seiner transnationalen Dimension.
Der Band wirft damit neues Licht auf für das Verständnis freiwilligen Engagements zentrale Fragen. Dies ist nicht nur für die Geschichtswissenschaft von Interesse.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
IV. Voluntary action im transnationalen Raum
Von Mensch zu Mensch
I. Einleitung
II. Entstehung der Kindernothilfe in der Hilfslandschaft der deutschen Nachkriegszeit
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- Einleitung
- I. Konzepte und Thesen der Voluntary Action History
- II. Die Bedeutung der Freiwilligkeit im Wandel
- III. Die Veränderung von Staatlichkeit und der dritte Sektor
- IV. Voluntary action im transnationalen Raum