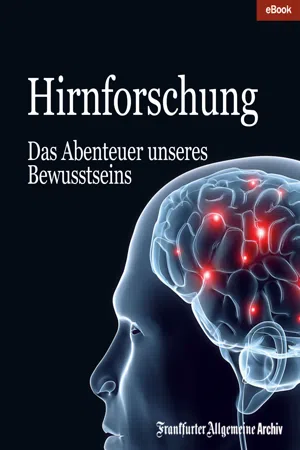
- 218 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Die Kapitel dieses eBooks beschäftigen sich zunächst mit den Grundlagen der Hirnforschung. Unter der Fragestellung, wer denn eigentlich der »Käpt'n im Kopf« ist, steht die Diskussion um die Freiheit des Willens im Fokus des ersten Kapitels. Wie weit lässt sich das Gehirn durch Schlüsselreize beeinflussen, und wie weit können wir nur mit der Kraft unserer Gedanken Maschinen manipulieren? Können wir das Hirn zu höherer Leistung dopen, oder wirkt Meditation besser? Sind Hirnschädigungen stets irreversibel, und welche Aussichten hat der Kampf gegen die Demenz?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Hirnforschung von Frankfurter Allgemeine Archiv im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Biowissenschaften & Kognitive Neurowissenschaften & Neuropsychologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Wer ist der Käpt’n im Kopf?
Bewusstsein: Das gelenkte Ich
Die Benjamin Libet-Experimente
Von Volker Stollorz
Als sich der Hirnforscher Benjamin Libet 1958 entschied, mit Elektroden im Gehirn wacher Patienten nach den neurobiologischen Grundlagen des Bewusstseins zu suchen, warnten ihn viele Kollegen: Seine Experimente würden ein absolut fruchtloses und fehlgeleitetes Unternehmen sein.
Sie irrten. Libet ist weltberühmt, erster Träger des „Nobelpreises“ für Psychologie, den die Universität Klagenfurt seit 2003 verleiht. Der Neurophysiologe erhielt ihn für Pionierleistungen zur experimentellen Erforschung des Bewusstseins sowie der Handlungsinitiierung und des freien Willens. Den Grundstein dazu legte Libet schon 1958, als er an der University of California in San Francisco Zugang zu Patienten erhielt, deren Schädel für eine Operation am offenen Gehirn aufgebohrt worden war.
Sofern die Patienten zustimmten, durfte Libet mit Erlaubnis des Neurochirurgen Bertram Feinstein mit winzigen Stromstößen die Hirnrinde reizen. Er wollte dort bewusste Empfindungen auslösen. Weil er der Introspektion seiner Versuchspersonen vertraute, kam Libet einer rätselhaften Eigenschaft des Bewusstseins auf die Spur. Stimulierte er das Gehirn dort, wo Empfindungen der Hand registriert werden, dauerte es eine halbe Sekunde, bevor der Reiz das Gefühl einer Handreizung auslöste (Experiment 2). Warum subjektiv keine Verzögerung erlebt wurde, versuchte er in weiteren Experimenten zu klären (Experiment 3). Die Ergebnisse legen nahe, meint Libet, dass das Gehirn Sinneswahrnehmungen künstlich zurückdatiert. Der Trick könnte erklären, warum der Sprung ins Wasser subjektiv als Erlebniseinheit empfunden wird. Mein Ich lebt nicht in der Gegenwart, ist nicht live auf Sendung, sondern erlebt quasi eine zensierte und zeitlich umdatierte Konstruktion eingehender Sinnesdaten. Allein diese provokante These beschäftigt die Hirnforschung bis heute, scheint sie doch dem Bewusstsein eine eher nachgeordnete Rolle im Erleben der Sinnenwelt zuzuordnen.
1978 starb Feinstein, Libet fehlte fortan der direkte Zugang zum Gehirn seiner Versuchspersonen. Auf einer Konferenz in Bellagio am Comer See kam ihm dann die berüchtigte Idee mit der Uhr, um den freien Willen experimentell studieren zu können (Experiment 1). Libet wollte ergründen, wie der bewusste Wille mit unseren Gehirnfunktionen verbunden ist. Als Testfall nahm er sich einfachste Willkürbewegungen vor, zum Beispiel das Krümmen einer Hand.
Vor der Bewegung hoffte er anhand schwacher Hirnströme im EEG messen zu können, wann der Wille sich im Gehirn manifestiert. Zwei deutsche Forscher hatten Jahre zuvor entdeckt, dass sich vor Willkürbewegungen ein sogenanntes Bereitschaftspotential über dem Schädel messen lässt. Libet ersann nun den Trick mit der Uhr, um einerseits das Bereitschaftspotential messen und seine Versuchspersonen zugleich fragen zu können, wann sie den Drang zu handeln bewusst verspürten.
Tatsächlich verspürten die Versuchspersonen den Drang, sich bewegen zu wollen, stets vor der Bewegung selbst. So weit, so erwartet. Doch dann kam die Überraschung: Der Blick auf das EEG zeigte, dass sich das Bereitschaftspotential im Gehirn schon aufbaute, bevor die Versuchsperson sich ihres Willens, jetzt die Hand zu heben, bewusst wurde. Das sogenannte supplementär motorische Areal im Großhirn, wo das Bereitschaftspotential vor jeder willentlichen Bewegung auftritt, war stets schon aktiv, bevor die Versuchspersonen die Bewegung bewusst wollten. Libets unerhörter Schluss: Der bewusste freie Wille kann diesen neuronalen Prozess des Jetzt-Handelns nicht einleiten.
Immer wieder heißt es seither, Libet habe den freien Willen experimentell widerlegt. Doch so einfach ist die Sache nicht. Zunächst betont selbst der Hirnforscher in seinem neuen Buch „Mind Time“ erneut, seine Experimente hätten gezeigt, dass der freie Wille unsere Willkürhandlungen zwar nicht einleiten könne, er aber sehr wohl eine Art Vetorecht habe. Danach kontrolliert das Bewusstsein, ob wir unbewusst im Gehirn gestartete Bewegungen abbrechen oder geschehen lassen wollen.
Doch auch diese Interpretation kann nicht die ganze Wahrheit sein. Denn was genau meint die Rede vom freien Willen? Er kann zunächst als geistiger Akt einer Entscheidung zwischen Alternativen verstanden werden etwa in dem Sinne: Ich öffne meine Hand statt sie liegen zu lassen. Mit Willen kann aber auch gemeint sein, eine willentlich Handlung zu initiieren: Ich kann meine Hand öffnen. Schließlich könnte es sich auch nur um eine geistige Aktivität handeln, die Kontrolle darüber ausübt, welche unbewusst im Gehirn vorbereiteten Handlungen erfolgen sollen: Ich will jetzt meine Hand öffnen. Vieles spricht dafür, dass Libet in seinem Experiment letzteres untersuchte (siehe „Kritische Einwände“). Das Bewusstsein löste ja stets nur eine monotone Handlung aus: Krümme jetzt den Finger! Alternativen waren nicht vorgesehen.
Bei dem Hirnstrom, der vor dem Willen auftrat, handelt es sich zwar um eine unbewusste Aktivität des Gehirns. Die dokumentiert aber nicht den Willensakt. Sondern dahinter steckt eine Form unbewusster Bewegungsplanung. Dabei werden Modelle gewünschter Aktionen simuliert, je nach Wunsch des Frontalhirns. Die Kette Aufmerksamkeit, Intention, Vorbereitung, Aufmerksamkeit und erst am Ende das bewusste Auslösen der Bewegung werden dabei kooperativ von verschiedenen Hirnregionen bewirkt. Die eigentliche Intention, den Finger auf Befehl zu krümmen, ist im Bewusstsein schon zu dem Zeitpunkt entstanden, zudem sich die Versuchsperson an den Tisch setzt. Das Bewusstsein delegiert aber die Planung der intendierten Bewegung an nachgeordnete Hirnregionen.
Die korrekte Deutung der Experimente Libets hängt damit im Kern davon ab, wie wir uns das Bewusstsein konzeptionell vorstellen. Ist es schlau und stets aufmerksam, verfolgt es also jedes Detail unserer geplanten Handlungen? Oder ist es eher faul, erteilt anderen Hirnregionen nur grobe Hinweise für künftige Aktionen oder lernt aus bereits gelaufenen? So verstanden, wäre das Bewusstsein die Spitze eines Eisbergs, die sich im hellen Licht befindet, während seine Hauptmasse im Unbewussten unter der Wasseroberfläche verbleibt.
Libet will diese Sichtweise nicht akzeptieren. Seiner Überzeugung nach kann der Wille nur dann ein freier sein, wenn ihm keinerlei unbewusste Aktivität im Gehirn vorausgeht. Nur dann bleibe eine kausale Lücke in der neuronalen Wirkungskette, in die sich ein immaterieller Geist einschreiben kann. Diese Lücke liefert das bewusste Veto. Der Haken: Warum soll ausgerechnet ihm keine unbewusste neuronale Aktivität vorausgehen? Und wie ein Geist ohne Gehirn tätig werden?
In diese argumentative Lücke stoßen die Deterministen, die es für unwissenschaftlich halten, wie Libet an einem immateriellen Geist zu glauben, den er sich als eine Art mentales Magnetfeld um das Gehirn vorstellt. Von solchen Spekulationen halten strenge Deterministen wie die beiden deutschen Neurobiologen Gerhard Roth und Wolf Singer nichts. Sie behaupten: Da der Geist im Gehirn entsteht, sei der freie Wille letztlich eine Illusion. Das Gehirn agiere wie ein „Orchester ohne Dirigent“, auch wenn dessen globale Ordnungszustände bisher nicht verstanden seien. Eine angeblich freie Entscheidung, hat Singer kürzlich formuliert, sei eine „Folge all der Faktoren, die Vorgänge in meinem Gehirn beeinflussen können“. Ein Gespräch zähle in der Kette der Ursachen neuronal womöglich nicht anders als „eine Watschen in der Kindheit“. Auch für Gerhard Roth spielt es keine Rolle, ob wir spontan nach einer Kaffeetasse greifen oder überlegen, ob wir das tun sollen oder nicht. „Die Letztentscheidung, ob etwas getan wird“, behauptet Roth, falle im Stammhirn, den Basalganglien, „ein bis zwei Sekunden vor Beginn der Bewegung“.

Im Stammhirn (lila) manifestiert sich die Freiheit der Entscheidung. Grafik: Yakobchuk / Fotolia.
Auch diese Sicht greift jedoch zu kurz. Ein harter Determinist neigt dazu, das subjektive Phänomen der Freiheit wegzuerklären, anstatt es neurobiologisch zu begreifen. Offenkundig gibt es zwischen den zerstrittenen Lagern einen dritten Weg. Danach sind der freie Wille und seine Determiniertheit nicht zwangsläufig unvereinbar. Freiheit ist nicht das Gegenteil von Bestimmtsein, sondern nur eine besondere Art des Bestimmtseins. Wirkliche Freiheit ist zwar bedingt. Als frei erleben wir eine subjektive Entscheidung demnach nicht, weil es eine unerklärliche Lücke gibt zwischen ihren Gründen und ihren Wirkungen. Sondern frei nennen wir Menschen eine Entscheidung, wenn sie selbstbestimmt in unserem Bewusstsein entsteht, aus eigener Abwägung und nicht Folge externer Umstände oder innerer Zwänge ist.
Wie dem Gehirn dieses Kunststück gelingt, ist weiterhin rätelhaft. Weil aber die Neurowissenschaft immer tiefere Einblicke in mentale Zustände gewinnt, hängt künftig alles von der präzisen Deutung der Daten ab. Unter Hypnose können Menschen selbst initiierte Willkürbewegungen als ungewollt erleben (siehe Experiment 4). Es hat also den Anschein, als ob sich Wille und Bewusstsein experimentell entkoppeln lassen. Unser Gefühl der bewussten Kontrolle unserer Aktionen könnte daher selbst eine Konstruktion unseres Gehirns sein. Doch was folgt daraus für das Ich? Die Fehlinterpretationen der Libetschen Versuche sollten Warnung sein, genau hinzuschauen, was wirklich im Gehirn ist und passiert. Und was nicht.
Die Libet-Experimente
Experiment 1: Der klassische Libet-Versuch zum freien Willen
Was passiert im Gehirn, wenn wir willkürlich die Hand bewegen? Unserem subjektiven Gefühl nach fällen wir zuerst die bewusste Entscheidung, dann erst können im Gehirn die ersten Vorbereitungen für die Bewegung eingeleitet werden. Erst will ich meine Hand heben, dann bewegt sie sich. Ursache vor Wirkung. Daran kann niemand ernsthaft zweifeln. Oder doch? Benjamin Libet wollte es mit diesem wohl meistdiskutierten Experiment der Neurowissenschaften genauer wissen. Und ersann eine Versuchsanordnung, mit der er ursprünglich den freien Willen im Gehirn dingfest machen wollte.
Die geniale Idee mit der Uhr lieferte Libet den Schlüssel zum subjektiven Erleben der Versuchsteilnehmer. Die Versuchspersonen saßen bequem und blickten auf eine schnell laufende Uhr. Ihre Aufgabe: Wann immer sie bewusst den Drang verspürten, ihre Hand heben zu wollen, sollten sie sich die Uhranzeige merken. Im März 1979 begann der Versuch. Die Psychologiestudentin C. M. und acht weitere Teilnehmer nahmen auf einem Lehnstuhl Platz. Kopf und Hand wurden mit Elektroden verkabelt. Sie selbst blickte auf einen Bildschirm, auf dem ein grüner Punkt kreiste. Der benötigte 2,56 Sekunden für eine Umdrehung. Zu einem frei gewählten Zeitpunkt sollte C. M. nun spontan ihr Handgelenk heben. Den genauen Zeitpunkt der Bewegung registrierte Libet per Elektromyographie (EMG) über die Muskeln am Handgelenk (blau), die Hirnströme im Großhirn leiteten Elektroden am Kopf (Elektroenzephalogramm, EEG) ab. Den Zeitpunkt der bewussten Entscheidung zur Bewegung wiederum erfuhr Libet nach jedem Versuch von C. M. selbst, weil diese sich merkte, wo sich der kreisende Punkt befunden hatte, als der bewusste Drang, die Hand zu bewegen, einsetzte. Anhand der Hirnstromkurven konnte Libet in dem Versuch zwei verschiedene Bewegungstypen unterscheiden: als geplant erlebte (gelb) und solche, bei denen die Hand spontan bewegt wurde (rot).
Der Zeitpunkt, zu dem die Versuchsteilnehmer ihren bewussten Entschluss fassten, lag im Mittel von jeweils 40 Versuchen stets rund 0,2 Sekunden vor der eigentlichen Bewegung. Genau so hatte es Libet erwartet. Völlig überraschend aber setzten die Hirnströme in dem Bereich des Gehirns, der spontane Bewegung steuert, schon eine halbe Sekunde vor der Willkürhandlung ein. Im Durchschnitt also 300 Millisekunden vor dem Zeitpunkt, zu dem sich die Versuchspersonen ihres Willens zu handeln bewusst wurden, entstand im Gehirn ein Bereitschaftspotential, das die Aktion tatsächlich unbewusst initiierte. Hatte das Gehirn von C. M. also eine Willenshandlung eingeleitet, ohne dass die Probandin davon wusste? Immerhin hatte diese ja berichtet, sich erst eine gute Drittelsekunde später zu der Bewegung entschlossen zu haben.
Laut Libet kann das Bewusstsein eine Willkürbewegung also nicht selbst initiieren. Das Libet-Experiment habe den freien Willen experimentell widerlegt, liest man seit Jahren immer wieder. Vergessen wird von diesen Neuro-Deterministen dabei gerne, dass es inzwischen eine Flut alternativer Deutungen des Versuchs gibt (siehe „Kritische Einwände“ und „Bereit für die Freiheit“). Libet selbst hat übrigens nie wirklich behauptet, dass der freie Wille eine Illusion sei. Sein Versuch zeige ja, dass dem Bewusstsein im Durchschnitt rund 200 Millisekunden zwischen dem Auftauchen des bewussten Willens und der eigentlichen Handlung blieben. Das reiche, um eine Kontrolle darüber auszuüben und im Gehirn unbewusst eingeleitete Aktionen zumindest zu stoppen. Das Bewusstsein, so Libet, habe ein „Vetorecht in bezug auf das, was unser Gehirn an Bewegungen initiiert“. Wir sind demnach laut Libet nicht frei zu wollen, aber uns bleibt als Trost eine Art trotziger freier Unwille.
Kritische Einwände
1. Der Versuch misst keinen Akt der Entscheidung
Das stereotype Heben der Hand musste in dem Libet-Experiment bis zu 40mal wiederholt werden, damit die äußerst schwachen Hirnströme statistisch überhaupt nachweisbar wurden. Ist dieser Drang, sich zu bewegen, aber schon eine bewusste Entscheidung? Wahrscheinlicher ist, dass die willkürliche Entscheidung im Bewusstsein schon vor Beginn der monotonen Versuchsreihe getroffen wurde. Nachdem die Teilnehmer in den Versuch einwilligten, delegierte ihr Bewusstsein die präzise Vorbereitung der Handbewegungen an jene motorischen Zentren, die im Gehirn solche Handlungen vorbereiten. In diesen Hirnregionen erfolgten die neuronalen Berechnungen für einzelne Handkrümmungen, die dann kurz vor Ausführung der Aktion vom Bewuss...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Wer ist der Käpt’n im Kopf?
- Denkprozesse und Entscheidungen
- Hirndoping
- Wenn das Hirn Schaden nimmt
- Denken Digital
- Service