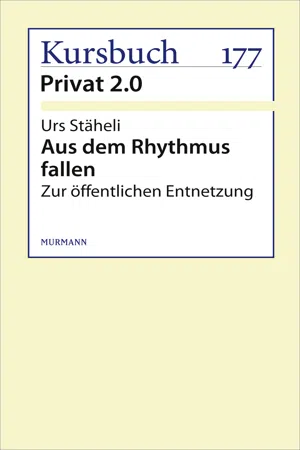Urs Stäheli
Aus dem Rhythmus fallen
Zur öffentlichen Entnetzung
Die Fehlermeldungen »kein Anschluss unter dieser Nummer« oder »keine Verbindung« sind ein fester Bestandteil unseres digital vernetzten Alltags geworden. Häufig gefolgt von der freundlichen, aber bestimmten Aufforderung, es noch einmal zu versuchen. Die Hoffnung auf eine Verbindung muss nicht aufgegeben werden: Man mag sich etwas gedulden und später noch einmal einen Verbindungsversuch wagen. Anschlusslosigkeit taucht hier als ein Alltagsproblem auf, dessen Benennung schon auf seine Abhilfe verweist. Die zunächst lapidar anmutende Feststellung »keine Verbindung« ist gleichzeitig stets auch ein Ruf zur Wiederherstellung einer Ordnung: »Connection failed. Try it again!« Das ist das Motto der Netzwerkgesellschaft. Tue etwas, unternimm einen neuen Verbindungsversuch, damit die Meldung verschwindet. Verbindungslosigkeit ist ein kleiner technischer Störfall, der mich zeitweilig in meinen Netzwerken unerreichbar macht – aber ein Störfall, der beim nächsten Versuch bereits schon behoben sein wird.
Die Alltäglichkeit dieser uns vertrauten Meldung verweist auf die Normalitätsunterstellung, welche ihr zugrunde liegt: Im Normalfall funktionieren Verbindungen, selbstverständlich gehen wir von deren reibungslosem Zustandekommen aus; im Normalfall werden Verbindungen geschaffen, um weitere und neue Verbindungen aufzubauen. Der Triumph der Netzwerkmetaphorik nicht nur in der Theorie, sondern auch als Selbstbeschreibung ganz unterschiedlicher sozialer und kultureller Bereiche zeugt von dieser Allgegenwart des Sichverbindens. Der Abbruch von Verbindungen, die Nichterreichbarkeit und das Sichherauslösen aus Netzwerken können vor einem solchen Hintergrund nur als Störfälle oder gar als Pathologien thematisiert werden – als ein schnell zu behebendes kleines Ärgernis, das unser Vertrauen in die Verbindungsfähigkeit der modernen Gesellschaft nicht erschüttern soll. Auch wenn dieser Imperativ des Sichverbindens in den Social Media besonders augenfällig ist, so handelt es sich hier keineswegs um ein Problem, das sich auf diesen Bereich beschränkt. Der Imperativ »Vernetze dich!« lässt inzwischen kaum noch eine gesellschaftliche und kulturelle Sphäre unberührt: Von den Tumblr Followers, den vernetzten Organisationen über die interdisziplinäre Vernetzungseuphorie der Wissenschaften bis hin zu den Vernetzungstreffen der Antiglobalisierungsbewegung – all diese Phänomene vereint, dass hier Vernetzung gleichermaßen eine soziotechnische Voraussetzung wie auch ein moralischer Imperativ ist. In der Figur des Vernetzungsversagers – wie zum Beispiel dem Schüchternen oder dem Erschöpften – findet die technische Störung ihr moralisiertes und pathologisiertes soziales Pendant. Provokativer noch als die bloße technische Störung muss derjenige wirken, der sich eigentlich vernetzen könnte, aber aus freien Stücken darauf zu verzichten scheint. Am beruhigendsten für die Euphoriker der Netzwerkgesellschaft mögen dann noch pathologisierbare Formen der unfreiwilligen Entnetzung sein: Der Burn-out-Patient, der zu häufig nicht Nein sagen konnte, der den Vernetzungsimperativen zu sehr gefolgt ist und der nun buchstäblich keine Vernetzungsenergie mehr aufbringen kann – mit dieser Figur mag zwar ein »Zuviel« an Vernetzung thematisiert sein, sie stellt aber nicht die Aufforderung zur Vernetzung infrage;1 sie wird nicht zum Modell eines »freiwilligen« Entzugs, einer Indifferenz gegenüber den unendlichen Möglichkeiten des Sichvernetzens.
Es ist diese Kopplung von im weitesten Sinne medientechnischen und sozialen Möglichkeiten der Vernetzung und dem moralischen Imperativ, sich permanent zu vernetzen, welche Entnetzung nicht nur in der gegenwärtigen Sozialtheorie, sondern auch in unserem Alltagsleben nahezu undenkbar gemacht hat. Uns fehlen Begriffe für die Entnetzung – Begriffe, mithilfe derer wir diese nicht nur als Unfall, Krankheit oder Versagen fassen können. Allerdings scheint sich, noch vor den theoretischen Modellen, in den digitalen Alltagspraktiken zunehmend die Notwendigkeit von Entnetzung abzuzeichnen. Die Social Media konfrontieren uns im Alltag nicht nur mit den Störungsmeldungen, sondern auch mit der technischen Möglichkeit, Vernetzungen wieder rückgängig zu machen – Verbindungen zu trennen. Ich mag mich von Facebook-Freunden »defrienden«, wenn sie mit langweiligen Urlaubsgeschichten angeben; oder ich »unfollowe« jenen Tumblrs, die mir nicht gefolgt sind und damit ein ungeschriebenes Reziprozitätsprinzip verletzt haben. Ähnlich ist von »untrust« oder von »delinking« die Rede. Umständliche Begriffe wie »unfollow« verweisen auch hier noch darauf, dass Entnetzung eigentlich nicht vorgesehen war. Entnetzung wird immer nur als Negation der Vernetzung gedacht, als ein Rückgängigmachen einer zuvor geschaffenen Verbindung. Sie räumt im besten Falle auf, indem sie ungenutzte, nicht mehr aktuelle Verbindungen löscht; sie wird aber weit häufiger als destruktiver, aggressiver oder krankhafter Akt gesehen. Einer solchen Sicht entgeht...