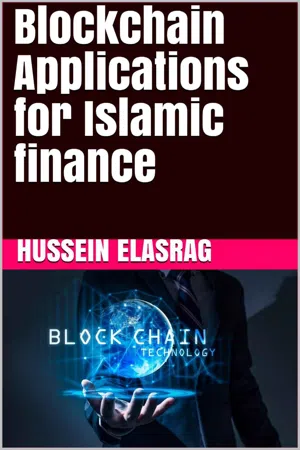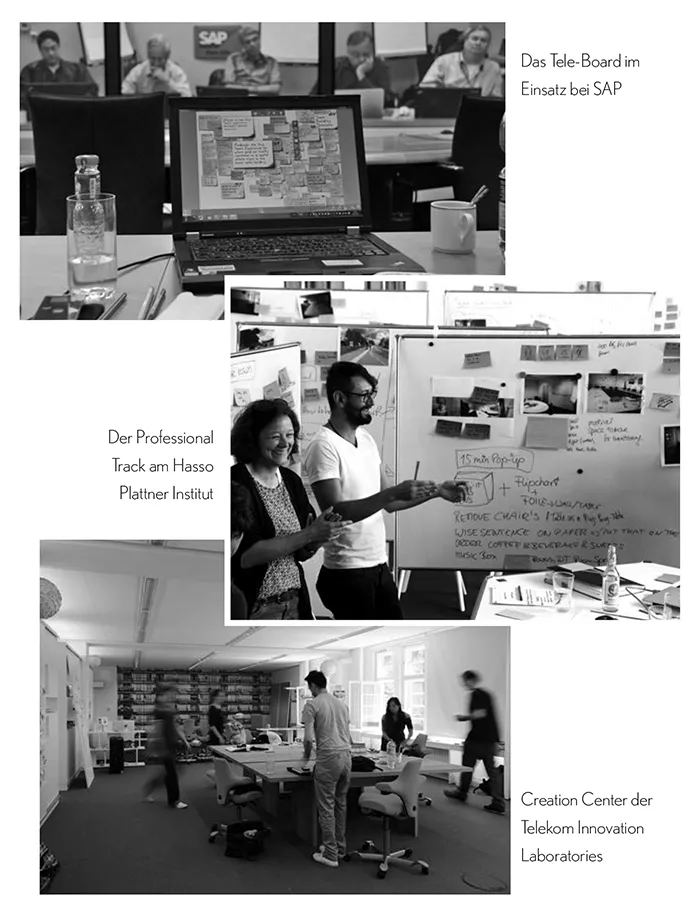![]()
III. DESIGN THINKING IN DER INDUSTRIE
![]()
Claudia Kotchka
EINE NEUE REZEPTUR: DESIGN THINKING UND ARIEL
Procter & Gamble
Unser allererstes Design-Thinking-Projekt haben wir zusammen mit IDEO für unsere Reinigungssparte gemacht. Der große Schock und zugleich das große »Aha-Erlebnis« für mich war damals das Prototyping, genauer der grobe Prototyp. Nie zuvor hätten wir etwas an Verbraucher weitergegeben, das aus Papptellern, Pappe oder Industrieklebeband bestand. Aber als wir es taten, wurde mir klar, dass es bei der Anfertigung von Prototypen eher darum geht, Feedback und Input zu bekommen, und nicht so sehr darum, genau abzustecken, was wir fertigen wollten. Prototypen können zu herrlichen weitreichenden Lernerfahrungen führen. Zum damaligen Zeitpunkt war das für mich die wichtigste Erkenntnis.
Um zu zeigen, zu welchen Erfahrungen Design Thinking führen kann, greife ich gerne auf Beispiele zurück. Eines davon ist das sehr eingängige Tide- beziehungsweise Ariel-Beispiel, in dem wir das Waschverhalten der Generation Y beobachteten. Wir fanden heraus, dass sie übers Wäschewaschen anders denken als unsere typischen Konsumenten. Für sie steht nicht die Fleckenentfernung im Vordergrund. Sie wollen ihre Wäsche pflegen, besonders ihre Jeans. Dies hat dann zur neuen Rezeptur von Tide beziehungsweise Ariel geführt, die die Kleidung pflegt. Auch der Ansatz, Nichtkonsumenten zu beobachten und zu interviewen, war etwas, das wir nie zuvor getan hatten.
Ein weiteres Design-Thinking-Projekt, das ich sehr aufschlussreich fand, war ein internes Projekt mit Procter & Gamble-Mitarbeitern als Teilnehmern. In dem Projekt sollte es darum gehen zu verstehen, wie einzelne Geschäftsbereiche besser miteinander arbeiten und mehr Synergien schaffen könnten. Das Ergebnis war, dass wir die wirklichen Problempunkte identifizieren und Wege zu ihrer Lösung finden konnten.
Design Thinking ist ein anderer Weg, Probleme zu lösen. Und zwar in zweierlei Hinsicht: Der erste hat damit zu tun, dass Designer sich mit einer ganz bestimmten Haltung Projekten annähern. Sie stellen die Aufgabe infrage, fassen das Problem neu und suchen nach Lösungen ohne Kompromisse. Außerdem wählen sie ein anderes Verfahren, Probleme zu lösen. Während man in traditionellen Prozessen erst einmal mit der Analyse beginnt, fängt Design Thinking mit Empathie gegenüber dem Nutzer an. Unternehmen, die von diesem Ansatz ausgehen, nutzen eine Reihe ungewöhnlicher Methoden, um Beobachtungen durchzuführen und zu strukturieren. Dann fertigen sie ungefähre Prototypen an, um mehr Input und Informationen von den Nutzern zu erhalten.
»Design Thinking gehört zu den Erfahrungen, die tief ins eigene Leben eindringen.«
Design Thinking gehört zu den Erfahrungen, die tief ins eigene Leben eindringen. Mittlerweile erkenne ich überall Design-Aufgaben und Anregungen.
Ich kann mir die Anwendung von Design Thinking für alle möglichen Problemstellungen vorstellen, nicht nur im Produktbereich. So kann es für ein Unternehmen im Ganzen sinnvoll sein, für alle Sparten – nicht nur die Produktentwicklung.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Verschiedenartigkeit innerhalb der Teams. Man braucht Menschen, die verschieden denken. Wenn Leute Annahmen und die herkömmliche Art, Dinge zu sehen, infrage stellen, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass es zu durchschlagenden Ideen kommt. Denken, das in verschiedene Richtungen geht, erleichtert diesen Prozess.
Es gibt viele Wege, Design Thinking anzuwenden. Der allerwichtigste jedoch ist der, Dinge auszuprobieren. Man muss die Erfahrung machen. Immer wenn Leute ganz scharf darauf sind, mehr von Design Thinking zu erfahren, dann sage ich ihnen, dass sie an Workshops teilnehmen sollen, wie sie in Stanford angeboten werden. Auch gibt es gute Bücher zur Einführung wie etwa Creative Confidence von David und Tom Kelley oder Change by Design von Tim Brown oder The Design of Business von Roger Martin und The Art of Innovation von Tom Kelley.
Zur Zukunft des Design Thinking
Was ich mir wünschen würde, ist, dass Design Thinking für die Menschen zur selbstverständlichen Art wird, ihre Probleme zu lösen. Auch wenn es nicht die Antwort auf alle Fragen ist, sollte es doch jeder in seinem Repertoire haben. Deswegen hoffe ich, dass es bald überall gelehrt wird, auch in Grundschulen oder High Schools.
![]()
Matthias Schmitt
DEN GESUNDEN MENSCHVERSTAND LEHRBAR MACHEN
SAP
Meine erste Design-Challenge beim Design-Thinking-Training in Potsdam bestand darin, den optimalen Geldbeutel zu entwerfen. Dabei haben wir festgestellt, dass es bereits bei so »trivialen« und aus dem Alltag gegriffenen Themen durchaus Innovationsbedarf aufgrund divergierender Kundenbedürfnisse und -erwartungen gibt. So habe ich Design Thinking lieben gelernt, da es für mich die Kernthemen Kundenorientierung und Effektivitätssteigerung bei der Kollaboration in Teams provoziert. Die dahinterliegende Methodologie macht diese Themen lehrbar und damit skalierbar.
Im Bereich Kundenbeziehungsprozesse bin ich bereits seit vielen Jahren in der Beratung unterwegs – und habe nach meinem Wechsel im Juli 2011 in die SAP Entwicklung festgestellt, wie weit die Kollegen dort von den Kunden und deren Anforderungen entfernt sind. Daher konnte ich den Sinn und Zweck der Design-Thinking-Initiative bei SAP unmittelbar verstehen und in meinen Bereichen aktiv unterstützen.
Während des Workshops in Potsdam habe ich angefangen, am Rollout-Plan in meinem neuen globalen Bereich mit Standorten in China, Indien, Deutschland und Italien zu arbeiten. Unsere größte Herausforderung ist, dass wir nahezu ausnahmslos in verteilten Teams an Projekten zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang war auch die Vorstellung des Teleboard eine wichtige Inspirationsquelle für meinen Bereich. Dieses System eignet sich sehr gut für die Zusammenarbeit von global verteilten Teams, da wir zur selben Zeit am Whiteboard arbeiten und Post-its mit Texten oder Bildern erstellen, die in Echtzeit an alle Standorte übertragen werden. Dadurch hören wir nicht nur die Beiträge der Kollegen, sondern sehen sie auch unmittelbar, was das gemeinsame Verständnis beschleunigt und verbessert und natürlich auch die Weiterverarbeitung der anderen Beiträge ermöglicht. Wir bewegen uns nun viel freier, da wir uns das Gefühl von räumlicher und zeitlicher Nähe sehr realistisch nachbauen, und wir sind nicht mehr so fest an Telefonkonferenzen gebunden, die eine hohe Konzentration und Disziplin erfordern, wenn bei den Meetings etwas herauskommen soll.
Die erste Design-Challenge, die ich meinem verteilten Team mitgegeben habe, war es dementsprechend, ein globales Zusammenarbeitsmodell über unsere Standorte hinweg zu entwickeln. Bemerkenswert dabei ist, wie schnell die Kollegen Spaß an der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen fanden. Jetzt »üben« wir regelmäßig Design Thinking mit Teilnehmern aus den verschiedenen Standorten und Zeitzonen. Eines dieser Projekte nannten wir dann auch Explore Design Thinking. Dort ermittelten wir, wie wir noch effektiver zusammenarbeiten und Innovationen entwickeln können, die auf den Vorteilen aufbauen, mit unseren verteilten Teams in mehreren Märkten direkt präsent zu sein.
Kundenorientierung mit vielen Vorteilen
In einer weiteren Design-Challenge wollten wir Möglichkeiten entwickeln, unsere Software zur einfacheren und schnelleren Implementierung bei Kunden auszuliefern. Ein gemischtes Team aus verschiedenen SAP-Abteilungen hat sich damit auf den Weg gemacht und entlang unserer Kundenkette über den Vertrieb, die Beratung bis hin zu Endanwendern Feedback zum Status quo und zu den eigentlichen Anforderungen eingeholt.
Außerdem hat das Team einen Hersteller von Fertighäusern besucht und festgestellt, dass mit der Ausgangssituation von Musterhäusern, die dann einige Kundenanpassungen erhalten, ein Eigenheim sehr schnell zur Realität werden kann. Diese Analogie haben wir auf unsere Software-Lösungen übertragen und ermöglichen nun einen schnelleren Start für unsere Kunden, indem wir viel mehr als nur die Software liefern. Die Lösung kann ein Kunde aus verschiedenen, mit Industrie-Best-Practices vorkonfigurierten Modulen in einer Cloud-Umgebung zur unmittelbaren Nutzung auswählen und muss dabei nur noch geringfügige Anpassungen für den Start im Betrieb vornehmen. So hat der Kunde schnell eine Verbesserung seiner Geschäftsprozesse und kann diese trotzdem iterativ ausbauen und verbessern.
»Mit Design Thinking wird gesunder Menschenverstand für das Lösen von Aufgaben lehrbar und damit skalierbar.«
Neben der höheren Kundenorientierung war mir bei der Einführung von Design-Thinking-Methoden besonders auch die Effektivitätssteigerung in der Zusammenarbeit innerhalb der Teams wichtig. Dieser Effekt hat sich bereits an verschiedenen Stellen bemerkbar gemacht. Meine Mitarbeiter können kreativer und noch selbstständiger arbeiten und freuen sich über die Möglichkeit, noch mehr über die Zielgruppe unserer Produkte zu erfahren. Zusammen mit dem regelmäßigen und zeitnahen Feedback führt das zu signifikant höherer Motivation. Vorher war der Trend bei uns eher, dass Entwickler durch Arbeitsteilungen und organisatorische Maßnahmen immer weniger mit den Kunden zu tun hatten und von unseren Feldkollegen die Kundenbedürfnisse für die Entwicklung definiert wurden.
Design Thinking als Arbeitskultur motiviert dazu, unter Beteiligung von Personen aus verschiedenen Disziplinen und regelmäßiger Einbindung des Nutzers eingefahrene Wege zu verlassen. Damit eröffnen sich Möglichkeiten, wirklich neue Ideen zu generieren und agil weiterzuentwickeln, indem Prototypen der Lösung Vertretern aus der Zielgruppe immer wieder für ein Feedback vorgelegt werden.
Produkte und Services, die so entstehen, können meistens auch umgehend verkauft und genutzt werden, da durch die Co-Innovation der Nutzen offensichtlich ist. Daher reduzieren sich auch Marketingaufwände, da es meist bereits erste Pilotkunden gibt. Wichtig für mich war dabei die Erkenntnis, dass der Gesamtprozess der Ideenfindung, des Designs und der Produktentwicklung nicht länger dauert als bei konventionellem Vorgehen. Außerdem erzwingt die Einführung von Design Thinking keine organisatorischen Veränderungen, da es per se diversifizierte Teams für die Lösung einer Design-Challenge in einem Projekt zusammenbringt und danach wieder auflöst. Damit kann auch dem Schnittstellen-Dilemma in Matrixorganisationen begegnet werden, das dort üblicherweise durch viele Schnittstellen zwischen den Bereichen und überlappende Funktionen und Verantwortlichkeiten verursacht wird.
Die Bedeutung von Vorbildern
Wie bei jedem Change-Management-Projekt ist jedoch auch bei der Einführung von Design Thinking in einem Unternehmen die volle Unterstützung und das Vorleben durch das Senior Management erfolgskritisch. Außerdem macht es sehr viel Sinn, dass entsprechend ausgebildete Berater den Rollout im Unternehmen anfangs begleiten. In diesem Zusammenhang müssen eigene Evangelisten ausgebildet und entsprechende flexible und inspirierende Räumlichkeiten aufgebaut werden. Die Einführung nur an einige Mitarbeiter zu delegieren und sie alleine machen zu lassen, bedeutet, entweder einen langwierigen Prozess hinnehmen zu müssen oder einen, der ganz zum Scheitern verurteilt ist.
Zurzeit ist unsere Design-Thinking-Ausrichtung immer noch sehr prozessgetrieben. Das bedeutet, dass die Kollegen nach wie vor bewusst in den Design-Thinking-Modus wechseln oder gar ein Projekt als Zusatz zum eigentlichen Projekt oder Thema starten. Im nächsten Schritt wollen wir erreichen, dass Design Thinking kein separater Prozess mehr ist, sondern die Einzelelemente voll integriert in unseren Alltagsprozessen gelebt werden. Dann werden wir auch nicht mehr von Design Thinking sprechen. Ich beschreibe Design Thinking heute schon gerne als Methode, die den »gesunden Menschenverstand lehrbar macht«.
Zur Zukunft des Design Thinking
In 20 Jahren werden wir längst nicht mehr über Design Thinking reden. Bereits heute rücken die Menschen immer näher...