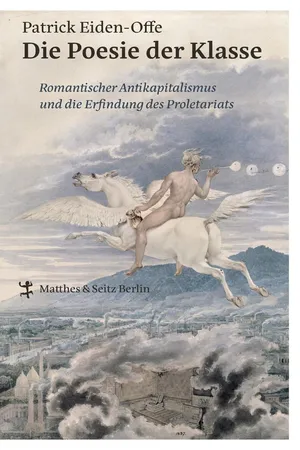
eBook - ePub
Die Poesie der Klasse
Romantischer Antikapitalismus und die Erfindung des Proletariats
- 460 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Poesie der Klasse
Romantischer Antikapitalismus und die Erfindung des Proletariats
Über dieses Buch
Mit der Durchsetzung des Kapitalismus und der Industrialisierung entsteht im frühen 19. Jahrhundert aus verarmten Handwerkern, städtischem Pöbel, umherziehenden ländlichen Unterschichten, bankrotten Adligen und nicht zuletzt freigesetzten prekären Intellektuellen jenes neue soziale Kollektiv, das man in der Sprache der Zeit bald das Proletariat nennen wird. Allerdings existierte dieses zunächst noch nicht als formierte, homogene Klasse mit angeschlossenen politischen Parteien, die den Weg in die bessere Zukunft vorgeben. Die buntscheckige Erscheinung, die Träume und Sehnsüchte dieser allen ständischen Sicherheiten entrissenen Gestalten fanden neue Formen des Erzählens in romantischen Novellen, Reportagen, sozialstatistischen Untersuchungen, Monatsbulletins. Doch schon bald wurden sie – ungeordnet, gewaltvoll, nostalgisch, irrlichternd und utopisch, wie sie waren – von den Vordenkern der Arbeiterbewegung als reaktionär und anarchisch verunglimpft, weil sie nicht in die große lineare Fortschrittsvision passen wollten. In seiner bahnbrechenden Studie verhilft Patrick Eiden-Offe dem lange verdrängten romantischen Antikapitalismus zu seinem Recht und befreit die Sozial- und Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts aus ihren eindimensionalen Sichtachsen. Dabei wird nicht zuletzt deutlich, dass die historische, poetisch besungene unordentliche Klasse den heutigen Figuren von Prekarität nach dem Ende der alten Arbeitsgesellschaft verblüffend ähnlich ist.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Poesie der Klasse von Patrick Eiden-Offe im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Wissenschaftliche Forschung & Methodik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Anmerkungen
Einleitung
1 Den Klassencharakter der Juli-Revolution haben zeitgenössisch Ludwig Börne und Heinrich Heine dem deutschen Publikum mit ihren Pariser Korrespondentenartikeln nahegebracht. Vgl. Ludwig Börne, Briefe aus Paris, Frankfurt a. M. 1986 [1832–1834], und Heinrich Heine, Französische Zustände, in: ders., Sämtliche Schriften in zwölf Bänden, Bd. 5: 1831–1837, hg. v. Klaus Briegleb, München/Wien 1976, S. 89–279.
2 Eine Einordnung der Saint-Simonisten in ihre Zeit findet sich bei David Harvey, Paris, Capital of Modernity, New York/London 2006, besonders S. 59–89.
3 Eduard Gans, Rückblicke auf Personen und Zustände, Neudruck. Hg., komment. und mit einer Einl. versehen von Norbert Waszek, Stuttgart-Bad Cannstatt 1995 [1836], S. 98 f. Zum Verhältnis der Hegel’schen Schule zum Saint-Simonismus vgl. Hans-Christoph Schmidt am Busch, Religiöse Hingabe oder soziale Freiheit. Die saint-simonistische Theorie und die Hegelsche Sozialphilosophie, Hamburg 2007.
4 Gans, Rückblicke, S. 100 f.
5 Vgl. Gans, Rückblicke, S. 100, wo von einer »Kruste der bürgerlichen Gesellschaft« die Rede ist, »die man gewöhnlich Pöbel nennt«. Zum Pöbel bei Hegel vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, mit Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen Zusätzen, in: ders., Werke, hg. v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel, Bd. 7, Frankfurt a. M. 1986, § 244, S. 389.
6 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, in: ders., Werke, hg. v. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 13–15, Frankfurt a. M. 1986, hier Bd. 15, S. 392 f.
7 Friedrich Theodor Vischer, »Theorie des Romans«, in: Gerhard Plumpe (Hg.), Theorie des bürgerlichen Realismus, Stuttgart 1986, S. 240–247, hier S. 240 f. (aus: Fr. Th. Vischer, Die Dichtkunst, Stuttgart/Reutlingen 1857, S. 1317–1321).
8 Jacob Grimm, Deutsche Grammatik, Göttingen 1819, S. XXVII. Bei Grimm ist die Diagnose zivilisationskritisch gemünzt, sie wird eingeschrieben in eine Dialektik der Aufklärung: »Man kann die innere Stärke der alten Sprache mit dem scharfen Gesicht, Gehör, Geruch der Wilden, ja unserer Hirten und Jäger, die einfach in der Natur leben, vergleichen. Dafür werden die Verstandesbegriffe der neuen Sprache zunehmend klärer und deutlicher. Die Poesie vergeht und die Prosa (nicht die gemeine, sondern die geistige) wird uns angemessener.«
9 Theodor Mundt, Die Kunst der deutschen Prosa. Aesthetisch, literargeschichtlich, gesellschaftlich, Berlin 1837, S. 20 sowie S. 131 und S. 359; Berthold Auerbach, Schrift und Volk. Grundzüge der volksthümlichen Literatur, angeschlossen an eine Charakteristik J. P. Hebel’s [1846], in: ders., Schriften zur Literatur, hg. v. Marcus Twellmann, Göttingen 2014, S. 7–173, hier S. 67. Darüber hinaus: Johann Christian August Heyse, Theoretisch-praktische deutsche Grammatik oder Lehrbuch der deutschen Sprache, nebst einer kurzen Geschichte derselben, Bd. 1, 5., von Karl Wilhelm Ludwig Heyse bearbeitete Auflage, Hannover 1838 [1814]. S. 94. Hier wird Grimm als Beleg für die These zitiert, dass in der Moderne »die sinnliche Seite der Sprache mehr und mehr zurücktritt«. Bei Heinrich Küntzel, Drei Bücher deutscher Prosa, in Sprach- und Stylproben: Von Ulphilas bis auf die Gegenwart, Bd. 3, Frankfurt [a. M.] 1838, S. 339, wird Grimm mit seiner Sentenz als einer der »Sprachreiniger« des 18. Jahrhunderts zitiert. Ich danke Marcus Twellmann für unzählige Vormärz-Gespräche: Die Wette gilt, dass meine Erzählung vom Proletariat eben doch mehr und anderes ist als »Covert Pastoral« (Empson).
10 Vischer, »Theorie des Romans«, S. 240 f.
11 Zur Verortung von Gans im Milieu der entstehenden Hegel’schen Linken vgl. Norbert Waszek, »War Eduard Gans (1797–1839) der erste Links- oder Junghegelianer?«, in: Michael Quante und Amir Mohseni (Hg.): Die linken Hegelianer. Studien zum Verhältnis von Religion und Politik im Vormärz, Paderborn 2015, S. 29–51.
12 Hier wäre an das berühmte, von Julian Schmidt übernommene Motto von Gustav Freytags Soll und Haben zu denken: »Der Roman soll das deutsche Volk da suchen, wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden ist, nämlich bei seiner Arbeit« (Gustav Freytag, Soll und Haben, München/Wien 1977 [1855], o. Seitenzahl [S. 6]). Im dritten Buch des Romans ruft der Held Anton Wohlfahrt inmitten des Schreckens der Revolution am Schreibpult aus: »Das ist Poesie, die Poesie des Geschäftes, solche springende Tatkraft empfinden wir nur, wenn wir gegen den Strom arbeiten« (S. 326). Auf Freytags schnell berühmt werdendes Motto erwiderte der alternde Franz Grillparzer knarzig: »Daß die Poesie Arbeit, / Ist leider eine Wahrheit. / Doch daß die Arbeit Poesie, / Glaub ich nun und nie« (zit. nach Martin Gubser, Literarischer Antisemitismus. Untersuchungen zu Gustav Freytag und anderen bürgerlichen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts, Göttingen 1998, S. 187).
13 Meine Arbeit baut aufjene Debatten um eine »Poetologie des Wissens« auf, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten in den deutschen Kulturwissenschaften geführt wurden, auch wenn ich im Einzelnen nur selten Bezug darauf nehme; vgl. Joseph Vogl, Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen, Zürich/Berlin 2002. Dass der Erfinder der Formel »Poetik des Wissens«, Jacques Rancière, diese aus einer ausgreifenden sozialhistorischen Beschäftigung mit der frühen französischen Arbeiterbewegung gewonnen hat, ist für meine Studie indes von zentraler Bedeutung; vgl. Jacques Rancière, Die Namen der Geschichte. Versuch einer Poetik des Wissens, Frankfurt a. M. 1994, sowie ders., Die Nacht der Proletarier. Archive des Arbeitertraums, Wien/Berlin 2013 [1981]. Ein kurze Einordnung Rancières in die Geschichte und Methodendiskussion der Sozialgeschichtsschreibung versuche ich in »Der Schmerz der gestohlenen Zeit«, in: Jungle World vom 14. November 2013, Kulturbeilage, S. 1...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Widmung
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I Kleine Meister und Gesellen: Von der Zunft zur Bewegung
- II »Wir? Verwickelte Frage!« – Zur Identitätsfindung der Klasse in Zeitschriftenprojekten
- III Die Auszählung der Stimmen: Klassen-Statistiken
- IV Miserabilismus und Kritik: Vom Elend der Literatur zum Elend der Theorie
- V Lohnarbeit und Sklaverei: Uneingelöste Freiheitsversprechen
- VI Darstellungsprobleme der »arbeitenden Armut«
- VII Klasse im Kampf
- Schluss: Die Rückkehr des romantischen Antikapitalismus
- Epilog: Romantischer »Antikapitalismus« von oben
- Anmerkungen
- Literaturverzeichnis
- Namensregister
- Impressum
- Weitere E-Books von MSB