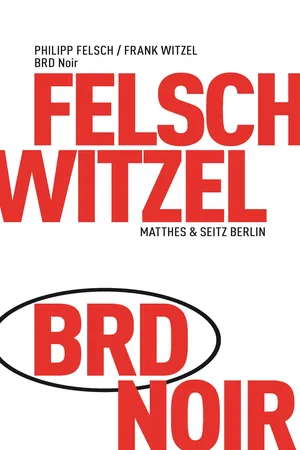Philipp Felsch und Frank Witzel
BRD Noir
1. Provinz
Philipp Felsch (F): Warum müssen Adoleszenzromane, speziell aus der alten Bundesrepublik, eigentlich immer in der Provinz spielen? Das gehört sozusagen zur Gattung dazu. Aber warum denn? Was zeichnet die Provinz im Verhältnis zur Großstadt aus?
Frank Witzel (W): Es gibt ja unterschiedliche Formen von Provinz. Oft spielen solche Geschichten in kleinen Dörfern, die weit abgelegen sind. In meinem Roman ist die Stadt in der Nähe, aber seltsamerweise besteht trotzdem eine Form von starker Provinzialität, weil man sich als Kind eben nur in einem ganz beschränkten Umfeld aufhält. Es stellt sich also die Frage, ob die Kindheit nicht generell mit der Provinz eng verbunden ist.
F: Vielleicht ist Provinz gar kein geografischer Ort, sondern eine Lebensphase …
W: Genau, Provinz ist auch ein Alterszustand, weil man sich nur in einem engen Umfeld bewegt. Die Freunde kommen aus der nächsten Straße, die Schule ist auch eher nah. Für diese sogenannten Fahrschüler, die von weiter weg mit dem Bus kamen, oft eine Stunde früher da waren und auch nach der Schule im Aufenthaltsraum bleiben mussten, bis ihr Bus fuhr, war das noch einmal etwas anderes, denn sie sind auch räumlich von dem Ort getrennt, wo sie hinmüssen oder -wollen. In Biebrich, wo ich aufgewachsen bin, hätte man mit dem Bus gerade mal drei, vier Stationen fahren müssen und wäre im Wiesbadener Zentrum gewesen, und trotzdem hat man das als Kind, selbst als 13-, 14-Jähriger selten gemacht.
F: Vielleicht ist das eine Provinz im Kopf, die es auch in der Großstadt geben kann. Man hat als 13-Jähriger ja nicht die Idee, dass es woanders interessanter sein könnte. Die Welt zwischen Schule, Sportplatz und Edeka war für mich damals jedenfalls immer noch wichtiger als alles, was dahinter lag. Aber ich habe den Eindruck, damit ist trotzdem nicht alles zum Thema Provinz gesagt. Weil die alte Bundesrepublik nämlich unter Verdacht steht, generell ein provinzielles Land gewesen zu sein. Vielleicht ist ja ein 13-Jähriger auch genau aus diesem Grund so ein geeigneter Erzähler für dieses Land. Mir kommt eine Artikelserie in den Sinn, die Karl Heinz Bohrer in den frühen Achtzigerjahren im Merkur veröffentlicht hat. Er malt sich darin aus, in eine von ihren Bewohnern verlassene Bundesrepublik zu kommen, und kann nicht fassen, wie provinziell und hässlich alles ist. Er geht in die leeren Restaurants und liest die Speisekarten: »Süße Schweinskeule in roter Fettsauce auf Rehfüßchen … Gebeizte Bodenseefelchen aus schierem Schier, nachgedunkelt durch Nierenblut« usw. Da wird er surrealistisch, würde ich sagen. Für Vegetarier müssen die Achtzigerjahre in Deutschland jedenfalls eine harte Zeit gewesen sein. Aber darum geht es Bohrer nicht. An seinen Fleischgerichten liest er den Zustand eines Landes ab, das den Sinn für Eleganz, für das Schöne verloren hat. Was in Paris die Boutiquen sind, sind in Bielefeld die Metzgerläden. Und es stimmt ja: Es ist eine merkwürdige Erfahrung, hinter einem deutschen Rentner in der Schlange beim Metzger anzustehen. Bis er seinen Aufschnitt und seine Sülze ausgesucht hat, kann man schnell noch zum Bäcker gehen. Was ich weniger nachvollziehbar finde, ist, wie mühelos Bohrer von der Hässlichkeit von Bielefeld zum Mangel an politischem Bewusstsein gelangt. Der schlechte Geschmack, den er auch am neuen Kanzler Helmut Kohl festmacht, hat für ihn nämlich mit dem Abgang von der Bühne der großen Geschichte zu tun. Duodezfürstentum, Kleinstaaterei, die alte deutsche Krankheit. Nur zwischendurch, von Bismarck bis Hitler wahrscheinlich, habe man einen Sinn für das Politische und für Feindschaft entwickelt. Doch die Westdeutschen sehnen sich nach einer Biedermeier-Idylle zurück. Das ist für Bohrer das Provinzielle.
W: Auf der einen Seite existiert in der Provinz der Wunsch nach dieser Biedermeier-Idylle, und teilweise ist die Provinz natürlich auch idyllisch, wenn man ihr die Stadt als Gegenentwurf gegenüberstellt oder die Industriegebiete, die sich irgendwo zwischen Provinz und Stadt befinden. Auf der anderen Seite braucht die Provinz die Stadt, um überhaupt zu einem Begriff der Idylle kommen zu können, aber auch um sich von der Tristesse zu befreien, die immer mit in einer Idylle steckt. Wenn Idylle das Ungestörte, Ungetrübte ist, dann drängt sich quasi zwangsläufig eine gewisse Zeitlosigkeit auf, ein Gefühl von Ewigkeit und natürlich auch Gleichförmigkeit. Da Idylle, um Idylle sein zu können, keine Bedrohung kennen darf, kennt sie umgekehrt auch keine Entwicklung und Veränderung. Alles bleibt so, wie es immer war. Und eben das hält nicht jeder aus. Da erscheinen dann die Unruhestifter, die etwas spüren, was die Gemeinschaft anscheinend nicht spürt, und die ganz bewusst gegen das Idyll als Ausdruck des Falschen, weil angeblich Vollständigen, vorgehen. Und die haben dann in der Regel die Idee der Stadt im Handgepäck, der Unruhe und Bewegung, der Veränderung, aber auch natürlich der Anonymität und des drohenden Untergangs, von dem die Städte-Romane geprägt sind, die es auf der anderen Seite gibt. Döblins Berlin Alexanderplatz, um jetzt mal den bekanntesten zu nennen. Gibt es dort nicht umgekehrt eine Verheißung der Provinz, wo man zur Ruhe kommen und Frieden finden kann?
F: Auch Christiane F. hat, wenn ich mich richtig erinnere, zwischendurch mal den Gedanken, mit ihrem Freund Detlef aus West-Berlin abzuhauen und irgendwo auf dem platten Land nochmal von vorne anzufangen. Das ist aber natürlich nicht mehr als eine kurzlebige Junkie-Euphorie. Vielleicht ist das Buch übrigens die Ausnahme, die die Regel bestätigt: die Geschichte einer westdeutschen Jugend, die nicht auf dem Land, sondern in der Großstadt spielt. Ich habe das Buch mit 12 oder 13 heimlich unter der Bettdecke gelesen. Vor West-Berlin hatte ich seitdem eine Höllenangst. Kurze Zeit später bekam mein Vater das Angebot, beruflich nach West-Berlin zu gehen, aber zu meiner großen Erleichterung wurde daraus nichts und wir sind in Nikolausberg bei Göttingen geblieben. Dass das Provinz sein könnte, davon hatte ich genau wie der Protagonist deines Buches keinen Begriff.
W: Als Kind sind einem solche Begriffe ohnehin fremd. Man erfährt sie erst einmal als Zuschreibung von außen, so wie mein Protagonist auch erstaunt ist, als man ihm sagt, dass er in der Diaspora lebt. Vielleicht ist das fehlende Selbstverständnis ein weiteres Kennzeichen der Provinz, und wie ein Pubertierender braucht sie die ständige Selbstvergewisserung. Das würde dann auch deine Frage vom Anfang beantworten, warum Adoleszenzromane vornehmlich in der Provinz spielen: Die Provinz bildet das fehlende Selbstverständnis und die beständigen Zweifel des Aufwachsenden noch einmal außen ab. Aber so, wie die Provinz die Großstadt braucht, so braucht eben auch die Großstadt die Provinz, nur weiß sie selbst nichts davon, sodass man vielleicht verkürzt sagen könnte: Die Provinz weiß nichts von sich und schaut nur auf das andere, während die Stadt nichts vom anderen weiß und nur auf sich schaut. Dann wäre die Provinz im doppelten Sinne unerkannt, vor allem aber auch die Beziehung zwischen Provinz und Stadt, die in einer Art einseitiger mittelalterlicher Anschauung steckengeblieben ist, wo alles zur Stadt drängt, weil Stadtluft frei macht. Provinz wäre dann eine Art Atavismus, eine Vorstufe zur Stadt, Provinz ist das, was noch nicht Stadt ist, so wie der Pubertierende noch nicht erwachsen ist. Sie bleibt dann als sentimentale Erinnerung an eine verlorene Kindheit, die man sich als Fototapete in die engen und niedrigen neuen Wohnzimmer der expandierenden Städte hängt: ein Wald, eine kleine Flusslandschaft, so etwas. Ich komme darauf, weil ich gerade neulich ein altes Kinderfoto von mir gefunden habe, auf dem ich genau vor so einer Tapete an einer Kaffeetafel sitze. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass meine Eltern auch so etwas im Wohnzimmer hatten, etwas dilettantisch drübergeklebt über die alte Tapete. An irgendeinem Sonntag wurde dieses Foto gemacht in dem beklemmenden Wohnzimmer, das selbst in einem Ort inmitten der Provinz liegt. Aber dennoch holt man sich die Natur rein, quasi als Re-Import, weil man die Modeerscheinungen der Stadt imitiert, aber auch weil die Provinz das Idyllische gerade verliert durch die Industrialisierung, Verödung, Anfänge des Waldsterbens.
F: War das ein deutscher Wald auf der Tapete oder ein Palmenstrand?
W: Es war kein Palmenstrand, sondern ein deutscher Wald, der da in einer Art Dopplung auftaucht, denn im Grunde sah es hundert Meter weiter gar nicht so viel anders aus. Es drängt sich die Vermutung auf, dass man auch die Idylle einem gewissen Praxisgedanken unterwerfen wollte, sie jederzeit verfügbar machen, sterilisieren und von jeder Bedrohung befreien. Der Wohnungsbau, der in den Fünfzigerjahren anfing, war ja vor allem auf Funktionalität ausgerichtet, dafür hat man dann eine gewisse Enge, diese niedrigen Decken und schmalen Zimmer, in Kauf genommen. Überhaupt diese Ausrichtung auf Funktionalität in den Fünfzigerjahren: Man kam dann auf die Idee, alle möglichen Dinge miteinander zu verbinden, Kopplungen, die man für praktisch hielt, zum Beispiel diese Servierschalen mit verschiedenen Ebenen, Stangen und Behältern für Salzstangen und Brezelchen und so weiter. Dann so etwas wie die Durchreiche, die in meinem Roman eine große Rolle spielt. Die Durchreiche als Einzug des Taylorismus in den Privathaushalt, weil man auch privat von der Überlegung getragen wurde: Wo kann ich eine Minute an Zeit sparen? Wir haben eigentlich immer nur in der Küche gegessen, aber es war wichtig, dass diese Durchreiche existierte, zumindest als Möglichkeit. Tatsächlich wucherte die dann langsam zu, weil Zeitungen hineingelegt wurden.
F: So wie sich die Bewohner von Corbusier-Bauten Mühe gaben, ihre kalten modernistischen Wohnungen in Höhlen zurückzuverwandeln. Das wäre auch mal eine interessante Geschichte: der Guerillakampf gegen die architektonischen Zumutungen der Moderne. Die Natur und das Unverbrauchte werden ja erst in dem Moment interessant, wo man aufhört, in einem Dorf zu wohnen, wo sich die Speckgürtel ausbreiten und wo eine Gegend flächendeckend vorstädtisch wird. Genau so bin ich auch aufgewachsen. Die Sehnsucht nach Landschaft als Kompensation der industriellen Welt. Auch Heideggers Hütte stand nicht im tiefen Wald, sondern da waren Nutzflächen und Aufforstungsgebiete drumherum. Das Dörfliche, Bäuerliche war zumindest in den Sechzigerjahren schon eine Projektion. Heute gibt es da ein Skigebiet, und das Neubauviertel von Todtnauberg wächst an die Hütte ran. Das hätte sich Heidegger nicht träumen lassen, die Gegend ist inzwischen total verbaut. Auch in der Provinz ist die Natur längst in eine exotische Ferne gerückt. War auf den ersten Fototapeten der BRD eigentlich der deutsche Wald zu sehen? Ich kenne eine Kreuzberger Kneipe, die haben noch eine wunderbare alte Fototapete mit einem Buchenwald drauf. Der Tropenstrand kam wahrscheinlich erst in den Jugendzimmern der Siebzigerjahre auf.
W: Könnte man vielleicht sagen, dass es einen Punkt gibt, an dem der deutsche Wald als Idyll auf der Fototapete nicht mehr ausreicht? Wo man zum einen merkt, den gibt es in seiner reinen Idylle gar nicht mehr, man aber zum anderen auch das mit ihm verbundene Grauen, die Bedrohung, die in ihm existiert, ausschließen muss? Denn wenn du diese Kreuzberger Kneipe mit dem Buchenwald beschreibst, dann denkt man natürlich auch gleichzeitig an das andere Buchenwald, während man mit den Palmen erstmal gar nichts anderes verbindet, nur blauen Himmel und Urlaub, denn der Kolonialismus liegt ja bereits etwas länger zurück. Und könnte man den beginnenden Tourismus nicht ähnlich interpretieren, als Fluchtbewegung raus aus einer kontaminierten und deshalb nicht mehr wirksamen Idylle? Es hieß ja immer, endlich konnten sich die Deutschen was leisten, endlich mal reisen, aber vielleicht hielt es ein Teil der Bevölkerung schlicht und einfach nicht mehr aus in der BRD, während der andere nach wie vor fröhlich durch die Gaue wanderte.
2. Narrative der Bundesrepublik
F: Wir wollen über die alte Bundesrepublik reden und kommen ständig auf die Nazis zurück. Das bringt mich zu unserem eigentlich Thema. Was Karl Heinz Bohrer über die Entpolitisierung und die daraus resultierende Spießigkeit der Westdeutschen schrieb, kennt man ja in vielen unterschiedlichen Varianten. Die bekannteste ist wahrscheinlich von Florian Illies, der in den Neunzigerjahren dafür den Begriff von der »Generation Golf« erfand: Als man mit dem Playmobil-Piratenschiff samstagabends in der Badewanne saß und sich auf Wetten dass..? freute, war die Welt in Ordnung. Aber sie war laut Illies eben auch ziemlich sinnentleert. Ich habe den Eindruck, dass die historische Bilanz der BRD bis heute vor allem anhand dieses Narrativs gezogen wird. Ob man dabei von »Entpolitisierung« oder von »Demokratisierung« spricht, hat mit der Generation und der politischen Überzeugung zu tun. Wer »Demokratisierung« sagt, sieht kein Biedermeier, sondern einen Zivilisationsprozess, in dem die Deutschen lernten, das Politische nicht mehr von der Feindschaft, sondern von der Verständigung aus zu denken. »Geglückte Demokratie« oder »Ankunft im Westen« sind die Schlagworte der Historiker für diesen Prozess. Ihnen liegt nicht daran, das westdeutsche Idyll als Kompensation oder als Verblendungszusammenhang zu entlarven, sondern es bekommt dann so etwas wie einen realhistorischen Kern. Die alte Bundesrepublik war das Land, in dem die Deutschen lernten, dass man miteinander diskutieren kann. Auch die Schere zwischen Arm und Reich klaffte noch nicht so weit auseinander wie seit Hartz IV. Gegenwärtig kann man aber etwas anderes beobachten. Seit einiger Zeit begegnet mir eine neue Faszination für die alte Bundesrepublik. Von ihrem biederen oder progressiven Charakter haben wir vielleicht genug gehört. So wie in deinem Buch tritt daher jetzt ein verstärktes Interesse an ihren Abgründen, am BRD Noir hervor. Es könnte gut sein, dass dieses Interesse mehr über unsere Gegenwart als über die alte Bundesrepublik verrät. Aber in einem Punkt trifft es sich mit den älteren Deutungen: Auch BRD Noir geht vom Motiv des Idyllischen aus.
W: Genau, es braucht die Vorlage des Idylls, in das dann das Ungeheuerliche, das Bedrohliche einbricht. Als du gerade Bohrer zitiert hast, es fehle der Sinn für Feindschaft, da musste ich unwillkürlich an PEGIDA denken. Geht es denen nicht genau darum: um einen Erhalt von Idyll, von der Vorstellung des Idylls? Die denken, wenn da drüben Flüchtlinge einziehen oder überhaupt Andersdenkende, dann macht das unser Idyll kaputt, dieses Idyll, das sie unter Umständen gar nicht zu nutzen wissen, unter dem sie vielleicht sogar leiden, sodass sich gerade aus dem Idyll eine Form der Feindschaft entwickelt. Allerdings trifft diese innerhalb des Idylls auf eine Unfähigkeit, artikuliert zu werden, nämlich als einfache Differenz, als relativ normale und banale Erscheinung innerhalb der politischen Auseinandersetzung. Und mit dieser Fixierung auf das Idyll kann Schönheit nicht empfunden werden, weil man das Andere der Schönheit ausschließt und stattdessen in den Kitsch abgleitet, den man vielleicht als das Falsche der Schönheit definieren konnte, weil man versucht, Schönheit ohne das Hässliche, das Unschöne zu denken. Und Bohrer hat insofern in diesem Zusammenhang Recht, dass Feindschaft auch nicht gedacht werden kann, weil man diesen Kitsch, diese Verdrängung verteidigt und alles bekämpfen muss, was einen unter Umständen an das Andere erinnert und das Idyll infrage stellt. Feindschaft denken, würde ja heißen, einen Gegner erstmal zu akzeptieren, deshalb kommt bei der Rhetorik der PEGIDA auch immer dieses Nölige zum Tragen, weil man sich allein schon durch die Existenz eines Gegners beleidigt fühlt. Daher auch immer dieser Spruch: »Man wird doch wohl noch sagen dürfen …«, in Wirklichkeit heißt der: »Warum sagen nicht alle dasselbe wie wir? Warum gibt es überhaupt andere Meinungen als unsere?« Und vielleicht ließe sich hier sogar eine generelle Unterscheidung zwischen den alten Mustern von links und rechts aufmachen, dass die Rechte schon die Existenz des Gegners als persönliche Kränkung empfindet und dann entsprechend auf eine völlige Vernichtung, Ausrottung, Ausgrenzung drängt.
F: Es gibt Leute, die behaupten, PEGIDA gebe es auch, weil den Ostdeutschen – anders als den Westdeutschen nach 1945 – nach der Wende niemand beigebracht hat, wie Demokratie funktioniert. Ob man dafür eine Idee von Feindschaft benötigt, oder ob man die gerade überwinden muss, darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander. Aber lass uns zum Noir zurückkommen. Ursprünglich ist das ja ein amerikanisches Genre, das Autoren wie Raymond Chandler und Regisseure wie Otto Preminger oder Billy Wilder in Kalifornien entwickelt haben. Dass wir dafür den französischen Ausdruck noir verwenden, liegt daran, dass der französische Filmkritiker Nino Frank diesen Begriff 1946 zum ersten Mal für die neuen amerikanischen Filme verwendet hat. Die Heimat des Noir ist aber nicht Paris, sondern Los Angeles, die Stadt der Engel und der Sonne, wo der amerikanische Traum immer schon am schönsten war. Und genau deshalb, weil Los Angeles die strahlende Zukunft oder vielleicht besser die Verheißung des Kapitalismus verkörperte, konnte es so kaputt und so unheimlich werden wie sonst eigentlich keine andere Stadt.
W: Und wie könnte man dieses Noir auf die BRD übertragen?
F: Wenn ich dein Buch lese, finde ich, dass dieser Schritt eigentlich naheliegt. Auch die frühe Bundesrepublik war ein Land, das seinen Bewohnern eine bessere Zukunft versprochen hat, und außerdem war sie ein sicheres, geordnetes, demokratisches Land, ideal, um Kinder großzuziehen. Bei den Historikern überwiegt bis heute das Erstaunen: Nehmen wir mal Auschwitz im Jahr 1944, den Tiefpunkt des 20. Jahrhunderts. Wie war es möglich, unter dieser Voraussetzung, dass innerhalb von ein paar Jahren ein so gut funktionierender und prosperierender Staat entstand?
W: Innerhalb von zehn Jahren. 1955, habe ich gerade neulich gehört, war der Höhepunkt des Wirtschaftswunders. Und das ist ja zufällig auch mein Geburtsjahr. Ich komme auf dem Höhepunkt des Wirtschaftswunders auf die Welt, alles scheint ausgeräumt, eine Welt, wie du sie gerade beschrieben hast, eine Welt, die funktioniert. Und genau das ist ein Topos im Film-Noir. Man wird am Anfang immer zuerst einen Schwenk über eine Vo...