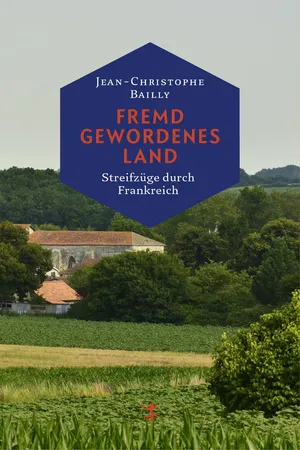
- 464 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
In seinem philosophisch-literarischen Großessay führt Bailly die Beobachtungen und Reflexionen aus seinen Reisen auch in entlegene Gegenden Frankreichs zusammen, immer mit dem Ziel, die Identität der Republik zu erfassen und die in ihr gespiegelte Landschaft und Gesellschaft auf seine Weise zu kartografieren. Landschaftsbuch, Soziogramm und Reportage in einem, führt er uns von einer Fabrik für Fischernetze im alten Bordeaux zu Rodins Atelier in Meudon, von einem Karpfenteich in Fontainebleau, an dem Franz I. schon spielte, bis zu einem Gehöft in Roche, das 1918 von Deutschen gesprengt worden war. Bailly lässt sich führen und verführen von Leuten und Flüssen, Geschichten und Geschichte und legt ein buntes Mosaik des heutigen Frankreich.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Fremd gewordenes Land von Jean-Christophe Bailly, Andreas Riehle im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Persönliche Entwicklung & Reisen. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1. Einführung
Das Thema dieses Buches ist Frankreich. Es geht darum zu verstehen, was dieses Wort heute bezeichnet und ob es zutrifft, dass es etwas bezeichnet, was per se anderswo nicht existieren könnte, jedenfalls nicht so und nicht in dieser Weise. Um mich diesem Knäuel aus ineinander verstrickten, doch oftmals widersprüchlichen Zeichen anzunähern, das Geografie und Geschichte, Landschaften und Leute formen, kam ich auf die Idee, mich einfach an Ort und Stelle umzusehen, anders ausgedrückt: das Land zu bereisen oder wieder zu bereisen. Der Stoff für dieses Buch besteht also zunächst aus den Erkundungen, die ich an verschiedenen Orten des französischen Staatsgebiets gemacht und vorwiegend deshalb ausgewählt habe, weil sie das Motiv in Schwingung versetzten, entweder weil sie für mich Kristallisationspunkte des inneren Gefüges der Nation zu verkörpern schienen oder, im Gegenteil, weil sie am Rande lagen. Ich möchte betonen, dass es ein inneres Gefüge ohne Rand nicht geben kann.
In engem Bezug zu diesen Erkundungen entstand dieser Text zwischen Frühjahr 2008 und Herbst 2010. Die Idee, ihn zu schreiben oder zumindest etwas Derartiges zu versuchen, lag hingegen viel weiter zurück und hatte bereits eine lange Entwicklung erfahren, für die zwei Etappen entscheidend waren.
Die erste Etappe reicht weit in die Vergangenheit zurück: Sie ist sogar die entfernteste Schwelle, an der ich die Idee des Buches aufkeimen sehe. Auch wenn ich es nicht mehr auf den Tag genau weiß, so ist doch sicher, dass sie sich zwischen 1978 und 1979 ereignete, also in den Jahren, in denen ich New York entdeckte und alles daransetzte, um möglichst lange dort zu bleiben. Jedenfalls war ich bereits einige Wochen dort, als in einer Wohnung, in der im Fernsehen Jean Renoirs Film Die Spielregel in der Originalfassung lief, dieser Film (ich erinnere mich lediglich an das Schwarzweißbild ohne jegliche Größe oder Rand) völlig unerwartet wie eine Offenbarung auf mich wirkte. Nicht, weil ich ihn damals entdeckt hätte (ich hatte ihn nämlich schon gesehen, dessen bin ich mir sicher), sondern weil ich durch ihn, durch diesen Film also, der zweifelsohne vor allem ein Kinoklassiker ist, zu meiner großen Überraschung die Offenbarung einer Zugehörigkeit und einer Vertrautheit erlebte. Dieser durch und durch französische Film, den ich mir in New York ansah, gab also ausgerechnet mir zu verstehen, der ich doch im Grunde solche Gedanken nie verfolgt hatte, dass seine verarbeitete Materie (die Jagd, der Nebel, die Sologne, das Schilf, die Gesichter und die Stimmen, vor allem die Stimmen) die meine war, oder dass ich sie zumindest, und diese Nuance ohne Besitzerangabe ist wesentlich, sozusagen mit jeder Faser kannte, besser oder gar schlimmer noch: dass ich von ihr abstammte.
In diesen Jahren, also noch direkt im Anschluss an den Mai 1968 und all jenes, was dieses Ereignis für eine gesamte Generation bedeutet hatte, war das Denken natürlicherweise nach außen gerichtet, und die Idee der Nation an sich war für all diejenigen, die sich in dieser Bewegung ein wenig konsequenter engagiert hatten, praktisch tabu – von vornherein und ohne eingehende Überprüfung. Selbst ohne Fortführung des Aktivismus im eigentlichen Sinne ließ man sich anlocken oder fühlte sich von etwas weiter Gefasstem angelockt, in dem jede Art von Herkunft, auch wenn man sie respektierte, weit zurückgestuft wurde hinter dem, was die Form eines Aufbruchs oder eines Ausbrechens aus seiner Welt annehmen konnte. Daher war mein Erstaunen groß, als ich diesen Film in New York sah und folglich innerhalb einer solchen Aussteigererfahrung entdeckte, dass es für mich eine Gemütsregung der Herkunft geben konnte.
Was ich in New York entdeckte, war natürlich nicht, dass ich Franzose war. Doch obwohl die Vorahnung existierte, dass diese Nationalität nichts rein Formelles war, sondern auch zahlreiche Inhalte besaß, hätte ich damals keinesfalls anerkannt, wie komplex sie waren und noch weniger, dass sie in meinem Inneren ohne mein Wissen einwirkten. Eben jenes unterschwellige, innerliche Einwirken, das mir meine Gemütsregung angesichts von Die Spielregel offenbart hatte. Sobald man aber in Renoirs Film etwas durch und durch Französisches erkannt hat, stellt man gleichwohl fest, dass alles, was man jenseits der Eindeutigkeit oder gar der Tautologie handhabt, rätselhaft bleibt. Mit welchem Recht kann man »durch und durch französisch« sagen? Mit welchem Recht kann man es von diesem Film und im Allgemeinen von einer Landschaft, einer Szene aus dem Alltagsleben, einem Erzeugnis aus dem Handel oder einem Buch behaupten? Hat dies überhaupt einen Sinn, eine Notwendigkeit, wo es doch so entmutigend ist, mit niederschmetternder Regelmäßigkeit einen ganzen Wust von Allgemeinplätzen hervorschießen zu sehen – von den schlimmsten, deren ausschließlicher Bezugswert die Ideologie ist (das »Land der Freiheiten« zum Beispiel) bis zu den lediglich zweifelhaften, die eine gewisse selbstverliebte Denkfaulheit verbreiten, von gastronomischen Meisterleistungen bis zu der Tatsache, die Franzosen seien Cartesianer?
Ob ein Land, dieses Land, also so sehr es selbst ist, wissen wir im Grunde nicht. Sodann wird es unerlässlich, sich selbst dort umzusehen und zu verstehen, wie die Textur dessen beschaffen sein mag, was ihm eine Existenz verleiht, das heißt Eigenschaften, Eigentümlichkeiten, und zu sondieren, was es geformt, ausgeformt, deformiert hat. Eben weil manche glauben, dies existiere wie ein feststehendes Gebilde oder eine Essenz, und sich folglich anmaßen, Zertifikate auszustellen oder gar auszugrenzen (als ich dieses Buch verfasste, sollte ein »Ministerium für nationale Identität« ins Leben gerufen werden, eine Absurdität, die, wie zu erwarten war, eine Reihe von eindeutig fremdenfeindlichen Maßnahmen nach sich ziehen sollte), ist es notwendig, sich auf den Weg zu machen und an Ort und Stelle zu überprüfen, wie es darum bestellt ist. Diese Aufgabe fügte sich für mich in eine schlichtere und umfassendere Neugier, die sich aus einer anderen Feststellung ergab, nämlich, dass ich von diesem Land, das allem Anschein nach das meine war, im Grunde nur schlechte Kenntnisse besaß oder sie jedenfalls zu allgemein, zu schematisch oder zu konfus waren.
Die Idee, eine Liste der aufzusuchenden Orte oder der einzuschlagenden Wege zu erstellen, kam mir, nachdem ich meinem (damals künftigen) chinesischen Schwiegervater einen Besuch abgestattet hatte. Diesen Besuch betrachte ich als zweite Etappe, den zweiten Auslöser, der mich zu diesem Buch führte. Wir befinden uns am Anfang der 90er Jahre in der Umgebung von Lyon. Damals arbeitete ich häufig in Lyon (eigentlich eher in Villeurbanne, am dortigen Theater TNP, mit Georges Lavaudant und seinem Ensemble), und da Gilberte, meine Frau, zu beschäftigt war und nicht zu ihm fahren konnte, schlug ich ihr vor, an ihrer Stelle ihren Vater in einer Reha-Klinik in der Umgebung der Stadt zu besuchen. Dieser Chinese, der aus der Provinz Zhejiang stammte (»Tschekiang« bleibt für mich, daran kann ich nichts ändern, die »richtige« Umschrift) und von dort in den 1930er Jahren eingetroffen und nach Ende des Krieges dann in Lyon sesshaft geworden war, hatte sich kurz zuvor einer Operation wegen eines Krebsleidens unterzogen, an dem er einige Jahre später sterben sollte, und befand sich deshalb in dieser Einrichtung. Obwohl dieses in Pollionnay am Rand der Monts du Lyonnais gelegene Haus kaum weiter als 20 Kilometer von Lyons Stadtkern entfernt war, stellte ich fest, dass die Fahrzeit dorthin mit dem Bus sowie das Umsteigen am Busbahnhof in Gorge-de-Loup in etwa so lange dauerte wie die Fahrt mit dem TGV von Paris nach Lyon. Als er mich erblickte, war die Überraschung dieses Mannes, den ich zuvor nicht benachrichtigt hatte, groß. Ich glaube, er freute sich sehr, und während meines Besuchs legte er eine gewisse Fröhlichkeit an den Tag. Er sagte sogar mit seinem starken chinesischen Akzent, die anderen Insassen seien »Trantüten«, weil sie nicht einmal Belote spielen könnten. Ich sehe ihn noch heute vor mir, mager, elegant, mit Augenbrauen wie Zhou Enlai, wie er mir zum Abschied leicht zuwinkte.
Ich erinnere mich jedoch weniger an die Form des Gebäudes oder die Atmosphäre der Räume und Gänge, sondern vielmehr an die Eindrücke bei meiner Ankunft an diesem Wintertag auf der großen Terrasse, die einen weiten Rundblick auf die Landschaft mit ihren recht hohen Hügeln der Monts du Lyonnais bot. Obwohl ich eher mit einer Abfolge etwas bedrückender Bilder gerechnet hatte, die derartige Reha-Kliniken meistens auslösen – ein Greis, der sich in einem beigefarbenen, mit Grünpflanzen und Postern impressionistischer Gemälde verzierten Gang mühsam an seinem Rollator vorwärts schleppt, eine Gruppe alter Frauen im Morgenmantel, die angestrengt einen Kräuter- oder nach Pappe schmeckenden schwarzen Tee in einem Speisesaal schlürfen, in dem ein von niemandem beachteter geschmückter Weihnachtsbaum endlos vor sich hin glimmert –, befand ich mich inmitten einer Art Winterverklärung: Es war jedoch keiner von den Tagen, deren goldenes Licht die Tiefenwirkungen hervortreten lässt, sie dabei aushöhlt, und jedem Gegenstand für einen Augenblick lang das Aussehen gewährt, als sei die Zeit aufgehoben, sondern ein Tag, wie es sie ja noch seltener gibt, an denen das Zusammenspiel von Nebel und Sonne eine Art Emulsion ergibt, die einem Medium aus zerstäubtem Licht ähnelt, in dem alles zu wogen und mit einem Glorienschein umgeben zu sein scheint, und die Weitsicht, auf die man doch im Allgemeinen Wert legt, durch die heitere, ausgelassene, jugendliche und zugleich alterslose Bestätigung reiner Strahlung ersetzt wird.
Was sich mir an diesem Januarmorgen aufdrängte und auch mit dem restlichen Besuch in keinen Widerspruch trat, war das Gefühl eines Orts der Genesung, einer Art volkstümlichen Pendants zum Zauberberg, ohne jedoch mit einer gedanklichen Anstrengung oder einer Reflexion aufzuwarten, sondern mit der Spontaneität und der Ungezwungenheit einer plötzlich vernommenen Musik. Nach dieser Verblüffung über die Evidenz dieses virtuellen Romans kam ich zu der Gewissheit, dass ganz Frankreich von derartigen Romanen gespickt sei und es deswegen verdient habe, neu bereist zu werden, nicht etwa, um mein Gewissen zu beruhigen, sondern weil sich aus diesen Momenten ein eindringlicher Widerhall der Wahrheit ergab. So kam mir die Idee, eine Liste jener Orte zu erstellen, von denen ich derartige Überraschungen erwarten konnte: Es waren die Orte selbst, die mir ihre Signale schickten, und dies taten sie umso eindringlicher, als ich öfter als früher, auch dank meines neuen Lehrauftrags (ab 1997) an der École nationale supérieure de la nature et du paysage in Blois durch das Land fuhr (eine Arbeit, von der man in diesem Buch so manches Echo vernehmen kann) und von dem Bedürfnis getrieben war, wie ein Musikschüler die Partitur, die ich vor mir hatte, zu entziffern.
Wie ich es für mein Buch über Sprache getan hatte, in dem ich Sachbegriffe ausgewählt hatte, begann ich zunächst ungeordnet und improvisiert, dann koordinierter, wie ein Programm, eine Liste mit Orten zu führen, die es zu besuchen oder wiederzusehen galt und die sich dafür eigneten, ebenso viele Kapitel zu bilden. Die Reha-Klinik in Pollionnay war natürlich der erste von ihnen, doch letztlich bin ich nicht dorthin zurückgekehrt, in der Überzeugung, dass das, was ich dort flüchtig zu Gesicht bekommen hatte, an einem seidenen Faden hing, der seither gerissen war. Ganz unterschiedlich war übrigens das Schicksal der Orte, die auf dieser erweiterbaren und immer aufs Neue mit Streichungen versehenen Liste standen: Während manche tatsächlich zu (Entdeckungs- oder Wiederentdeckungs-)Reisen Anlass gaben und dann zu Kapiteln dieses Buches wurden, sind andere unterwegs verworfen worden. Vor allem jedoch haben andere, die anfangs nicht vorgesehen waren, sich aufgedrängt, eine Logik wie beim Übereinanderschichten von Dachziegeln – wobei das eine Kapitel das nächste nach sich zieht – hatte sich herausgebildet, sobald der eigentliche Schreibprozess begonnen hatte.
Was die literarische Gattung anging, so bestand mein Wunsch, der sich allmählich klarer und deutlicher abzeichnete, schließlich darin, ein kaleidoskopisches Buch zu schaffen, das unterschiedliche Schreibgeschwindigkeiten in Gang setzt, in mancher Hinsicht einem Essay, zuweilen auch einem Logbuch, einer Erzählung, einer Abschweifung und zeitweise gar einem Prosagedicht und sonst noch allem Möglichen ähnelt, dem jedoch eine schonungslosere Vorgabe zugrunde liegen möge – nicht der Realismus natürlich (keiner glaubt mehr daran), sondern der Wunsch, dass die Sprachgestalt ganz unabhängig von ihrer Ausarbeitung so genau wie möglich dem von außen her diktierten Text entspreche, der von den angetroffenen Gegenständen herrührte. Das nicht auf Wörtern fußende Vorbild wäre hier die Fotografie mit ihrer indiziellen Substanz, und der kleine überallhin mitnehmbare Bildschirm von Digitalgeräten gehört in diesen Bereich. Eine bewegliche oder bewegte Tätowierung, die für das Schreiben dennoch eine Herausforderung ist, denn die Falle unter den Wörtern, die durch die Linearität von Sinnartikulierung immer gestellt bleibt, ist diejenige einer ungewollten rhetorischen Umarbeitung.
Unterwegs holte mich die Geschichte mit ihren kleinen und großen Erzählungen, ihren einfachen Sinnblasen und ihrer steifen Brise ein und nahm eine Bedeutung an, die ich zunächst nicht vorgesehen hatte. Doch was auf diese Weise auf mich einströmte, war nicht die Geschichte aus Schulbüchern oder Reiseführern, sondern etwas, das man eine Geschichte der Spuren nennen müsste, in der die Gegenwart das Zutagetretende wäre. Sofern man die Gegenwart mit ein wenig Nachdruck betrachtet, erscheint sie letztlich immer als unendlicher und dennoch untiefer Raum, in dem mitunter weit zurückliegende Spuren ihres Entstehens wie durch einen nicht wahrnehmbaren Wiederaustritt langsam emporsteigen. Umgekehrt aber versinken die Signale, mit denen der Gegenwart all das beschieden wird, was sie auflöst und erneuert, allmählich in ihr, bohren sich in sie hinein und gelangen sogar weit darüber hinaus. So unternahm ich den Versuch, in der Weite einer Landschaft, die diese Gegenwart mal abfedert, mal beschleunigt, dieser wechselseitigen Bewegung aufzulauern und dabei im Vorbeigehen festzuhalten, was man die bewegliche Momentaufnahme eines Landes nennen könnte.
2. Reusen, Flaken, Elger usw.
Bordeaux, Maison Larrieu, Rue Sainte-Colombe Nummer 51, zwischen dem Glockenturm von Saint-Éloi und dem Cours d’Alsace-et-Lorraine. Jean-Louis Larrieu, der heutige Direktor der Firma – es handelt sich eigentlich um eine Fabrik – hört es nicht gern, wenn man von einem »Geschäft« spricht. Als solches kündigt sich dieses Stammhaus aber durch seine in den Schaufenstern zur Straße hin ausgestellten Artikel an und wirkt auf davor anhaltende Passanten ein: Denn alles dort, was man vor sich hat und worüber man mutmaßt, ist außergewöhnlich. Ich kenne jedenfalls nichts Vergleichbares in Frankreich oder Europa. Es handelt sich um eine Fabrik für Netze, Reusen und im weiteren Sinne für alles, was dazu dient oder dazu dienen könnte, lebende Tiere zu fangen oder anzulocken und zu sich zu ziehen: eine unerschöpfliche Ansammlung von Gegenständen, die mit Jagd und Fischfang zu tun haben (obwohl die Netze auch einige andere Funktionen erfüllen, zum Beispiel auf Baustellen) – Gegenstände also, die auf den ersten Blick keine Sympathie erwecken, sind sie doch direkte Ergebnisse des menschlichen Willens, zu beherrschen und zu dominieren. Ja, aber was sich schon von der Straße aus, von dieser Straße der Altstadt in Bordeaux, aufdrängt und ins Auge springt, ist eine von der Landschaft durchdrungene Wissenschaft, Strategien der List und des Dechiffrierens, nahezu unbekannte und geheime Affekte, gebunden an als Reviere empfundene und seit Jahrhunderten durchquerte Orte: Lockpfeifen, die Drosseln, Wachteln oder Wildschweine imitieren, Schmetterlingsnetze, Seile, Fangnetze und andere Werkzeuge für das Wattfischen, doch vor allem Netze und Reusen in allen Größen und Formen, mit großen oder kleinen Maschen, streckbar, biegsam, gelenkig.
Für den Fischfang also, und nur dafür, gibt es in der Kategorie Netze Spiegelnetze, Flaken, Ringwaden, Senker und Wurfnetze und in der Kategorie Reusen, neben Gründlingssäcken, aus denen die kleinen Fische nicht mehr entwischen können (so etwas wie ein Nullpunkt der Reuse), sämtliche Varianten, die dieser oder jener Fischart angepasst sind (man fängt Aale nicht wie Neunaugen oder Tintenfische), und vor allem Garnschläuche, diese gelenkigen, mehrere Meter langen Reusen – an der Decke des Geschäfts aufgehängt wirken sie wie biegsame mathematische Skulpturen: luftige, für die Tiefen des Wassers bestimmte Gegenstände, die für sich selbst stehen könnten, aber nur beflissene und stille Diener der listigen Intelligenz sind, der Metis, und zwar einer bäuerlichen Metis, gebunden an eine Landschaft, in diesem Fall mehr oder weniger an die Umgebung von Bordeaux: Denn selbst wenn die Maison Larrieu und das Geschäft (mit einer Fabrik im Finistère) auf ganz Frankreich und gar darüber hinaus ausstrahlen, so verbreitet diese Jahrhunderte alte Netz-Manufaktur mit ihrer gesamten Geschichte und was sie an Legenden in sich birgt vor allem eine Kenntnis, die in nahen und bekannten, tausendfach durchwanderten Gebieten verankert ist, wo Süßwasser nie weit vom Meer entfernt zu finden ist und die Gironde, hier nicht mehr die Garonne und noch nicht der Ozean, das Mündungsgebiet und die Schleusenkammer dieses Gleichgewichts bildet.
Diese Netze, Reusen und Garnschläuche erzählen jedoch vor allem von der Unendlichkeit der Struktur. Die Wiederholung der Maschen schreibt Formen in den Raum, die wie Versuche sind, ausgehend von festen Körpern Flüssigkeiten nachzuahmen. Um eben diese zu beschreiben, gab Salomon de Caus (nach dem in Paris am Square des Arts-et-Métiers eine Straße benannt ist) zu Beginn des 17. Jahrhunderts seinem Buch einen wunderbaren Titel: Les raisons des forces mouvantes, also: »Die Ursachen für wogende Kräfte«. Nun sind es eben diese Ursachen, um die es hier geht, und es sind diese Kräfte, die es einst zu erkennen und zu messen galt, damit jedes Netz und jede Reuse mit einer exakten Form übereinstimmte. Aus einer Welt der glatten Wasseroberflächen mit geheimen Strömungen und eingebetteter Kühle erhebt sich dank dieser eingetauchten Strukturen der Gesang des Mathems, und beim Betrachten dieses Geflechts aus geschmeidigen oder straffen Linien denkt man zwangsläufig an die Perspektive, ebenfalls eine Art von Reuse, mit deren Hilfe die Maler versucht haben, das Sichtbare einzufangen: dasselbe Paradoxon eines konvergierenden Parallelismus, derselbe Wille des Erhaschens, dasselbe Versteckspiel, dieselbe Hoffnung, etwas zu erfassen. Und was diese unmittelbare Nähe erzählt, ist vielleicht zunächst die Sinnlosigkeit, die menschlichen Tätigkeiten in eine manuelle und in eine intellektuelle Seite aufzuteilen – denn die Metis ist ihrem griechischen Konzept zufolge das, was die beiden Seiten in einer einzigen Falte vereint, für welche die Hand eben die Faltstelle wäre.
Hier soll keine simple Gleichung zwischen dem geometrischen Gitter eines perspektivischen Bildes und der Form einer Reuse, wo der gefangene Fisch genau auf dem Fluchtpunkt platziert wäre, aufgestellt werden. Einfacher wäre es zu sagen, dass in dem, was die Italiener einst die progettazione nannten, etwas Universelles liegt, also ein Raum, in dem man mehrere Positionsanzeiger frei bewegen und alle Anwendungsoberflächen variieren kann. Im Wasser und seinen »wogenden Kräften« wird dieser Raum zu einer biegsamen oder schwimmenden Perspektive und erzeugt für den Geist ein sehr markantes Muster.
Dies kann man sehen und ahnen, wenn man die Schaufenster der Maison Larrieu betrachtet, und deshalb ist es auch nicht belanglos, sich daran zu erinnern, dass die besagte Netz-Manufaktur 1622 von Baptiste Guignan gegründet wurde. Als Soldat von Ludwig XIII. hatte er während der Belagerung von La Rochelle Zeit totzuschlagen und sah den Fischern dabei zu, wie sie gekonnt ihre Netze woben. Bei seiner Rückkehr nach Bordeaux kam er auf die Idee, in der Rue des Ayres eine Werkstatt für die Herstellung von Netzen zu eröffnen, ganz in der Nähe der heutigen Adresse in der Rue Sainte-Colombe, zu einer Zeit, als im Hafen geschäftiges Treiben herrschte. Mit dieser Jahreszahl befinden wir uns ganz in der Nähe von Salomon de Caus und auch ganz in der Nähe des großen pe...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Inhalt
- 1. Einführung
- 2. Reusen, Flaken, Elger usw.
- 3. Le Bazacle
- 4. Die Reise der Fève
- 5. Culoz
- 6. Die Transparente von Carmontelle
- 7. Leichte Gärten, noch nicht einmal
- 8. Frankreich beginnt in Gentilly, Portugal
- 9. Passerelle du Cambodge
- 10. Rodins Atlantis
- 11. Karpfenteich, Cour des Adieux
- 12. Varennes oder Buzancy
- 13. Rimbaud davongestürmt
- 14. All gone into the world of light
- 15. Wie klein sie ist, die Seille!
- 16. Der Friedhof von Toul, die Synagoge von Delme
- 17. Noch mehr Grenzen
- 18. Diesseits die Wahrheit, jenseits ein Irrtum…
- 19. Vorstoß in den Ozean
- 20. In Lorient ist das Ende der Welt eine Straße
- 21. Beaugency, Vendôme, Vendôme …
- 22. Drac oder Tarasque?
- 23. Castellum Aquae
- 24. Resurgenzen der Loue
- 25. Eine Reise entlang der Vézère
- 26. Origny-Sainte-Benoîte: »… jedoch das Boot, es gleitet weiter«
- 27. Das Familisterium und der Tanz
- 28. Der Norden?
- 29. Groß war das Land der Häduer
- 30. Auf der Seite der Tiere (1)
- 31. Auf der Seite der Tiere (2), gefolgt von einer Anmerkung über Bäume
- 32. Sequenzen
- 33. Die Bariol-Hypothese
- 34. Fluchtpunkt
- Anmerkungen
- Bibliografie
- Filmografie
- Hanns Zischler – Nachwort
- Impressum