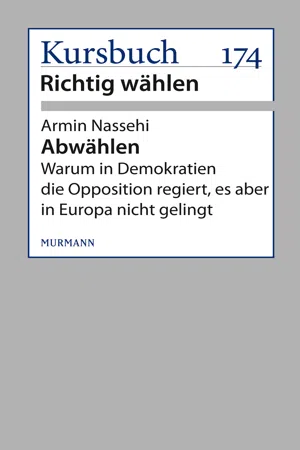Armin Nassehi
Abwählen!
Warum in Demokratien die Opposition regiert, es aber in Europa nicht gelingt
If voting changed anything, they’d make it illegal. Dieser Satz, in seiner deutschen Variante fälschlicherweise zumeist Kurt Tucholsky zugeschrieben, stammt von der amerikanischen Anarchistin Emma Goldman (1869–1940). Sie lehnte den Staat als organisierte Form von Politik ab und setzte auf die freie Assoziation im Sinne Proudhons und auf die Einsicht in die vorgängige Sozialität des Menschen im Sinne Kropotkins. Nun will ich hier nicht über den Anarchismus räsonieren, auch nicht über sein in der russischen/sowjetischen Revolution nachgerade ironisches Schicksal, denn staatszentrierter als der Stalinismus konnte die Entwicklung kaum ausgehen. Wenigstens an die Dementierung von Wahlen haben sich der Stalinismus und seine Nachfolger konsequent gehalten.
Doch der anarchistische Satz hat es in sich. Er nimmt nämlich wenigstens das semantische Versprechen der Demokratie ernst – er nimmt sie als Herrschaft des Volkes wörtlich und kann in Wahlen deshalb nur eine merkwürdige Form der Legitimationsbeschaffung der »Herrschenden« sehen, die sich von den Beherrschten wählen lassen. Das ist die merkwürdige Paradoxie der Demokratie, dass die Selben eben nicht die Selben sind. In der Demokratie fallen Herrscher und Beherrschte in eins – und sind doch nicht die Selben. Zwischen den Selben (Herrscher) und den Selben (Beherrschte) stehen letztlich Wahlen. Sie setzen an der Stelle an, die der Anarchismus völlig zu Recht aufs Korn nimmt: Wahlen suggerieren, dass das Volk herrscht, weil ja das Volk wählt. Aber das Volk wählt Leute, die ein Organisationsarrangement in Anspruch nehmen, kollektiv bindende Entscheidungen nicht nur zu fällen, sondern auch durchzusetzen. Wohlgemerkt: Es geht politisch nicht um kollektive Entscheidungen, sondern um kollektiv bindende Entscheidungen – und um Kollektive binden zu können, müssen sie durch Wahlen legitimiert werden.
Wahlen, so könnte man sagen, organisieren und begrenzen Partizipation. Sie organisieren sie, indem zumindest in der repräsentativen Demokratie Wahlakte knappgehalten werden (alle vier oder fünf Jahre) und die Art der Stellungnahme so stark formalisiert wird (SPD oder CDU oder FDP oder Grüne oder Linke oder Bibeltreue Christen), dass man sie quantifizieren und auf Nachkommastellen berechnen kann. Sie begrenzen sie, weil die Wahl diejenigen wählt, die dann das Geschäft der Herstellung und Umsetzung kollektiv bindender Entscheidungen besorgen, und das, was sie tun, sogar mit Macht ausstatten können. Dass nach dem nicht bezahlten Steuerbescheid irgendwann der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, wird nicht gewählt, aber durch Wahlen ermöglicht.
Hat Emma Goldman also recht? Sind Wahlen nicht eigentlich dazu da, die Leute vom staatlichen Handeln fernzuhalten? Was ist daran demokratisch, dass das »Volk« dazu gebracht wird, sich vom eigentlichen politischen Geschäft fernzuhalten? Und ist es nicht besonders perfide, dass es das auch noch selbst tut? Schafft die Demokratie sich durch Wahlen nicht letztlich selbst ab?
Demokratie? Oligarchie? Ochlokratie?
Dass die Demokratie, beim Wort genommen, eine problematische Herrschaftsform ist, hat bereits die griechischen Erfinder der Demokratie umgetrieben. Bereits Aristoteles hat in seiner Politik darauf hingewiesen, dass die Demokratie, verstanden als die bloße Mehrheitsherrschaft, zwar die Mehrheit zufriedenstellen kann, aber letztlich unter Kompetenzgesichtspunkten scheitern muss. Das Volk kann dann zwar wählen, aber ihm stehen keine sachlichen Kriterien zur Verfügung, man könnte sagen: kein geeignetes Expertenwissen, um das Richtige zu tun. Diese Kritik am bloßen Mehrheitsprinzip hat eine lange Tradition. Sie reicht tatsächlich von Aristoteles und dem griechischen Historiker Polybios, der die Ochlokratie, also die Herrschaft der Masse und des Pöbels anprangert, bis zu Alexis de Tocquevilles Kritik an der amerikanischen »Tyrannei der Mehrheit« oder der Kritik an ignorantem oder irrationalem Wahlverhalten, wie es etwa von Milton Friedman offensiv formuliert worden ist – Friedman meint damit natürlich vor allem, dass die Wähler ökonomisch ignorant und irrational seien.
Aristoteles hat konsequenterweise die Lösung in der Politie gesehen, einer Mischform aus Demokratie im Sinne des bloßen Mehrheitswillens und der Oligarchie politischer Entscheidungsträger. Diese Mischform erlaubt es der Mehrheit, durch Wahl der Entscheidungsträger einerseits mitzuentscheiden, andererseits vom Entscheidungsgeschäft ferngehalten zu werden. Wer Demokratie mit der unmittelbaren Herrschaft des Volkes verwechselt, muss enttäuscht werden, und das in einem doppelten Sinne. Zum einen ist die Demokratie nicht das, was sie rein begrifflich verspricht, nämlich die Herrschaft des Volkes, denn offenkundig ist das »Volk« nicht nur Ausgangspunkt der Herrschaft, son...