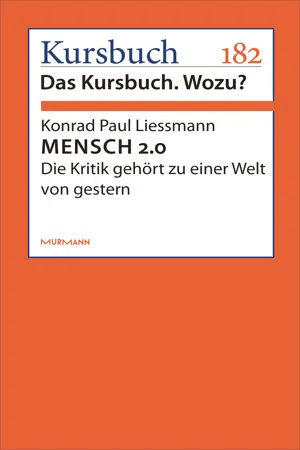Konrad Paul Liessmann
MENSCH 2.0
Die Kritik gehört zu einer Welt von gestern
In einer neuen und sehr schicken Kunstzeitschrift findet sich unter der Rubrik »Modestadt Berlin« und der Überschrift »Ästhetische Rivalität zwischen Punk und Techno« das Bild einer selbstbewußt-lasziven jungen Frau, im gestylten Straßencafé in einem Korbstuhl lehnend, malerisch mit Tuchresten und Fetzen drapiert, die Brüste kaum verhüllt, ein Weinglas vor sich. Es handelt sich, so erfährt der Leser, um die Jungdesignerin Darja Richter, eine Meisterschülerin von Wolfgang Joop, die mit einem selbstentworfenen Oberteil solcherart posiert; für ihr fahles Make-up zeichnet übrigens Odile Agée verantwortlich. Darja Richter, so erläutert der Kommentar, »versteht Mode als Diskurs über das Geschlecht« und verknüpft »die Formensprache des Punk mit Fragen nach der weiblichen Selbstdarstellung«, sie verwendet »überwiegend Filz, markiert mit aufgenähten Dreiecken und Kreisen Geschlechtsmerkmale oder entblößt sie«. Und auf der MODA 94 »kontextualisierte« sie mit einer parallel zur Entwurfspräsentation projizierten Dia-Show den »Zusammenhang zwischen Textilindustrie und Prostitution«.
Das also ist es, was nach der Postmoderne das ästhetische Bewußtsein markiert. Untrennbar fließen Kunst, Werbung, Design, Propaganda, Unterhaltung, Lebensgefühl, Mode, Kritik und Konsum ineinander. Versatzstücke der Moderne wie das aufklärerische Pathos, der Filz und die Sorge um Randgruppen kreuzen sich mit postmodernem Ästhetizismus, die sichtbaren Signale einstiger Protestbewegungen werden zu Markenzeichen, und industriell verordnete Freizeitekstasen mutieren zu einer neuen Kunst- und Jugendbewegung, die Geschlechterfrage darf nirgendwo fehlen, wer andere schminken kann, beansprucht die Aureole des Künstlers, und der diesbezügliche Verweis auf Baudelaire ist obligat. Und dort, wo man die schwache Vermutung hegt, daß bestimmte Dinge miteinander zu tun haben könnten oder zu tun haben sollten, wird auf Teufel komm raus kontextualisiert. Der einstige Kampfruf der Postmoderne – anything goes – scheint eine Selbstverständlichkeit geworden zu sein, noch immer laut und schrill, aber auch schon langweilig, so daß die Rückbesinnung auf die asketischen Ideale der Moderne nicht lange auf sich warten lassen kann. Wer zählen kann, der zählt und ist in der Gegenwart bei der Zweiten Moderne angelangt. Damit sind wir aber dort, wo wir schon einmal waren, und die kurz unterbrochene Projektarbeit kann also weitergehen: mit neuer Abstraktion und dem Lob der neuen Medien. War in der Postmoderne soviel Ende wie nie zuvor, so wird nach dem allgemeinen Postismus, den vielen Gesten der Verabschiedung, das Neo zur universellen Vorsilbe der Wiederkunft des Gleichen. Intime Kenner der Moderne aber wissen, daß die weltgeschichtlichen Wiederholungen so ihre Tücken haben: Auf die Tragödie pflegt die Farce zu folgen.
Aus: Kursbuch 122, »Die Zukunft der Moderne«, 1995, S. 21 f.
Ach, wie doch die Zeit vergeht. Und sie hinterlässt ihre Spuren auch dort, wo etwas bleibt. Und es bleibt viel mehr, als man mitunter glaubt. Die hefte für gegenwartskunst gibt es zum Beispiel noch immer, sie schreiben sich jetzt klein und heißen schon lange nicht mehr Springer, sondern Springerin, sind chic wie eh und je und widmen sich nun der Netzkultur. Und Darja Richter, die ehemalige Meisterschülerin, die gerne mit Filz arbeitete, residiert jetzt als »reine de la dentelle haute-couture« in Versailles. Vom Filz zur Spitze, vom Kontext ins Netz, vom generischen Maskulinum zur Sexualisierung der Grammatik: War das die Zukunft der Moderne, der sich ein Kursbuch des Jahres 1995 gewidmet hatte?
Gestern Zukunft, übermorgen Vergangenheit
Jede Vergangenheit, das wird gerne vergessen, war einmal eine Zukunft. Das, was in den letzten beiden Jahrzehnten geschehen ist...