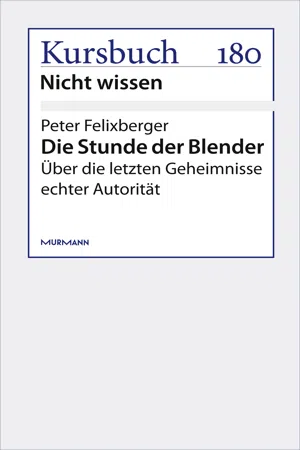Peter Felixberger
Die Stunde der Blender
Über die letzten Geheimnisse echter Autorität
Diktaturen, oder sanfter ausgedrückt Monarchien, beruhen auf einer simplen Denkfigur. Der weise Alleinherrscher weiß erstens, was zu tun ist, und er tut aus seiner Sicht zweitens immer das Richtige. Das Geschäft funktioniert so lange, wie diese stillschweigende Übereinkunft Herrscher und Beherrschte vereint. Auf diese Weise hält der selbstbestimmte Weise seinen Laden zusammen. Herrschaftstheoretisch ist der Diktator oder König außerdem eine überaus energiesparende Einrichtung. Er braucht nur wenige Debatten und Diskurse abzuhalten, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Der alles Wissende hat ja schließlich alle Macht und Autorität, das zu tun, was richtig ist. Denn als einzige Autorität weiß er: Oben steht nur, wer alles weiß. Unter dieser Dumpfglocke lässt es sich dann selbst als Dumpfbacke ordentlich leben und arbeiten.
Fußballtrainer und Unternehmenskapitäne, Chefköche und Stammesfürsten, Flugzeugpiloten und Chefredakteure wissen um die Vorzüge monarchischer Entscheidungsprozesse in der Abgeschiedenheit eigener Vernunft. Kein Untertan redet mit, wenn es ernst wird. Nun wissen wir natürlich längst, dass sich auf Dauer nur noch Fußballspieler, zermalmte Mitarbeiter, Köche, Passagiere und freiberufliche Autoren diesem Herrschaftsmodell unterwerfen. Doch der Lack blättert allerorten. Erstens, weil die weisen Einzigartigen weniger, und zweitens, die weisen vielen immer mehr werden. Mit der Konsequenz: Die Weisheit des einen zerfällt schneller, als die Weisheit der vielen wächst. Egal, jeder darf am Rockzipfel der Machtdiskurse mithängen – auch und besonders bezüglich der Frage, wer oder was über ihn regiert.
Das Problem ist nur: Mit dieser emanzipatorischen Volte vom Einzeller zum Vielzeller wird das Begründungsgeschäft des Herrschens komplizierter. Denn wer will schon seine selbstgerechte Hand so ohne Weiteres für die vielen anderen ins Feuer legen? Da wird’s unübersichtlich: Denn jetzt schlägt die Stunde des Demokratieparadoxons. Der Bürger wird Machtgeber und Machtempfänger in einer Person. Er verteilt Macht nach oben und erhält sie gleichzeitig von dort. Vorgesetzter wird zu Untertan, und Untertan zu Vorgesetztem. Mitregieren und im selben Augenblick regiert werden ist indes die Spielregel, die für moderne Demokratien gilt. Hintergrund: Eine so wohlgeordnete Gesellschaft beruht auf der Annahme, dass jeder seinen Einzelwillen in einer höheren, kollektiven Vernunft aufgehen sieht. Dahinter lauert aber eine weitere Bedingung: Was ich will, müssen andere auch wollen. Kurzum: Es funktioniert nur, wenn die da oben wollen, was ich da unten will, weil ich die Macht habe, die da oben abzuberufen, wenn sie nicht mehr so wollen, wie ich will. Das ist übrigens bislang die einzige erfolgreiche Vereinbarung, mit der Bürger ihre Macht auf Regierungen und Regime aller Art übertragen, ohne zu murren.
Der Staat, und somit dringen wir langsam zu unserem eigentlichen Thema vor, wird dabei zu einer Art Kollektivvernunft, in der alle Bürger machttheoretisch einzahlen, um regieren und gleichzeitig regiert werden zu können. Um das besser zu verstehen, haben viele politische Ideenforscher versucht, das Paradoxon wenigstens semantisch zu bändigen. Allen voran John Rawls, der uns in einen Urzustand zurückbeamt, in dem uns ein Schleier des Nichtwissens umhüllt. Dieser hat die besondere Eigenschaft, dass wir durch ihn auf uns selbst nicht blicken können, während wir gleichzeitig das politische System durchdringen. So entsteht eine Art gigantisches soziales Rollenspiel mit dem Ziel »eines komplexeren Ideals einer wohlgeordneten Gesellschaft«, so Rawls. Kurz: Von sich weiß der Bürger so gut wie nichts, über das politische S...