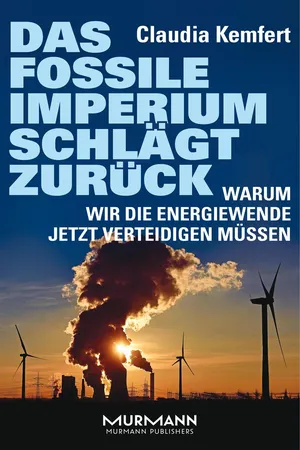![]()
II. FAKTENCHECK:
DIE ENERGIEWELT JENSEITS DES POSTFAKTISCHEN
![]()
POSTFAKT 1:
»Die Energiewende ist bis 2022 nicht zu schaffen.«
FAKT: Atomausstieg und Energiewende werden oft gleichgesetzt, sind aber zwei verschiedene Projekte: Die Energiewende ist ein Langzeitprojekt. Manche Maßnahmen reichen schon heute weit über 2030 hinaus. Was bis 2022 gelingen soll, ist nicht die Energiewende, sondern der Ausstieg aus der Atomenergie. Und der wäre schon jetzt möglich: Wenn wir wollten, könnten wir alle acht noch aktiven Atomkraftwerke von heute auf morgen vom Netz nehmen.
Als 2011 geschah, was nie passieren sollte, war der Schreck groß: Ein Erdbeben erschüttert Japan, verursacht einen Tsunami und überrollt mit bis zu 40 Metern hohen Flutwellen die Ostküste des Landes. Autos, Häuser, ganze Städte werden von den Wassermassen mitgerissen, Zehntausende Menschen verlieren ihr Leben, und im Atomkraftwerk Fukushima kommt es zum Super-GAU, der Kernschmelze in drei Reaktoren. In den Tagen und Wochen nach dem Beben kann die ganze Welt an den Bildschirmen die Katastrophe mitverfolgen: Explosionen zerstören die Gebäudehüllen, radioaktive Wolken ziehen über den Pazifik.
Unter dem Eindruck der Ereignisse in Japan beschließt die Bundesregierung wenige Monate nach dem Unglück den Atomausstieg bis 2022. Zehn Jahre will man sich Zeit lassen, um die restlichen noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz zu nehmen.
Neu war das Vorhaben nicht: Schon im Jahre 2000 und 2002 hatte die Regierung den Ausstieg beschlossen. Unter Gerhard Schröder wollte man innerhalb von 20 Jahren ganz auf den Strom aus Kernenergie verzichten, bis 2021 sollte der letzte Atommeiler abgeschaltet werden. Doch schnell wurde Kritik an dem Vorhaben laut. Viel zu ehrgeizig sei der Zeitplan, so schnell könne man die Atomkraft nicht durch Strom aus anderen Quellen ersetzen. Immerhin stammte zur Jahrtausendwende noch ein Viertel des von den Deutschen verbrauchten Stroms aus Atomkraftwerken – bei wachsendem Energiebedarf. 2010 folgte der Ausstieg vom Ausstieg: Die Laufzeiten für die deutschen Atomkraftwerke wurden noch einmal verlängert.
Der nach dem Unglück von Fukushima unter Angela Merkel beschlossene Atomausstieg war – genau genommen – nicht mehr als eine Rückkehr zum ursprünglichen Zeitplan. Dennoch sorgte der Beschluss für großes Aufsehen. Denn zurück waren auch die kritischen Stimmen, dass die endgültige Abkehr vom Atomstrom in einem so kurzen Zeitraum gar nicht zu schaffen sei.
In nur zehn Jahren sei der Ausstieg nicht umzusetzen, hieß es in der lautstarken Debatte, und immer öfter tauchte darin noch ein anderes Wort auf, das zunehmend synonym für den Atomausstieg verwendet wurde: das Wort »Energiewende«. Und so hieß es also immer häufiger, die Energiewende sei bis 2022 nicht zu schaffen. Doch so eng Atomausstieg und Energiewende zusammenhängen, sie meinen nicht dasselbe: Das Ende der Atomstromnutzung ist nur einer von vielen Teilschritten auf dem Weg zur Energiewende. So wichtig der Atomausstieg ist, er ist keinesfalls mit der Energiewende gleichzusetzen. Alle Regierungsbeschlüsse, die sich auf das Jahr 2022 beziehen, betreffen allein den Atomausstieg.
Noch verbrauchen wir sehr viel Energie nicht nur aus atomaren, sondern auch aus fossilen Quellen. Selbst wenn nach 2022 keine Atomkraftwerke mehr am Netz sind, werden wir auch weiterhin fossile Energien verwenden. »Energiewende« bedeutet die komplette Ausrichtung auf erneuerbare Energien, also kein Atom, aber auch kein Öl, keine Kohle, kein Erdgas – oder zumindest möglichst wenig davon.
Energie brauchen wir nicht nur für den Strom, sondern in noch höherem Ausmaß für unsere Mobilität und das Heizen (oder Kühlen) unserer Häuser, der Endverbraucher genauso wie die Wirtschaft und Industrieunternehmen sind auf sie angewiesen. Unser gesamtes Wirtschaftssystem basiert auf einem extrem hohen Energieverbrauch: Energie ist das Blut der Volkswirtschaft.
Die fossilen Ressourcen, Kohle, Erdgas und Öl, verursachen nicht nur große Umweltschäden, sondern sind auch nur begrenzt vorhanden: Früher oder später gehen sie zur Neige. Das Öl früher, die Kohle später. Deswegen sind es ganz unterschiedliche Fragen, bis wann der Atomausstieg zu schaffen ist und bis wann die Energiewende zu schaffen sein könnte. Bleiben wir erst mal beim Atom-Thema: Atomare Energie ist mit extremen Risiken verbunden, wie wir in Fukushima gesehen haben. Selbst ohne Super-GAU hinterlassen wir der Welt nach wenig mehr als einem halben Jahrhundert Kernenergienutzung einen riesigen Haufen Atommüll – der für bis zu einer Million Jahre sicher verschlossen werden muss. Noch immer ist nicht geklärt, wo und ob wir die radioaktiven Abfälle sicher lagern können, schon jetzt drohen uns die Entsorgungspraktiken – angesichts rostender Atommüllbehälter und Lecks in den Zwischenlagern – zum Verhängnis zu werden – dabei müssten die Fässer und Lager aller Voraussicht nach immer sehr viele hunderttausend Jahre halten. Zudem wird der Rückbau der Atomkraftwerke Jahrzehnte dauern und sehr viel mehr Kosten verursachen als zunächst angenommen.
Inzwischen sind es noch fünf Jahre bis 2022, nur noch fünf Jahre, bis es keine Atomkraft aus Deutschland mehr geben soll. Der Anteil an Atomenergie im gesamtdeutschen Strom-Mix hat sich seit der Jahrtausendwende bereits deutlich reduziert: Der Strom in deutschen Haushalten kommt mittlerweile zu etwa einem Drittel aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Wasser und Sonne. Mehr als die Hälfte stammt aus fossilen Quellen, hauptsächlich Kohlekraftwerken. Und nicht mehr 30, sondern etwa 15 Prozent unseres Stroms beziehen wir aus den Atomkraftwerken, die in Deutschland noch am Netz sind.
Am bundesdeutschen Strom-Mix lässt sich also, könnte man meinen, ablesen, dass wir es seit dem ersten Atomausstiegsbeschluss im Jahr 2000 – allen Laufzeitverlängerungen und klimapolitischen Umwegen zum Trotz – geschafft haben, jedes Jahr ein Prozent weniger Atomstrom in das deutsche Stromnetz einzuspeisen, und auf einem guten Weg sind.
Doch hinter den Kulissen zeigt sich noch ein ganz anderes Bild: Niemand braucht noch zu überlegen, ob wir es bis 2022 schaffen können, die restlichen knapp 15 Prozent Atomenergie im bundesdeutschen Strom-Mix durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu ersetzen. Es ist längst gelungen.
Denn die erneuerbaren Energien sind noch sehr viel erfolgreicher als die Strom-Mix-Zahlen auf den ersten Blick vermuten lassen: Während der Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen rasant vonstattengeht und immer mehr neue Anlagen hinzugebaut werden, laufen die deutschen Atommeiler und Kohlekraftwerke vorerst weiter. Das Ergebnis: Wir schwimmen im Strom.
Deutschland produziert so viel Strom, dass der Überschuss in andere Länder exportiert wird. Im Winter 2016/2017 war Frankreich auf Strom aus Deutschland angewiesen. Fünf Jahre vor dem endgültigen Ende der deutschen Atomkraft laufen – mit einer Gesamtleistung von insgesamt etwa 2000 Megawatt – zwei von sieben Atommeilern ausschließlich für den Bedarf der französischen Nachbarn.
Wenn wir wollten, könnten wir alle acht noch aktiven Atomkraftwerke vom Netz nehmen. Wir müssten damit gar nicht bis 2022 warten: Der Atomausstieg ginge jetzt!
Dass die Atomkraftwerke bislang dennoch weiterlaufen, liegt daran, dass es Verträge mit den Betreibern gibt, an die sich die Bundesregierung halten muss – gäbe es die Laufzeitgarantien nicht, könnten wir alle Atomkraftwerke schon morgen abschalten. Doch noch gibt es Unternehmen, denen der Betrieb bis 2022 zugesagt ist und die darauf ihr Geschäft aufbauen: die großen Vier, die Atomkonzerne E.ON, Vattenfall, RWE und EnBW.
Die Energiewende selbst wird mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Atomausstieg. Der Atomausstieg bis 2022 ist ebenso beschlossen wie die Energiewende bis 2050. Auch die großen Vier werden ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren auf eine erneuerbare Zukunft umstellen müssen – doch bis es so weit ist, laufen die lukrativen Atomkraftwerke weiter.
Wem es eben bis 2022 noch zu schnell ging, der landet schon beim nächsten Argument beim Gegenteil seiner Argumentation: Die Energiewende sei schon deshalb zum Scheitern verurteilt, weil ihre Umsetzung zu lange dauere, so lange im Voraus könne man gar nicht planen.
![]()
POSTFAKT 2:
»Zielmarke 2050 – so lang im Voraus kann man doch gar nicht planen!«
FAKT: Auf dem Weg in eine energieeffiziente und erneuerbare Zukunft liegen noch sehr viele Aufgaben und Zwischenziele vor uns. Bis 2050 ist es aus unternehmerischer Sicht nicht mehr lange: Wenn die Energiewende gelingen soll, müssen die entscheidenden Weichen jetzt gestellt werden. Dafür braucht die Wirtschaft vor allem einen klaren Kurs aus der Politik.
Im November 2016, kurz vor der 22. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Marrakesch, einigte sich die Große Koalition auf den deutschen »Klimaschutzplan 2050«. Darin ist festgelegt, welche Schritte Deutschland in den nächsten Jahrzehnten auf dem Weg zur Rettung des Planeten gehen will. Es war ein klimapolitischer Meilenstein, um den Politiker aller Parteien, die Industrie und zahlreiche Interessenvertreter jahrelang gerungen haben. Fast hätte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ohne bundespolitischen Konsens zur COP22 nach Marrakesch reisen müssen, so sehr wurde bis zuletzt über das Dokument gestritten. Der Kompromiss gelang in allerletzter Minute.
Einwände gab es viele: Der Atomausstieg 2022 sei viel zu früh, überhaupt wären viele der Ziele viel zu ehrgeizig, und über den endgültigen Kohleausstieg müsse man erst noch beraten, bevor man sich auf ein Datum festlegen könne. Auf der anderen Seite ist es vielen suspekt, so lange im Voraus zu planen – die Zielmarke 2050 läge viel zu weit in der Zukunft.
Dabei ist die Energiewende ein viel zu umfassendes Vorhaben, um es nicht so weit im Voraus zu planen. Der »Klimaplan 2050« gibt den offiziellen Fahrplan vor. Alle Einzelentscheidungen der deutschen Klimaschutzpolitik orientieren sich an der international vereinbarten »Zwei-Grad-Obergrenze«. Mehr als anderthalb, maximal zwei Grad über die vorindustriellen Temperaturen darf die globale Erwärmung nicht steigen. Aus dieser Obergrenze leiten sich alle klimapolitischen Ziele und Maßnahmen ab, die unser Wirtschaftsleben in den nächsten Jahrzehnten energieeffizient und umweltschonend umgestalten sollen. Dazu gehört zum einen der Ausbau der erneuerbaren Energien auf 40 bis 45 Prozent Anteil an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2025 und auf 55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035. Zum anderen braucht es eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz, vor allem beim Heizen von Wohnun...