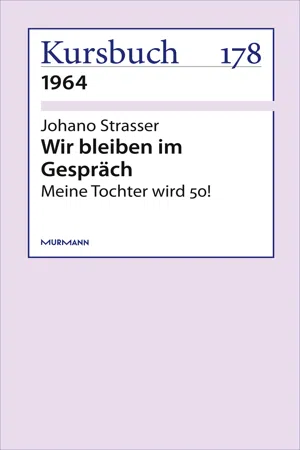Johano Strasser
Wir bleiben im Gespräch
Meine Tochter wird 50!
1964 – da war ich 25 und hatte schon zwei Jahre lang bei Ford in Köln als Übersetzer gearbeitet, um mir als der Ausländer, der ich damals noch war, das anschließende Zweitstudium und eine Freundin leisten zu können. Es war die gute alte Zeit des Wirtschaftswunders und des CDU-Staats, als es im bundesdeutschen Strafgesetzbuch noch den sogenannten Kuppelparagrafen gab. Wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz durch seine Vermittlung oder durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub leistet, wird wegen Kuppelei mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft, lautete Absatz 1. Eine Steilvorlage für schmallippige Sittenwächter, die ihren Nachbarn eins auswischen wollten, wenn diese ihrer erwachsenen Tochter mit ihrem Freund im Haus Übernachtung und damit womöglich Gelegenheit der Unzucht gewährten. Also ließen sich die meisten Hausbesitzer sicherheitshalber den Trauschein zeigen, bevor sie einem Paar eine Wohnung vermieteten. Auch das ein Grund, weshalb ich – nicht untypisch für meine Generation – schon mit 24 Jahren verheiratet war.
Ich bin ein sogenannter Achtundsechziger, kein ganz typischer vielleicht, weil noch vor dem Krieg und noch dazu in Holland geboren, aber ich habe nichts dagegen, wenn man mich so bezeichnet. Meine Tochter aus erster Ehe ist 1964 geboren, gehört also der Generation an, die als Babyboomer Schlagzeilen machte. Anfang der Siebziger zog ich mit Frau und Tochter von Hessen nach Berlin. Das Kind ging nach der Schule in den Kinderladen, der Vater unterrichtete drei Tage in der Woche angehende Lehrer an der Pädagogischen Hochschule, die restliche Zeit war er in Sachen demokratischer Sozialismus unterwegs. Für die Familie blieb wenig Zeit. Meine Frau und ich trennten uns Mitte der Siebziger, die Tochter blieb bei der Mutter, besuchte mich dann und wann in meiner Wohngemeinschaft, in der sich lauter politisch Engagierte, aber in ihren Beziehungen Gescheiterte zusammengefunden hatten.
Als Anfang der Achtziger plötzlich in allen Medien von der Null-Bock- oder Tunix-Generation die Rede war, kam eine Berliner Filmerin auf die verwegene Idee, das Verhältnis der Achtundsechziger zu ihren Kindern zu beleuchten. These: Die einen sind theorieverliebt, habituell überengagiert und ziemlich humorlos, die anderen wollen von Politik und sozialen Theorien nichts mehr wissen, lesen keine Bücher und machen sich stattdessen einen schönen Lenz. Das vorgesehene Gespräch zwischen Vater und Tochter fand – wo sonst? – vor meiner Bücherwand statt. Als die Kamera lief, erklärte meine Tochter, die damals eine Punkfrisur trug und in der Berliner Hausbesetzerszene mitmischte, dass sie im Gegensatz zu ihrem Vater überhaupt keine Bücher lese und mit dem langweiligen Theoriekram der Achtundsechziger nichts anfangen könne. Mission accomplished. Die Regisseurin nickte zufrieden.
Nun hatte meine Tochter sich allerdings einige Wochen zuvor, wie sie mir am Telefon erzählt hatte, vier Bücher über die Entstehung des Bankensystems in Italien aus der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg ausgeliehen und tatsächlich auch gelesen. Das rieb ich ihr als besserwisserischer Vater also genüsslich vor der Kamera unter die Nase, woraufhin meine Tochter einräumte, dass sie zwar lese, aber eben nicht, was ich ihr empfehle, sondern nur, was sie selbst für wichtig halte. Es entspann sich zwischen uns ein Gespräch, das zeigte, dass es Differenzen, aber nicht den totalen Bruch zwischen den Generationen gab, dass neben Unterschieden durchaus auch Gemeinsamkeiten existierten. Als aber ein Jahr später der fertige Film im Fernsehen gezeigt wurde, war außer dem Eingangsstateme...