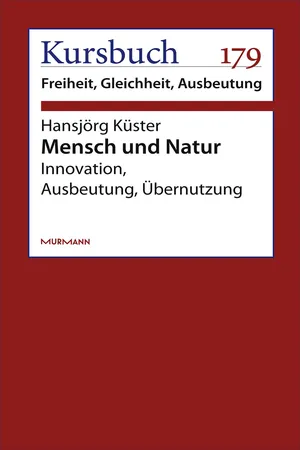Hansjörg Küster
Mensch und Natur
Innovation, Ausbeutung, Übernutzung
Landschaft wird stets von Natur und Kultur geprägt. Natur ist statisch gedacht, aber in der Realität dynamisch: In ihr kommt es ständig zu Temperaturschwankungen, Abtragung und Ablagerung von Gestein, Wachstum und Absterben von Lebewesen, Veränderung von Standorten. Kultur soll für Stabilität sorgen: Landnutzung soll die Grundlage für stabile Lebensbedingungen von Menschen sein. Weil aber Landschaft stets auch von dynamischer Natur geprägt ist, wird auch eine aus kultureller Sicht stabil gedachte Landschaft niemals dem Wandel entgehen.
Menschen sind Landnutzer. Ihre Strategien haben sich in den letzten Jahrtausenden mehrfach geändert. Ihnen trat nicht nur Natur entgegen, sondern auch Folgen überkommener Landnutzungssysteme, bei deren Anwendung sowohl Landschaftsstrukturen als auch Ideen zur Landschaft entstanden waren. Menschen – und das macht vielleicht ein Stück weit ihre Sonderstellung aus – setzen sich also bei der Nutzung ihrer Umwelt nicht nur mit den Bedingungen der Natur auseinander, sondern mit einer viel komplexeren Landschaft. In einem gewissen Rahmen ist ihnen die Freiheit gegeben, entweder nur für die Ausbeutung ihrer Umwelt zu sorgen oder auch moralische, ethische oder ästhetische Aspekte beim Umgang mit Landschaft zu berücksichtigen.
Kommen und Gehen
Für eine Ausbeutung von Umwelt gibt es ökologische Gründe. Die Ökologie untersucht und beschreibt die Beziehungen von Lebewesen zu ihrer Umwelt; sie ist eine Naturwissenschaft, die von Beobachtungen und nicht von Bewertungen ausgeht. Sie ist ein Teil der Biologie und keine Weltanschauung. Viele verschiedene Organismen bilden ein Ökosystem. In Pflanzen werden bei der Fotosynthese aus einfachen Stoffen – Wasser und Kohlenstoffdioxid – kompliziertere organische Substanzen aufgebaut. Pflanzen nehmen über ihre Wurzeln kleinere Mengen an Mineralstoffen aus dem Boden auf: Stickstoff, Phosphor, Magnesium. Der Körper einer Pflanze besteht aus organischen Substanzen, die die Produkte der Fotosynthese und Stoffe enthalten, die sie aus dem Boden aufgenommen hat. Tiere, die keine organischen Substanzen aus Wasser und Kohlenstoffdioxid aufbauen können, müssen etwas fressen: entweder Pflanzen oder andere Tiere. Dabei nehmen sie auch alle Mineralstoffe auf, die sie zum Leben brauchen.
Solange Wasser, Kohlenstoffdioxid und alle notwendigen Mineralstoffe verfügbar sind, wachsen Pflanzen und vermehren sich. Dann können sich Tiere ebenfalls vermehren, denn sie leben davon, Pflanzen oder deren Teile zu fressen. Und Tiere, die sich von anderen Tieren ernähren, gedeihen und vermehren sich, solange potenzielle Jagdbeute vorhanden ist. Wenn nicht mehr genug Nahrung verfügbar ist, kommt es zur Krise: Pflanzen sterben ab, Tiere gehen ein, und alle Organismen haben weniger Nachkommen. Ein solcher Trend kann sich erst dann umkehren, wenn wieder mehr Nahrung bereitsteht.
Es ist ein Irrtum, von einem Kreislauf der Natur auszugehen. Die Stoffe, die die Pflanze dem Boden entnimmt, kommen nicht alle wieder dorthin zurück, wo sie aus dem Untergrund gezogen wurden. Beispielsweise scheiden Tiere diese Mineralstoffe an ganz anderen Orten wieder aus. An bestimmten Stellen werden organische Substanzen akkumuliert und nicht oder nur verzögert wieder abgebaut: im Humus, in den Ufer- und Verlandungszonen von Seen und Meeren, in Mooren. An den Orten, an denen Tiere und Pflanzen leben, kommt es dadurch immer wieder zu Veränderungen, die nicht abrupt, sondern kontinuierlich verlaufen. Zeitweise können sich einzelne Arten von Lebewesen gut vermehren, dann verändern sich die Orte, an denen sie leben, mitunter auch so, dass sich die Lebensbedingungen für bestimmte Arten verschlechtern. Andere Tiere und Pflanzen treten auf, vermehren sich und verschwinden wieder. Eine solche Abfolge von Lebensgemeinschaften wird Sukzession genannt. Sie lässt sich bei der Verlandung eines Sees beobachten: Jede offene Wasserfläche wird mit der Zeit kleiner, schließlich verschwindet sie ganz. Kein See bleibt ewig bestehen. Während seiner Veränderung breiten sich zahlreiche Pflanzen- und Tierarten nacheinander aus und verschwinden wieder: Weder ein Kreislauf noch ein Gleichgewicht der Natur wird jemals erreicht.
Utopisches Ziel
Ein Gleichgewicht von Lebensbedingungen zu erreichen ist ein utopisches, aber dennoch immer angestrebtes Ziel von Menschen, die nicht nur in Natur, sondern auch in Kultur eingebunden sind. Ihre Existenz ähnelt zunächst derjenigen von Tieren: Sie beuten ihre Umwelt aus, indem sie sich von Pflanzen und Tieren ernähren. Dabei erreichen sie unweigerlich irgendwann Grenzen des Wachstums, und zwar genauso wie jede Tier- oder Pflanzenart. In einer solchen Situation setzen Menschen alles daran, nicht nur ihr eigenes Überleben, sondern auch das Überleben der Gruppe von Menschen zu ermöglichen, in die sie eingebunden sind. Dass dies letztlich nicht gelingen kann, ist jedem Menschen klar, der über seine Existenz nachdenkt. Aber es ist seit Jahrtausenden ein wichtiges kulturelles Ziel, das Leben zu verlängern.
Menschen lebten ursprünglich nur in den Tropen Afrikas mit ihrem ganzjährigen Nahrungsangebot. Im tropischen Regenwald, wo kaum jahreszeitliche Temperaturschwankungen auftreten, bilden sich das ganze Jahr über nahrhafte Früchte oder Knollen aus, und das ganze Jahr über können Tiere erbeutet werden. Davon wurden wenige Menschen satt, und daher konnten sich Menschen bis zu einer Grenze des Wachstums vermehren. Schließlich wurde Nahrung immer stärker ausgebeutet und knapp. Menschen ersannen Mittel und Wege, um die immer deutlicher spürbare Krise zu überwinden, dadurch etwa, dass sie mit Feuer die Nahrung besser aufschlossen. Sie ersannen neue Jagdmethoden oder wanderten an andere Orte, an denen zuvor noch keine Menschen gewesen waren. Innovationen ließen die Größe menschlicher Populationen eine Zeit lang wachsen, bis erneut Grenzen des Wachstums erreicht wurden und neuerlich Krisen der Nahrungsversorgung auftraten. Es setzte eine Spirale aus Innovation, Ausbeutung und Übernutzung von Umwelt ein. Die Menschheit, die in diese Spirale eingebunden war, hatte immer weniger nur mit natürlichen Gegebenheiten zu tun, sondern auch mit Strukturen, die sie durch ihr Handeln, durch ihre Kultur selbst geschaffen hatte. Menschen dezimierten die Bestände einzelner Pflanzen- und Tierarten, von denen sie sich ernährten, derart stark, dass sie ausstarben oder sehr selten wurden. Es gelang ihnen aber, andere Arten von Pflanzen und Tieren zu finden und zu fördern, die ebenfalls zur Nahrung taugten. Die vom Menschen immer stärker beeinflussten oder gar beherrschten Ökosysteme nahmen eine andere Zusammensetzung an. Nachfolgende Generationen lebten nicht mehr mit der »reinen« Natur, sondern in den Ökosystemen, die die Generationen vor ihnen beeinflusst und verändert hatten. Diese Menschen setzten sich also nicht mehr mit einer Umwelt auseinander, die ausschließlich von Natur bestimmt war. Ihre Umwelt war ebenso von Kultur geprägt, und das gilt in stärkerem Maße für spätere Zeiten, in denen sich die Spirale aus Innovation, Ausbeutung und Übernutzung von Umwelt noch immer weiterdrehte.
Wer die Umwelt dieser Menschen charakterisieren will, darf sich also nicht nur mit Natur befassen, sondern muss die gesamte Landschaft ins Visier nehmen. Dafür wird eine Landschaftswissenschaft gebraucht, eine Disziplin, die sowohl Natur als auch Kultur im Sinne von Gestaltung und Kultur im Sinne von Ideen und Metaphern untersucht. Ideen und Metaphern sind wichtig: Irgendwann nämlich begannen Menschen, über ihre Umwelt zu reflektieren, die nicht mehr nur Natur war, sondern eine Landschaft, die sowohl von Natur als auch von Kultur geprägt war. Menschen entwickelten mehrere Landnutzungssysteme hintereinander. Im Rahmen jedes dieser Systeme waren die Lebensbedingungen unterschiedlich, auch die Verhältnisse zwischen natürlichen und kulturellen Faktoren, die auf die Landschaft einwirkten, änderten sich erheblich.
Menschen in der letzten Eiszeit
In der letzten Eiszeit und ganz besonders an deren Ende ergaben sich sehr günstige Voraussetzungen dafür, dass sich die Menschheit von Afrika aus über weite Teile der Erde verbreiten konnte. In den gemäßigten Zonen, die heute Waldländer sind und zu denen weite Teile Europas gehören, w...