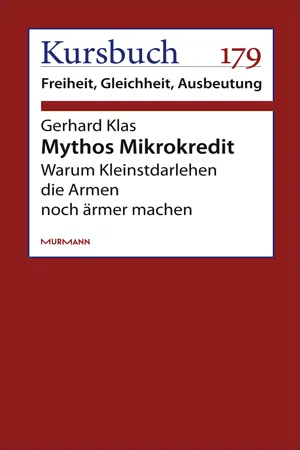Gerhard Klas
Mythos Mikrokredit
Warum Kleinstdarlehen die Armen noch ärmer machen
Es war eine mediale Erfolgsgeschichte. Und in vielen Kreisen gilt sie bis heute noch als solche: der Mikrokredit als probates Mittel zur Bekämpfung der Armut im globalen Süden. Die Grundannahme: Als Unternehmer können sich die Armen aus der Armut befreien – dafür brauchen sie nur etwas Investitionskapital. Das Problem: Banken gewähren den Armen in der Regel keine Kredite. Die Lösung: Mikrofinanzinstitute (MFI), die Kleinstkredite, umgerechnet zwei- bis dreistellige Eurobeträge, ohne herkömmliche Sicherheiten vergeben.
Diese simple Erzählung hat viele gesellschaftliche Akteure schnell überzeugt. Für die Mikrokredite hat sich in den vergangenen Jahren eine Allianz starkgemacht, die sonst nur selten zusammenkommt: Regierungen und Nichtregierungsorganisationen, Kirchengemeinden und Wissenschaftler, Banken und sogar einige Globalisierungskritiker. Staatliche und zivilgesellschaftliche Entwicklungsorganisationen sehen die Mikrofinanz zunehmend als Alternative zur klassischen Entwicklungshilfe. Ein Grund: Die Mikrokredite umgibt ein ganz besonderer Charme. Angeblich sind sie kein Produkt westlicher Entwicklungsexperten, sondern kommen aus Bangladesch, einem der ärmsten Länder der Welt.
Viel zu dieser Sichtweise beigetragen hat die mediale Durchschlagskraft eines Muhammad Yunus, der 2006 für seine Grameen Bank in Bangladesch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Seit den 1970er-Jahren vergibt er Mikrokredite vor allem an Frauen. Aber: Diese Idee ist ein Import. Yunus hat sie mitgebracht aus den USA, wo er Ende der 1960er- und Anfang der 70er-Jahre Wirtschaftswissenschaften studierte und anschließend lehrte. Die neoliberale Wirtschaftstheorie machte damals großen Eindruck auf ihn, und der »Bankier der Armen« wollte durch große Mikrokreditprogramme all jene Strukturen abschaffen, die den Armen im Kapitalismus bislang Linderung und Hilfe versprachen: »Almosen, Suppenküchen, Lebensmittelmarken und Fahrten ins Krankenhaus zum Nulltarif sowie Straßenbettler hätten sich überlebt«, so Yunus.1 »Genauso die staatlichen Arbeitslosen- und Rentenversicherungen.«
Breite Zustimmung – immer noch
Während die Chicago Boys mit dem Autokraten General Pinochet in Chile das erste neoliberale Großexperiment durchführten, kehrte Yunus nach Bangladesch zurück und vergab 1976 erstmals Kleinstkredite an Frauen. Heute hat seine Grameen Bank mehr als acht Millionen Kundinnen. Zum Grameen-Konglomerat gehören unter anderem die größte Telefongesellschaft Bangladeschs Grameenphone und mehrere Textilfabriken. Zu seinen Fürsprechern und Promotoren zählen international einflussreiche Persönlichkeiten wie der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. Seit Jahren fährt Yunus nach Davos zum jährlichen Weltwirtschaftsforum. In solchen Kreisen stößt Yunus auf breite Zustimmung, wenn er ein »Grundrecht auf Kredit« fordert, mit dessen Hilfe man die »Armut ins Museum« verbannen könne.
Dabei sollte allein eine Zahl stutzig machen: Der weltweit durchschnittliche Zinssatz für einen Mikrokredit schwankt zwischen 27 Prozent (2011) und 35 Prozent (2008). Diese Zahlen stammen aus einer Quelle, die über jeden Verdacht der Übertreibung erhaben ist: von CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), einem Zusammenschluss institutioneller Mikrofinanzinvestoren unter dem Dach der Weltbank in Washington, also einer Institution, die als Protagonistin der Mikrofinanz kein Interesse daran hat, diese Zahl möglichst hoch anzusetzen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die realen Kosten des Kredits – zu denen auch Zwangssparen und Zwangsversicherungen gehören – um einiges höher liegen. Ein gefeierter Branchenprimus, die mexikanische MFI Compartamos, kassierte 2010 sogar 195 Prozent Zinsen.
Trotz dieser aberwitzigen Zinssätze nimmt die Bedeutung der Mikrofinanz weltweit zu: Waren es im Jahr 2001 noch knapp drei Milliarden Dollar, wurden 2011 fast 90 Milliarden Dollar Mikrokredite weltweit vergeben.2 Das entspricht in etwa dem Volumen der globalen öffentlichen Entwicklungshilfe. Und die Wachstumsprognosen sind gut: Die Deutsche Bank Research schätzt das Potenzial der Mikrokredite auf 250 Milliarden Dollar.
Genossenschaft – von wegen
Mikrokredit ist ein schillernder Begriff und wissenschaftlich nicht eindeutig definiert. Gerne verweisen die Befürworter der Mikrofinanz auf die Väter der deutschen Genossenschaftsbewegung: Schultze-Delitzsch und Raiffeisen. Aber dieser Verweis ist irreführend. In der frühen Genossenschaftsbewegung gab es größere Kredite zu niedrigeren Zinsen und längeren Laufzeiten. Die Kreditvergabe orientierte sich viel stärker an den Bedingungen der Kreditnehmer. Es gab eine effektive Kontrolle durch die Genossenschaftsmitglieder, und – besonders wichtig – das Geld blieb in einem lokalen Kreislauf.
Bei der Mikrofinanzindustrie, wie sie im englischsprachigen Raum genannt wird, handelt es sich hingegen um ein standardisiertes Top-down-Modell, mit hohen Zinsen, kleinen Beträgen, kurzen Laufzeiten und Ratenzahlungen im oft wöchentlichen Rhythmus – nach dem Vorbild der Grameen Bank. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle: Investoren geben Geld in lokale Gemeinschaften, um es mit Profit wieder herauszuziehen.
Das entspricht der heute dominanten Mikrofinanz, die sich am Standard der CGAP orientiert: kommerziell und finanziell nachhaltig, was bedeutet, dass Mikrofinanzinstitute nach Möglichkeit ohne Zuschüsse und Subventionen auskommen sollen. Erst dann sind sie interessant als potenzielle Kapitalanlage für Finanzmarktakteure. »Financial inclusion« nennt das die CGAP: die Ärmsten der Welt in den globalen Finanzmarkt integrieren.
Diese »finanzielle Inklusion« führt zur massiven Umverteilung von Schuldnern an Glä...