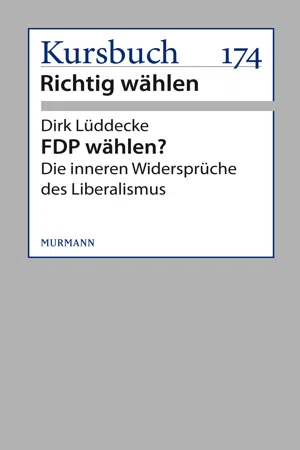Dirk Lüddecke
FDP wählen?
Die inneren Widersprüche des Liberalismus
Es sollten gute Zeiten für den Liberalismus in Deutschland sein. Das Staatsoberhaupt ist ein bekennender Liebhaber der Freiheit, dessen tiefe Überzeugung es sei, dass die Freiheit das Allerwichtigste im Zusammenleben ist und erst Freiheit unserer Gesellschaft Kultur, Substanz und Inhalt verleihe.1 Auch andere Rahmenbedingungen sind günstig für den Liberalismus. Die äußere wie die innere Bedrohungslage ist überschaubar, die wirtschaftliche Situation vergleichsweise robust und bei allen Unwägbarkeiten einigermaßen günstig. Die Kultur der gesellschaftlichen Debatten und des politischen Konfliktaustrags ist verhältnismäßig pluralistisch, ideologiefrei und tolerant. Die liberale idée directrice des Wettbewerbs regiert selbst dort unangefochten, wo sich der Sinn der Sache und Erfolg auch ganz anders verstehen ließen. Und sogar die Bundesagentur für Arbeit bietet Kurse zur »Selbstvermarktung« an. Nur die Liberalen geben zu alldem eine traurige Figur ab.
Einer der Gründe dafür mag gerade sein, dass die Zeiten für den Liberalismus im Allgemeinen so günstig scheinen, dass es schwer sein mag, im Speziellen als Liberale im parteipolitischen Wettstreit überhaupt noch zu punkten. Ein anderer, wichtigerer, weil selbst verschuldeter Grund ist, dass die Freien Demokraten zu den Parteien gehören, die ihre Chance auf eine programmatische Neujustierung und Selbstbesinnung im Blick auf die sozialen und kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen der neuen Zeit geradezu leichtfertig zu verspielen drohen.2 So bleibt es bei kleingeistiger Winkelliberalität, statt einer freiheitlichen Aufbruchsstimmung Ausdruck zu verleihen und den politisch-kulturellen Horizont liberal zu erweitern. Während Christ- und Sozialdemokraten sowie Bündnis 90/Die Grünen in Regierungsverantwortung im vergangenen Jahrzehnt mehrfach und nicht ohne Schmerzen über ihre eigenen konzeptionellen Schatten gesprungen sind, traten die Parteiliberalen in einen veritablen Lernboykott. Aus ihrem dornröschenhaften Dämmerzustand, was die programmatische Orientierung betrifft, erwachten sie erst wieder, als aus der bankenverschuldeten Finanzkrise eine Staatsschuldenkrise geworden war. Damit hakten die Vorwurfsroutinen wieder ein, da der übliche Verdächtige, der Staat, wie gewohnt zum Schuldigen und Schuldenmacher Nummer eins erklärt und angeprangert werden konnte.
Um sich indes programmatisch neu zu besinnen und politisch zu positionieren, kann der Liberalismus durchaus auf sich selbst und seine eigene Vielfältigkeit vertrauen. Ja der Liberalismus lässt sich sogar als getreues Abbild der paradoxen geistigen Situation der Zeit verstehen.
Dazu darf man ihn sich freilich nicht als allzu homogenes, widerspruchsarmes, da monothematisches, Steuersenkungsversprechen produzierendes Ideologiegebilde vorstellen. »Nie zuvor haben Begriffe wie liberal oder gar neoliberal eine so niederträchtige Konnotation angenommen wie in den letzten Jahren«, grantelte vor einiger Zeit der philosophische Provokateur Peter Sloterdijk.3 Nicht ohne Grund, doch historisch ist der Liberalismus glücklicherweise ein Resultat und Erbe vieler Traditionen. War Fortschrittlichkeit im 19. Jahrhundert im Zuge des Optimismus der Aufklärung für politische Bewegungen ein Grund zur Hoffnung – was dem Liberalismus mit dem Aufkommen des noch fortschrittlicheren Sozialismus bekanntermaßen ein erstes ernstes historisches Problem einbrachte –, haben sich die Bedingungen mittlerweile gründlich geändert. Zuversichtlich darf eine politische Bewegung heute sein, wenn sie das Erbe vieler Traditionen antreten kann. Nicht zuletzt verleiht das eine hohe Anpassungsfähigkeit, ohne sich untreu zu werden. Zeitgemäß ist der Liberalismus aufgrund seiner Vielfalt – und gerade auch seiner inneren Widerstrebigkeit wegen. Und er hat eine Aufgabe. Er bewahrt den Einzelnen davor, dass seine Freiheit missachtet, unterhöhlt oder in der Routine des politischen Regierungsgeschäfts einfach vergessen wird.
1. Die liberale Entscheidung: Es geht um Freiheit
»Das Fundament der liberalen Philosophie ist der Glaube an die Würde des Einzelnen, an seine Freiheit zur Verwirklichung seiner Möglichkeiten in Übereinstimmung mit seinen persönlichen Fähigkeiten mit der einzigen Einschränkung, dass er nicht die Freiheit anderer Personen beschränke, das Gleiche zu tun.«4 Daran hat sich nichts geändert.
Die Freiheit, um die es dabei geht, ist primär die Freiheit von Zwang, Bevormundung und Angst. Man nannte das – wie glücklich oder unglücklich auch immer – negative Freiheit.5 »Freiheit ist stets Freiheit von etwas. Sie ist ganz und gar negativ. Freiheit bedeutet Abwesenheit von Ketten und Käfigen, von Zwang und Bevormundung, von Angst und Gewalt.«6 Wer solche negative Freiheit wertschätzt, empfindet auch für eine zweite Sache, die vom Wort her sich als Mangelerscheinung präsentiert, große Sympathie: für Privatheit. Die Entzogenheit des Privaten ist lebenspraktisch indes gar kein Mangel, sondern auf der einen Seite ei...