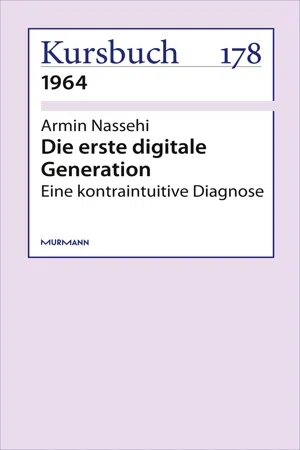Armin Nassehi
Die erste digitale Generation
Eine kontraintuitive Diagnose
Ich wurde nicht 1964 geboren, sondern 1960 – das macht, selbst in den schnellen heutigen Zeiten, keinen großen Unterschied. Wie soll ich nun diese Generation beschreiben? Meine erste Intuition, als ich darüber nachgedacht habe, war eine zunächst unplausible Idee – nämlich die in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre Geborenen als erste digitale Generation zu beschreiben – das ist kontraintuitiv deshalb, weil man das Digitale wohl eher den Jüngeren zuspricht. Und trotzdem, wir sind die erste digitale Generation, ohne es zunächst gemerkt zu haben. Ich fange deshalb eher biografisch an.
Frühe Technologieschübe
Ich habe 1979 in Gelsenkirchen mein Abitur abgelegt und danach in Münster studiert – Erziehungswissenschaften, parallel auch Philosophie, jeweils mit dem Nebenfach Soziologie. Ich habe im Studium viel schreiben müssen – wie es sich für ein Studium gehörte und gehört. Zunächst hatte ich eine mechanische Schreibmaschine von meinen Eltern, sehr mühsam zu bedienen, mit großen Zwischenräumen zwischen den Tasten, was bei unsachgemäßem Gebrauch dazu führte, dass meine Finger immer wieder zwischen den Tasten festgeklemmt sind, mit bisweilen durchaus schmerzhaften Folgen. Ich weiß nicht mehr, wann genau es war – vielleicht in meinem dritten Semester –, als mein Studium einen ersten Technologieschub erfahren hat. Ich habe mir eine gebrauchte Robotron 202 gekauft, eine elektrische Schreibmaschine aus DDR-Produktion, aus dem VEB Robotron Buchungsmaschinenwerk in Karl-Marx-Stadt. Diese Maschine robust zu nennen, wäre eine eklatante Untertreibung. Sie war sehr schwer, das Gehäuse geradezu verschwenderisch aus bestimmt zwei Millimeter dickem Metall. Der Motor der Maschine wurde sicher nicht für Schreibmaschinen entwickelt – man hätte damit auch feststofflichere Kulturgüter mobilisieren können als philosophische, pädagogische und soziologische Hausarbeiten, Exzerpte usw. Die Maschine war – sicher keine Überraschung – sehr laut. Das galt für den Motor ebenso wie für die Typenhebel, die mit einer enormen Kraft auf Papier und Walze trafen. Ich erinnere mich noch genau, wie der Wagenrücklauf den Beistelltisch neben meinem Schreibtisch in wankende Bewegungen versetzte. Und noch genauer erinnere ich mich daran, dass jeder Fehler bei der Benutzung der Tastatur unmittelbar, zeit- und wertkontinuierlich sich auf das Geschriebene auswirkte – und zwar so gut wie nicht rückholbar. Es ist genau das, was man eine Analogtechnik nennt, also eine Technik, die so etwas wie eine Eins-zu-eins-Übertragung von Ursache und Wirkung, Signal und Reaktion, Steuerung und Umsetzung vorsieht. Selbst die Fehlerkorrektur mit Tipp-Ex-Streifen war im Nachhinein sichtbar – das beschriebene Papier hatte zwar einen geheilten Text, aber die Narben blieben sichtbar.
Im Jahre 1985 habe ich eine Diplomprüfung in Erziehungswissenschaften abgelegt. Dafür musste ich im Fach Soziologie eine Diplomarbeit schreiben. Diese umfasste – so viel Zeit war damals noch für den ersten Qualifikationsschritt – um die 350 Schreibmaschinenseiten, die ich zunächst handschriftlich verfasst und dann auf meiner Robotron-Maschine ins Reine geschrieben habe. Ins Reine hieß, in eine Form, die als Vorlage für ein professionelles Schreibbüro dienen konnte, das daraus eine Abschrift gemacht hat, die man abgeben konnte. Die Vorlage war schon gar nicht schlecht, enthielt aber in analoger Weise all die Unregelmäßigkeiten, Fehler und Korrekturen, die ich beim Schreiben gemacht habe, Narben eben, die von dem mühsamen Prozess des Zusammenfuckelns von Gedanken zu einem linear lesbaren Text zeugten – bei einem Schreiben, bei dem sich der Text noch verändert hat. Interessant war das Schreibbüro, das ich damals in Anspruch nahm – es warb damit, dass man vor dem endgültigen Ausdruck einen Vorabzug bekam, auf dem man Fehler noch beseitigen konnte, soweit diese Korrektur den Seitenumbruch nicht tangierte. Technisch wurde das auf einer sehr modernen Schreibmaschine mit elektronischem Speicher bewerkstelligt, und es war sehr teuer und nur durch einen Zuschuss meiner Eltern bezahlbar. Etwas Besonderes aber war die Tatsache, dass ein ausgedruckter Text, also ein analoges Protokoll eines Eins-zu-eins-Verhältnisses von Produktion und Produkt, nicht nur wiederholbar wird, sondern sogar verändert werden kann. Und die Veränderung blieb unsichtbar! Keine Narben! Das wirkte sich – ich erinnere mich genau – auf den Realitätsstatus des Textes aus, der auf einmal etwas anderes war als vorher. Analog war nur noch das Ergebnis, nicht mehr der Prozess der Produktion.
Nach dem Studienabschluss bemühte ich mich um ein Promotionsstipendium und hatte die Fantasie, in der Zukunft genau das zu tun, was ich die nunmehr drei Jahrzehnte danach tatsächlich getan habe: als Sozialwissenschaftler zu arbeiten und die Ergebnisse dieser Tätigkeit insbesondere in Textform zu bringen. Wahrscheinlich gehöre ich einem der letzten Jahrgänge an, deren gesamtes Studium sich (zumindest auf der technischen Seite seiner Produktionsmittel) mit ausschließlich analogen Techniken betreiben ließ. Selbst die Literatursuche erfolgte noch ohne Datenbanken, und zwar mit Hilfe eines Katalogsystems, das in seiner Materialität meiner Robotron-Maschine sehr ähnlich war. Ich erinnere mich noch an das Geräusch in der Münsteraner Universitätsbibliothek, wenn der Kasten mit den Karteikarten zurück in das Register geschoben wurde und veritabel knallte. Es lohnte sich übrigens, trotz eher schlechter Bahnverbindung, während des Studiums die circa 100 Kilometer nach Bielefeld zu fahren, wo es nicht nur eine viel besser sortierte sozialwissenschaftliche Bibliothek gab, sondern sogar ein Microfiche-System, das die Recherche erleichtert hat. Aber auch das war radikal analog – aber wenigstens brauchte es einen Apparat, der Strom verbrauchte, um die Informationen sichtbar zu machen.
Ich habe mich unmittelbar nach dem Studienabschluss, den Berufswunsch im Kopf, auf die Suche nach einem bezahlbaren Computer gemacht, der anders als die sehr erfolgreichen C64-Rechner von Commodore nicht für Freizeitanwendungen, sondern tatsächlich als Arbeitsmittel gebraucht werden sollte. Es musste also das her, was schon damals als Industriestandard bezeichnet wurde, also ein mit dem Microsoft Disc Operating System (MS-DOS) kompatibles Gerät, das technisch etwa dem klassischen IBM-PC entsprach. In Münster gab es damals freilich nur eine IBM-Niederlassung – und ein Original-PC von IBM, wie er seit 1981 auf dem Markt war, wäre völlig unbezahlbar gewesen. Auch dafür musste man damals nach Bielefeld, wo es einen Laden von Computerschraubern gab, die preisgünstige Komponenten zu einem IBM-kompatiblen Rechner zusammenschraubten, mit 8088-Prozessor und 4,77 MHz getaktet. Meine erste Anlage hatte keine Festplatte, sondern nur zwei Floppy-Disk-Laufwerke, von denen man eines stets mit Disketten für das Betriebssystem und für Anwendungsprogramme speisen musste. Die erste Diskette lud das DOS, dann steckte man eine Diskette mit einem Textverarbeitungssystem rein – ich verwendete damals WordPerfect. Sobald man eine Sonderfunktion in Anspruch nahm, etwa Kursivschrift, musste eine andere Diskette eingesetzt werden, die dieses Tool enthielt. Und wenn der Text fertig war, kam eine weitere Diskette zum Einsatz, auf der jener dann abgespeichert wurde.
Zur Anlage gehörte ein Nadeldrucker, der hinsichtlich der Dezibelzahl der Robotron-Maschine in nichts nachstand. Die ganze Anlage war teuer – aber letztlich immer noch billiger als eine IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine, die damals den Weltstandard darstellte – und so etwas wie ein Cadillac im Vergleich zu jenem Wartburg gewesen ist, den meine Robotron symbolisierte. Diese Kugelkopf-Schreibmaschinen waren zwar kein Industriestandard mehr – aber sie standen in jedem universitären Institutssekretariat einer Generation von Professoren zu Diensten, die fast nur handschriftlich geschrieben haben, weil ihr Schreibprogramm vor der IBM-Schreibmaschine saß und nicht mit irgendwelcher Software, dafür aber mit den idiosynkratischen Handschriften der Herren Professoren (das ist ausnahmsweise mal kein generisches Maskulinum!) kompatibel waren.
Nach einem Jahr habe ich mir dann eine Festplatte gekauft – das ging dann sogar in Münster, und ich stand vor der schwierigen Entscheidung, ob ich eine mit 1 MB oder mit 5 MB Kapazität kaufen soll – wohlgemerkt Mega-, nicht Gigabyte! Ich entschied mich für 1 MB – und das nicht nur aus finanziellen Gründen, die auch eine Rolle gespielt haben, sondern vor allem, weil ich ausgerechnet hatte, dass ich in meinem Leben gar nicht so viel würde schreiben können, um einen Speicherplatz von 5 MB zu füllen – und wenn sich die Technik nicht weiterentwickelt hätte, hätte das sogar gestimmt. Danach folgte eine ganz normale digitale Biografie – es kam Windows, und es kamen stärkere Rechner, leistungsfähigere Peripheriegeräte, das Internet, die permanente Erreichbarkeit meiner Daten, unabhängig davon, wo ich mich aufhalte. Der Übergang vom Download- zum Upload-Internet spielte eine große Rolle, dann der vom stationären zum mobilen Internet. Mit dem Netz kame...