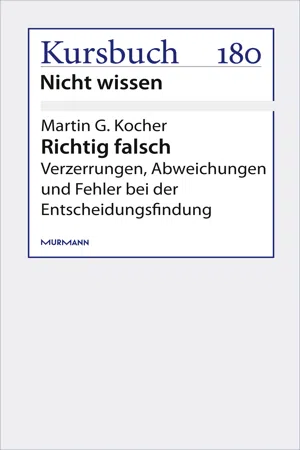Martin G. Kocher
Richtig falsch
Verzerrungen, Abweichungen und Fehler bei der Entscheidungsfindung
Je nach Definition des Begriffs »Entscheidungen« treffen wir täglich Tausende von Entscheidungen oder vielleicht doch nur ein paar Hundert. Eine ganze Menge sind es in jedem Fall. Dazu zählen wenig komplizierte motorische Entscheidungen (Soll ich zum Kühlschrank gehen und mir etwas zu trinken holen?), Kaufentscheidungen aller Art, Entscheidungen über die Organisation des Alltags (Wann fahre ich in die Arbeit?), Entscheidungen mit Suchtpotenzial (Rauche ich noch eine Zigarette?), unzählige unbewusste Entscheidungen und die wenigen Entscheidungen, über die man sich wochenlang Gedanken macht (Wie gestalte ich den Heiratsantrag an meinen Partner?).
Alle Sozialwissenschaften und die mit ihnen verwandten Disziplinen beschäftigen sich mit der Erklärung, Einordnung und Vorhersage von menschlichen Entscheidungen. Wie so oft erhebt die Ökonomik den Alleinerklärungsanspruch der Sozialwissenschaften. »Economics is the science of choice« ist eine oft verwendete Definition für den Gegenstand der Wirtschaftswissenschaft, dessen Ursprung nicht sicher nachvollzogen werden kann, aber sie stammt wahrscheinlich von dem kanadischen Volkswirt und Nobelpreisträger Robert Mundell. Der Vorteil der Wirtschaftswissenschaft ist, dass sie als einzige Sozialwissenschaft ein einheitliches entscheidungstheoretisches Modell besitzt und eben nicht, wie zum Beispiel die Psychologie, eine Vielfalt an Paradigmen, die nebeneinanderstehen, sich gegenseitig ergänzen, aber sich auch bis zu einem gewissen Grad wechselseitig ausschließen. Keine Stärke kommt natürlich ohne Schwäche: Die empirische Validität des ökonomischen Entscheidungsmodells – gemeinhin auch als Modell des Homo oeconomicus bekannt – ist, vorsichtig formuliert, nicht gesichert.
Wie werden Entscheidungen getroffen?
Was sind die elementaren theoretischen Bestandteile einer Entscheidung aus ökonomischer Sicht? Ausgehend von einer wohldefinierten Situation – nehmen wir einmal an, dass es eine solche gibt – wird aus dem Möglichkeitsraum die optimale Variante gewählt. Was »optimal« ist, wird über die Präferenzen des Entscheiders definiert. Also ganz banal: Ich gehe die Speisekarte durch und wähle das Essen, das meinen Nutzen maximiert, gegeben die Preise und die Auswahlmöglichkeiten. Manchmal, besonders in der Soziologie, wird für die standardökonomische Sichtweise der Entscheidungsfindung der Begriff »Theorie der rationalen Entscheidungen« (rational choice theory) verwendet.
Wie würde ein Psychologe die Entscheidungssituation beschreiben? Er oder sie würde wahrscheinlich größeren Wert auf die Analyse dessen legen, was die Ökonomen als »Präferenzen« definieren. Viele moderne psychologische Entscheidungstheorien unterscheiden zwischen zwei Entscheidungssystemen: dem unbewussten (auch System 1 genannt) und dem bewussten (System 2). System 1 ist immer aktiv und würde uns wahrscheinlich direkt und ohne Umwege unsere Lieblingsspeise auf der Speisekarte vorschlagen. System 2 muss bewusst »eingeschaltet« werden und erfordert eine psychische Kraftanstrengung. Es würde uns möglicherweise im Rahmen der Entscheidung an unsere Diätpläne erinnern oder daran, dass wir danach wieder in die Arbeit müssen und daher nicht allzu schwer essen sollten. System 1 steuert die heuristische, die emotionale Komponente zum Entscheidungssystem bei. System 2 ist verantwortlich für kognitive beziehungsweise rationale Aspekte. Die Einteilung in die beiden Systeme ist natürlich nur eine Metapher für das, was wirklich im Gehirn passiert. Es gibt aber tatsächlich Entsprechungen in der Anatomie des Gehirns für System 1 und System 2: das Stammhirn und den Kortex. Allerdings ist die Funktionsweise des Gehirns natürlich viel komplexer, und die Einteilung in die zwei Systeme – auch als duale Prozesstheorie bekannt – ist nicht mehr als eine Krücke, um Entscheidungsmodelle prägnant und nachvollziehbar darstellen zu können. Des Weiteren würde ein Psychologe ziemlich sicher über den Kontext der Entscheidung, den Entscheidungsrahmen und über die individuelle Perzeption des Entscheidungsproblems sprechen. Dazu kommen Persönlichkeitseigenschaften des Entscheiders, die die Entscheidungsfindung beeinflussen und damit auch das Resultat des Entscheidungsproblems.
Ohne Zweifel ist der psychologische Zugang reicher als der ökonomische. Damit erlaubt er eine präzisere Beschreibung von Entscheidungen. Allerdings bemisst sich die Qualität eines Modells nicht nur an der Beschreibung eines Zusammenhangs, sondern einerseits an der Erklärung von Sachverhalten in der Welt und andererseits an der Vorhersagekraft des Modells in der Realität, wenn möglich auf individueller Ebene. Insbesondere Letztere ist wichtig im Zusammenhang mit der Gestaltung von Institutionen, Regeln und Normen, wenn es zum Beispiel um die Ausgestaltung der Entscheidungsarchitektur für eine ganz konkrete Entscheidung geht. Eine gewisse generelle Unfähigkeit aller Wissenschaften, die sich mit Lebewesen beschäftigen, die Zukunft auf individueller Ebene vorherzusagen, wird zwar immer wieder von Wissenschaftlern verkannt, kommt dann aber umso stärker ins Bewusstsein der Menschen, wenn die Situation durch gravierende Konsequenzen gekennzeichnet ist – als Beispiele mögen die Finanzkrise oder die Ausbreitung von Ebola dienen. Ökonomen haben diesbezüglich kein Monopol in der Welt der Wissenschaft.
Natürlich ist Ökonomen bewusst, dass ihre Standardtheorie keine adäquate Beschreibung der Prozesse der Entscheidungsfindung bereitstellt. Das Hauptargument zur Verteidigung der klassischen Theorie ist, dass man den Prozess als black box vernachlässigen kann, wenn die Theorie gute Vorhersagekraft besitzt. Die Menschen, die Entscheidungen treffen, verhalten sich so, als ob sie dem Modell folgen würden. Die Analogie für das Als-ob-Argument, das der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman oft verwendet hat, kommt aus der Physik. Ebenso wenig wie Menschen in der Lage sind, rationale Entscheidungen im ökonomisch-relevanten Umfeld zu treffen, sind sie in der Lage, die komplizierten Differenzialgleichungen zu lösen, die den Bewegungsablauf beim Fahrradfahren beschreiben. Trotzdem können sie perfekt Fahrrad fahren1.
Homo oeconomicus – eine pathologische Extremvariante
So bestechend das Argument ist, so falsch ist es letztlich generell. In der Tat ist es so, dass wir gelegentlich Verhalten auf aggregierter Ebene beobachten, das konsistent ist mit dem ökonomischen Standardmodell – oder genauer genommen: mit dessen Grundannahmen. Allerdings ist es viel häufiger der Fall, dass wir systematische Abweichungen oder Verzerrungen (sogenannte biases) beobachten. Das Standardmodell vernachlässigt auch die große Heterogenität der Entscheidungsfinder bezüglich der Entscheidungsqualität. Mit anderen Worten: Es gibt gewisse Cha...